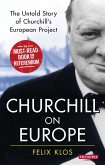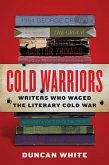Produktdetails
- Verlag: Yale University Press
- 2nd ed.
- Seitenzahl: 384
- Englisch
- Abmessung: 242mm
- Gewicht: 1186g
- ISBN-13: 9780300094381
- ISBN-10: 0300094388
- Artikelnr.: 11393363

Mit großen Männern Geschichte machen: Winston Churchills personenbezogene Diplomatie
Klaus Larres: Churchill's Cold War. The Politics of Personal Diplomacy. Yale University Press, London 2002. 583 Seiten, 25,- £.
Zufrieden schmunzelt Sir Winston Churchill - in einen festen Militärmantel gehüllt - vom Umschlag des Buches, das Klaus Larres der Rolle des Politikers im Kalten Krieg gewidmet hat. Dieses Lächeln dürfte Churchill freilich trotz aller optimistischen Selbsttäuschung vergangen sein, als er am 5. April 1955 - von seinem Nachfolger Anthony Eden wie nahen Freunden seit langem gedrängt - vom Amt des Premierministers zurücktrat. Seine selbstbewußten Abschiedsworte konnten die Tatsache kaum verdrängen, daß er das Ziel seiner Gipfelpolitik verfehlt hatte. Weder war es zu einer besseren Regelung der Ost-West-Beziehungen gekommen, noch war es gelungen, die Rolle des Vereinten Königreichs als Weltmacht zu behaupten. Nach zahlreichen Büchern - nicht zuletzt auch den Veröffentlichungen des glänzenden Autors Churchill selbst - schließt Klaus Larres mit seiner kritischen und auf gründliche Quellenforschung gestützten Darstellung der letzten Regierungszeit des Premierministers eine bislang fast ganz übersehene Lücke.
Im Rückblick von diesen Jahren 1951 bis 1955 aus fällt auch ein anderes Licht auf das Lebenswerk dieses großen Staatsmanns. So erfährt man zum Beispiel, wie sehr Churchill gehofft hatte, das sinnlose Wettrüsten zur See zwischen dem Deutschen Reich und England, das wesentlich zur zunehmenden Entfremdung zwischen beiden Ländern beigetragen hat, zu beenden. Er war noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg bereit, als Marineminister auf der Kieler Woche mit Kaiser Wilhelm II. und Großadmiral von Tirpitz, Gespräche mit dem Ziel einer Begrenzung der beiderseitigen Kriegsflotten aufzunehmen. Die britische Regierung lehnte das Vorhaben als sinnlos ab. Der Rüstungswettlauf, der zur Konzentration des Schiffbaus auf die Funktion der Beherrschung der Nordsee zwang, schien Churchill vor allem auch wegen der andersartigen Flottenaufgaben im Rahmen des Empire schädlich. Ganz ähnlich wie Churchill damals auf Entspannung im Interesse der imperialen Rolle Englands abgezielt hatte, stand später seine Bemühung um Beendigung des Kalten Krieges im Dienste der Bewahrung des Empire und der Weltstellung der britischen Großmacht.
Während eines Besuches in Deutschland hätte sich Churchill nicht einmal vor einer Begegnung mit Adolf Hitler gescheut, die sein Sohn Randolph, der mit Ernst ("Putzi") Hanfstaengl - dem "Leibfotografen" des Diktators - gut bekannt war, zustande bringen wollte. Die Begegnung in einem Münchener Hotel ist nach Churchills Version an dessen Verurteilung des Hitlerschen Antisemitismus gescheitert, nach Hanfstaengls Version an Hitlers Scheu vor dem großen Staatsmann, für die der "Führer" seine schlechte Rasur zum Vorwand benützte. Bei aller radikalen Ablehnung brutaler Diktatoren wie Hitler und Stalin war Churchill stets bereit, wenn nötig und möglich, mit ihnen zu verhandeln. Im Hintergrund empfand er vermutlich eine leise Bewunderung für den Erfolg dieser Machtmenschen.
Das Bild Churchills im allgemeinen Bewußtsein der Zeitgenossen und Nachgeborenen wird wahrscheinlich für immer durch dessen mutige Entscheidung für die Fortsetzung des Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland nach der Kapitulation Frankreichs bestimmt bleiben. Um Hitler zu besiegen, war er sogar bereit, mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten. Schon vor dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juni 1941 hatte er mit Moskau Fühlung aufgenommen. "Um Hitler zu besiegen, hätte ich sogar mit dem Teufel mich verbündet", sollte er einmal sagen. Während des Krieges glaubte er Stalin als einen zwar skrupellosen, aber doch auch verhandlungsbereiten Verbündeten kennengelernt zu haben. Obgleich Churchill durch seine Rede im März 1946 in Fulton das Wort vom "Eisernen Vorhang" populär gemacht und vor dem Expansionsstreben der Sowjetunion nachdrücklich gewarnt hatte, liest Larres aus der gleichen Rede auch schon ein lebhaftes Interesse an einem Gipfelgespräch der "Großen Drei" zum Zweck der friedlichen Regelung ihrer Beziehungen heraus.
Schon als Oppositionspolitiker und vollends seit seiner Eigenschaft als Premierminister drang Churchill auf ein Gipfelgespräch, in dem - ohne feste Tagesordnung - alle Konflikte zwischen Ost und West und das künftige Schicksal Deutschlands diskutiert und womöglich geregelt werden sollten. Wiederholt schlug er eine Vereinigung der beiden deutschen Gebiete bei gleichzeitiger Neutralisierung des vereinten Landes vor und glaubte damit dem Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion entgegenzukommen, die die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik im Rahmen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu verhindern suchte.
Anfangs glaubte Churchill, die atomare Überlegenheit des Westens durch die Atombombe und später die Wasserstoffbombe könnte die Geneigtheit Moskaus für ein Arrangement befördern. Nach dem Tode Stalins am 5. März 1953 setzte er auf die Schwäche der neuen Machthaber und hielt Malenkow für einen geeigneten Gesprächspartner. Immer wieder stieß er jedoch nicht nur bei der amerikanischen Regierung, sondern auch im eigenen Foreign Office auf Widerstand. Der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 schien seinen Plänen den Todesstoß zu versetzen, aber Churchill interpretierte das Ereignis ganz anders. Er verwies auf die sichtbare Zurückhaltung der Roten Armee bei ihrer Hilfe zur Unterdrückung des Aufstands und meinte, die sowjetische Regierung könnte gern bereit sein, ein so schwer zu befriedendes Land aus dem eigenen Herrschaftsbereich - bei gleichzeitiger Entwaffnung - zu entlassen.
Als einflußreicher Gegenspieler von Churchills Deutschland-Konzepten spielte im Hintergrund Konrad Adenauer eine wesentliche Rolle. Der Bundeskanzler scheute sich nicht einmal - gegen alle diplomatischen Regeln verstoßend -, einen seiner Mitarbeiter uneingeladen nach Washington zu schicken, wo ein wichtiges Gespräch zwischen der britischen und der amerikanischen Regierung stattfand. Das wäre nicht notwendig gewesen, da John Foster Dulles ohnehin nachdrücklich vor Churchills Gipfelplänen warnte. Als schließlich eine Viermächtekonferenz in Berlin zustande kam, war von vornherein ausgemacht, daß sie mit einem Scheitern enden werde. Der französische Ministerpräsident Joseph Laniel hoffte, auf diese Weise die Zustimmung seines Parlaments zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu erzwingen. Nachdem die Verteidigungsgemeinschaft abgelehnt worden war, favorisierte auch Churchill die Aufnahme der Bundesrepublik in die Nato. Den endgültigen Todesstoß versetzten aber - unwissentlich - die Machthaber in Moskau Churchills Plänen, als sie eine Konferenz aller europäischen Staaten sowie Chinas und der Vereinigten Staaten vorschlugen, auf der europäische Sicherheitsfragen einschließlich der Deutschland-Frage behandelt werden sollten. Der Premierminister meinte ironisch: "Foreign Secretaries of the world unit, you have nothing to lose but your jobs."
Churchill überlebte seinen Rücktritt als Premierminister noch zehn Jahre. Der Bericht über seine letzte Amtszeit hinterläßt einen melancholischen Eindruck. Körperlich erschöpft, zweimal von Schlaganfällen vorübergehend außer Gefecht gesetzt, unter Gedächtnisschwund leidend, schwerhörig, aber unverändert kampflustig, galten seine Bemühungen fast ausschließlich dem großen Ziel der Beendigung des Kalten Krieges, der Verhinderung eines atomaren Holocaust, der ganz Europa vernichtet hätte, und der Bewahrung der Großmachtrolle Englands.
Klaus Larres versucht, die Bilanz der letzten Amtszeit in etwas hellerem Licht zu sehen. Beide Amtsnachfolger Churchills, Anthony Eden und Harold Macmillan, hätten ja - sosehr sie Churchill vorher widersprochen hatten - seine Politik des Strebens nach persönlicher Gipfeldiplomatie und Festigung der britischen Großmacht fortgesetzt. Als schließlich der Kalte Krieg wirklich zu Ende ging, spielten England wie Frankreich neben der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten nur noch eine Nebenrolle. Am Ende gab es nur noch eine wirkliche Großmacht: die Vereinigten Staaten. Auch das hätte Churchill unbedingt zu vermeiden gesucht. Als Trost bleibt der britischen Regierung nur noch die oft überschätzte "special relationship" mit dem angelsächsischen Bruderland.
Mit Churchill, der bis zuletzt Parlamentsmitglied blieb, ist 1965 der bedeutendste Staatsmann des zwanzigsten Jahrhunderts gestorben. Groß durch seine Erfolge und größer noch durch seine kühne Vision eines vereinten Europa, dem freilich England nicht angehören sollte, bewies er noch einmal, daß zuweilen "Männer doch noch Geschichte machen können" - was übrigens auch Frauen wie Golda Meir in Israel und Lady Thatcher in Großbritannien bewiesen haben.
IRING FETSCHER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main