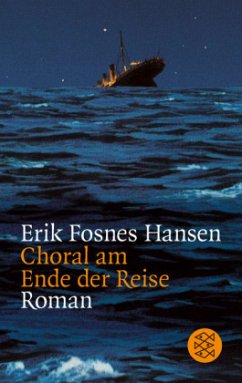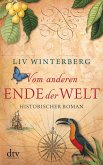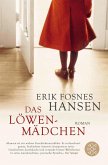Die Titanic war das größte und modernste Passagierschiff ihrer Zeit, und ihre Jungfernfahrt in den Untergang hat die Schriftsteller unseres Jahrhunderts immer wieder beschäftigt. So sehr, daß ihr Name zur Metapher für die apokalyptischen Visionen und Untergangsstimmungen des 20. Jahrhunderts wurde. Die Geschichte beginnt am 10. April 1912. An diesem Tag gehen im englischen Southhampton sieben Musiker an Bord des Luxusliners, der auf seiner fünftägigen Jungfernfahrt mehr als zweitausend Menschen nach New York bringen soll. Die Musiker, eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus aller Herren Länder, sind für die musikalische Unterhaltung während der Seereise zuständig. In den fünf Tagen, die ihnen noch an Bord verbleiben, lernt man ihre höchst unterschiedlichen Lebensgeschichten kennen - Biografien voller Hoffnungen und Niederlagen, voller Leidenschaften und Verzweiflung.

Das letzte Konzert auf der "Titanic" / Von Heinrich Detering
Mit keinem Ozeandampfer haben die Künstler dieses Jahrhunderts lieber Schiffeversenken gespielt als mit der Titanic. Keine Dramatik und keine Symbolik, die nicht ausgekostet wäre. Von Hollywood bis zu Enzensberger: Die Schatzsucher der Weltkultur haben das Wrack längst geplündert. Und dann kommt der noch nicht dreißigjährige Erik Fosnes Hansen und präsentiert einen Roman vom Untergang der Titanic so frisch und selbstsicher, als hätte er den Stoff als erster entdeckt.
Die Reise als Lebensreise in den Tod, das Schiff mit seinen Dreiklassendecks als Allegorie sozialer Ordnungen, die spektakuläre Havarie des Luxusdampfers als Vorzeichen abendländischer Endzeit - ein Roman, der dies alles im Ernst noch einmal erzählen will, müßte nach menschlichem Ermessen ebenso rettungslos absaufen wie das Schiff, von dem er handelt. Aber siehe da: Diese Geschichte wandelt über das Wasser wie Petrus, der bekanntlich auch erst zu sinken beginnt, wenn ihn der Zweifel ankommt. Ein kleines Wunder.
Hiernach herrscht keine Panik auf der Titanic. Eben weil der Ausgang allen außer den Beteiligten von vornherein klar ist und schon hundertmal erzählt, kann sich die Aufmerksamkeit von Erzähler und Lesern in aller Ruhe auf diese Beteiligten selbst richten. Vor der dunklen Folie des katastrophalen Todes berichtet dieses Buch vom Leben, von einigen der Lebensläufe nämlich, die dieser Tod beenden wird.
Es sind die Lebensläufe der sieben Musiker, aus denen sich das kleine Bordorchester zusammensetzt (in Wahrheit waren es acht, wie das Nachwort vermerkt; die Änderung hat, wie sich zeigt, einen triftigen Grund). Jeder Bericht ist nach Novellenart auf ein zentrales Motiv konzentriert. Dadurch bekommt der Roman etwas von einem schön geflochtenen Novellenkranz - nur daß sich hier, anders als vor den Toren des pestgeschlagenen Florenz oder auf der Flucht vor der Französischen Revolution oder im Wirtshaus im Spessart, die vom Tode Bedrohten nicht gegenseitig Geschichten erzählen, sondern daß sie selbst als Geschichten erzählt werden.
Eine romantische Künstlernovelle, eine Mordgeschichte, eine dickenssche Jugend in London, Szenen aus der Wiener Boheme des Fin de siècle, ein burlesker italienischer Schwank, britischer Klassenkampf und österreichisches Pfadfinderlager, Parodie und Puppenspiel, Astronomie und Bibelkunde, antiker Mythos und theosophische Geisterschau: dies alles ist je auf seine Weise spannend und mit viel Sinn für Unterhaltung erzählt, und dennoch bleibt Raum für jede Einzelheit. Immer spricht der Erzähler mit der Gelassenheit dessen, der schon weiß, wie es ausgeht, und mit der Neugier darauf, wie es dahin kommt.
Leider hat diese Unbekümmertheit ihren Preis. Nicht nur, daß streckenweise mehr europäisches Bildungsgut in diesen Roman hineingestopft ist, als ihm guttut, auch stilistisch agiert er manchmal arg bedenkenlos. So ruhig und genau er manche Interieurs und Seelenregungen erfaßt, so atemberaubende Bauchlandungen vollführt er unversehens auf den flachsten Gemeinplätzen. Mit der Präzision eines Uhrwerks bleibt das Lachen im Halse stecken, das Leben ist ein Lehrmeister und die kokette Französin ein Wirbelwind. Auch den gescheiterten Komponisten Leo hätte man gern von der Passagierliste gestrichen.
Dieser blondgelockte Mozartknabe ist unter Führung seines mephistophelischen und dem Glücksspiel ergebenen Meisters zum tragisch-dunklen Bajazzo geworden und wie jener Teufelsgeiger dem Rauschgift verfallen. Einsam vertraut der deutsche Tonsetzer seinen Schmerz im Walde der Geige an, und weil es nicht gut ist, daß der Mensch allein sei, gesellt ihm der menschenfreundliche Erzähler auch noch ein zerlumptes Zigeunermädchen bei, mitsamt einem treuen Schäferhund.
Bei anderen Autoren könnte ein solches Kapitel einen ganzen Roman aus der Kurve tragen. Hier aber folgt dem verblüffenden Absturz ein nicht minder frappierender Aufschwung. Die anschließende Liebesgeschichte des jüdischen Knaben David aus einer Wiener Vorstadt, fast hundert Seiten lang, ist wieder so zart und witzig, so fehlerlos erzählt, daß alles andere vergeben ist.
Wie derlei höchst anschaulich und tiefenscharf geschildert ist, so ergeben sich andererseits auch die allegorischen Anwendungsmöglichkeiten des Geschehens bemerkenswert zwanglos. Entweder liegen sie so folgerichtig und offen vor uns wie ebendas Spiel der Musiker auf dem sinkenden Schiff, oder sie sind so unaufdringlich angedeutet, daß man sie gern überlesen darf. Unter den vielen Gütern zum Beispiel, die das Schiff transportiert, ist befremdlicherweise auch "eine Tonne Erde". Einmal nur wird das erwähnt - kaum denkbar, daß man das Bild einer globalen Apokalypse diskreter andeuten könnte.
Die diskreteste dieser Andeutungen enthüllt unauffällig die emblematische Signatur des Romans. Einmal fällt beiläufig Davids und des Lesers Blick aus einem dunklen Zimmer eines Wiener Bürgerhauses auf ein Bild im bunten Glasfenster. Es zeigt sieben rote Rosen im Halbkreis um ein blaues Kreuz. Sieben Namen waren es, wie man sich jetzt erinnern könnte, deren Aufzählung vor dem Beginn der Erzählung stand: sieben Knospen, die mit den Lebensgeschichten der Musiker nacheinander aufblühen. Und das Zeichen von Tod und Erlösung in ihrer Mitte - es erscheint im blauen Licht der Romantik und des nordischen Eismeers. Später, wenn das Schiff versinkt, wird dieses Motiv noch einmal ganz rasch anklingen. Aber nicht mehr Kreuz und Rosen streifen dann das Bewußtsein des Sterbenden, sondern das Licht, das von der verborgenen anderen Seite her hindurchschien und das Bild erst sichtbar machte.
Dieses Emblem begleitet in einer musikalischen Variante den ganzen Roman als leiser Generalbaß. Vor jedem Kapitel nämlich steht eine Note. Zusammengelesen ergeben sie eine C-Dur-Oktave. Sieben Noten, für jeden der Musiker eine; dann die achte, die Wiederholung der ersten auf höherer Stufe, für das Ende. Oder, wie ein paar verstreute theologische Anmerkungen zu verstehen geben: sieben Schöpfungstage und dann die Ewigkeit. Der Erzähler ist selbst ein Komponist und ein alter Deus obendrein. Allwissend führt er Regie, läßt seine Figuren frei laufen und führt sie doch, durch die Kulissen von Zufall und Kausalität, behutsam zum vorbedachten Ende. Das alles könnte aufdringlich wirken, wäre es nicht so unbefangen ernst und zart durchgeführt.
Dieser Roman ist in mehrfacher Hinsicht entwaffnend: eine sanfte Apokalypse, ein schöner, stiller Schmöker, ein liebes Buch. Erik Fosnes Hansen spielt nicht nur mit der Analogie von Vorsehung und Erzähltechnik. Er ist auch ein leibnizscher Optimist, der den Candide gelesen hat und nun durch alle Schrecken des Eises und der Finsternis hindurch zeigen will, daß am Ende, am Ziel der Geschichten, doch alles sehr gut gewesen sein wird.
Und dann haben es ja alle vorher gewußt, und schließlich bemerken es auch die Helden selbst: Die Reise wird nicht gutgehen. Trotzdem erfüllt sich in der Katastrophe ein Plan, setzt der Geist der Erzählung noch einmal seinen Willen durch, unberechenbar und witzig wie eh und je. Denn die alten Bilder, die wir filmgewohnt erwarten, sehen aus anderer Perspektive aus wie neu. Keine heroischen Gentlemen, die im Nordmeer Haltung bewahren und Choräle singen, nichts von "Nearer my God to Thee". Der "Choral am Ende der Reise" ist ein Ragtime auf dem abkippenden Oberdeck. Die Musiker, aus deren Biographien sich die in diesem Augenblick endende sinfonische Dichtung zusammengefügt hat, spielen ihr letztes, in der Panik schon nicht mehr gehörtes Lied. Dann, im letzten Satz, geht das Schiff unter.
Erik Fosnes Hansen: "Choral am Ende der Reise". Roman. Aus dem Norwegischen übersetzt von Jörg Scherzer. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 1995. 508 S., geb., 45,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main