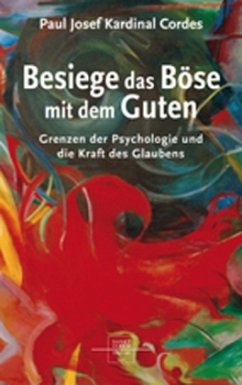Abscheu aber auch Faszination prägen seit jeher das Verhältnis der Menschen zum Bösen. Doch kann man das Böse besiegen? Der deutsche Kurienkardinal Paul Josef Cordes zeigt Wege zur Bewältigung des Bösen auf aus der Psychoanalyse, aus der Soziologie, vor allem aber aus dem Leben der Kirche, denn Christen sind dem Bösen nicht wehrlos ausgeliefert: Jesus Christus hat ihnen wirksame Waffen an die Hand gegeben.

Psychologie und Glauben: Kardinal Cordes stellt in Rom sein Buch vor
Die Taxifahrer sind erst einmal ratlos. Noch wurde die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl nicht in das touristische Basispaket von Rom aufgenommen. Winzig ist die „Straße der drei Uhren”, in der sie inmitten des Villenviertels Parioli liegt, unscheinbar die steile Auffahrt, vorbei an einem Schwedenschlösschen und einem Karmelitinnenkloster, scharf die Kurve, die vor einem ockerfarbenen, mehrgeschossigen Ziegelbau abrupt endet. Hier hat der Münchner Architekt Alexander von Branca in den Jahren 1979 bis 1984 sein vielleicht schönstes Gebäude geschaffen: eine Residenz im Stile des Stauferkaisers Friedrich II. trutzig und kühl, herrschaftlich und würdevoll, mit Türmen und Zinnen, Balustraden und Balkonen. Hier plaudert man nicht, hier wird räsoniert.
Seit wenigen Tagen informiert ein Kunstführer über Bau und Ausstattung der Botschaft. Von Branca, Schöpfer auch der Neuen Pinakothek in München und zahlreicher Kirchen, wird darin mit den Worten zitiert, Friedrichs sizilianische „Einfachheit, Klarheit und zurückhaltende Monumentalität” seien ihm Chiffre gewesen „auch einer modernen klaren Einfachheit”. Freudig überreicht Hausherr Hans Henning Horstmann die Broschüre seinen Gästen – auch an jenem Frühlingsabend, als die deutsche Enklave sich in der Via dei Tre Orologi traf, um wieder einmal dem Drama von Gut und Böse zu lauschen.
Paul Josef Cordes, einst Student der Medizin, heute Kurienkardinal und Präsident des Päpstlichen Rates „Cor Unum”, der die humanitären Projekte des Vatikans koordiniert, will das Verhältnis von Glaube und Psychologie neu bestimmen. Darüber schrieb er ein Buch, darüber sprach er nun unter den wachen Augen Leos XIII. und Gottfrieds von Bouillon. (Besiege das Böse mit dem Guten. Grenzen der Psychologie und die Kraft des Glaubens. Augsburg 2009, 144 Seiten, 16,90 Euro.)
Der zentrale Raum der Botschaft, der Empfangssaal, wird beherrscht von einem Gobelin aus dem 18. Jahrhundert und einem Gemälde von 1885. Das mächtige Bild zeigt Papst Leo XIII., wie Franz von Lenbach ihn nach einer Fotografie verewigte, der Gobelin aus der Werkstatt Pietro Ferlonis hingegen die Wahl Gottfrieds zum Heerführer beim ersten Kreuzzug. Das sehr spielerisch wiedergegebene Motiv knüpft an Torquato Tassos Versepos vom „Befreiten Jerusalem” an. Horstmanns einleitende Worte ließen keinen Zweifel, dass an diesem Abend aber nur die innere Befreiung des Menschen gemeint sein konnte: Ein urmenschliches Bedürfnis und zugleich ein christlicher Auftrag sei es, gut zu sein.
Die Armut des Sich-Gehörens
Warum aber ist der Mensch oft böse? Und wer kann ihm den Pfad der Tugend weisen? Cordes rechnet Psychologie und Psychoanalyse den „religionsfernen Disziplinen” zu. Das „atheistische Erbe” könnten und wollten viele Nachfahren Freuds nicht verleugnen. Dennoch dürfe „die Phobie des Abstands den Seelsorger nicht auf Dauer leiten”. Im Buch, dessen Titel dem Römerbrief entnommen ist, wird als Grundannahme jeder säkularen oder geistlichen Seelsorge die tatsächliche Existenz des Bösen benannt. Es reiche jedoch mit all seinen destruktiven Potentialen „weit über das Meß- und Prüfbare hinaus”. Eine rein akademische, empiriebasierte Psychologie habe diese ihre Grenze anzuerkennen: „Wer das Zusammenleben der Menschen heilen will, muss beim menschlichen Herzen beginnen; muss ihn lehren, dem Guten zu folgen, das Gott in ihm weckt”.
Cordes’ römischer Gesprächspartner war der Philosoph und Vizepräsident der italienischen Abgeordnetenkammer, Rocco Buttiglione. Auch er verwies auf die „positivistische Ideologie” als den historischen Nährboden der Psychoanalyse. Erst wenn sie eine Metakritik ihrer eigenen Wissenschaftlichkeit entwickele, ihr Grenzenbewusstsein also stärke, sei die Psychoanalyse davor gefeit, zu einer falschen Theologie herabzusinken. Sie sei eben nicht der „Generalschlüssel, mit dem sich alle Bereiche des menschlichen Lebens aufschließen lassen”. Auf diesem reinigenden Weg, hoffte Buttiglione, könne der zentrale Autonomiebegriff eine menschenfreundlichere Wendung erhalten. „Wie arm”, sprach er leidenschaftlich und auf Deutsch, „ist ein Mensch, der nur sich selbst gehört! Freiheit bedeutet nicht, mit sich selbst allein zu sein, Freiheit ist immer Communio, ist immer Gemeinschaft”. So mündeten die römischen Lektionen zwischen Lenbach, Ferloni und von Branca in einen Appell, sich von der Psychologie nicht vorsagen zu lassen, was denn Glück und was denn Freiheit sei – ohne sich taub zu stellen für deren Einsichten in die Entstehungsbedingungen von Angst und Verzweiflung.
Cordes weiß, dass im Binnenraum seiner Kirche mit psychologischem Betroffenheitsjargon, mit Gruppenarbeit und Paartherapie zuweilen Allotria getrieben wird. Unlängst karikierte der Schriftsteller Michael D. O’Brien in seinem Bestseller „Father Elijah” die Dominanz psychotherapeutischer Übungen während der Priesterausbildung. Er spottete über eine gewiss erfundene „Therapie namens Christo-Kundalini-Yoga, die dem Priester helfen sollte, den Schlangengeist am Fuße seiner Wirbelsäule zu erwecken”. Demgegenüber vertraut Cordes auf Gebet, Beichte und die „Kraft des Verstandes”. Das zahlreich erschienene Publikum klatschte laut und klatschte herzlich und ahnte: Das Böse ist Beziehungslosigkeit. ALEXANDER KISSLER
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Plötzlich ist das Buch eines Kardinals auch politisch / Von Heinz-Joachim Fischer
Vor nicht allzu langer Zeit hätte man ein solches Buch als unpolitisch und höchst unaktuell betrachtet. Schon der Titel ist bald zweitausend Jahre alt, ein Bibelwort aus dem 12. Kapitel des Briefes an die Römer; von jenem Mann, der als Saulus die Christenschar des Jesus von Nazareth verfolgte, sich dann jedoch zur Botschaft des österlich Auferstandenen bekehrte und als Paulus der christlichen Sekte unter den Juden durch die Wende zum Universalismus mit allen "Heiden" den Weg zur großen Weltreligion eröffnete. Aber das Jubiläumsjahr des Paulus von Tarsus, Ende Juni 2008 von Papst Benedikt XVI. feierlich zu dessen Geburt vor zwei Jahrtausenden eröffnet und bis in diesen Sommer hinein dauernd, zieht ohne große Bekehrungen und neue Einsichten vorbei.
Vielleicht bedurfte es der Erschütterung in den westlichen Gesellschaften durch eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise, um den ersten Satz des Buches von Kardinal Cordes richtig zu verstehen: "Wohl niemand wird bestreiten, dass uns das Böse fasziniert." Oder einen weiteren: "Die grausame Niedertracht von Zeitgenossen lässt uns immer neu schockartig erwachen." Wieso "das Böse", wieso "die Niedertracht", hätte man vor kurzem noch unschuldig gefragt und mit flinken Erklärungen das Betreffende genauso (vermeintlich) entsorgt wie faule Kredite. Man hätte das Gift des Bösen verpackt und weitergeschoben, hätte von krankhaft ansteckender Niedertracht nichts wissen wollen, sich mit ruhigem Gewissen und sattem Gewinn der Illusion hingegeben, dass alles Schlechte mit Verdrängen verschwunden sei. Auch den Begriff der Politik hatte man darauf eingeschränkt, Regeln und ein paar Warntafeln aufzustellen, weil die Selbstheilungskräfte der Märkte und der doch selbstverständliche Anstand der Beteiligten alles zum Besten fügen würden. Ein altes Griechisch-Lexikon von 1858 (Benseler-Kaegi) belehrt hingegen, gleichsam als Propädeutik des Buches, dass die Antike "Politeia", das Politische also, zuerst als "das Verhältnis eines freien Bürgers zum Staate" betrachtete, als "das Benehmen eines Bürgers, das Treiben, die Grundsätze der Bürger eines Staates", insbesondere die seiner Eliten.
Der Bürger soll also gut sein, lautet die politische und soziale Aufforderung des Paulus und des deutschen Kardinals. Paul Josef Cordes tut seit bald 30 Jahren an der Römischen Kurie Dienst, zuerst als Vizepräsident des vatikanischen Laien-Rates, dann, seit 1995 als Präsident des Päpstlichen Caritas-Hilfswerks "Cor Unum" (Ein Herz). Der Bürger soll an das Gute glauben, und, weiter, davon überzeugt sowie darüber beunruhigt sein, dass es das Böse gibt, in der Wirklichkeit und in ihm selbst.
Da hätte man vor kurzem auch noch gehört: Dass wir nicht lachen! Aber inzwischen ist uns das Lachen vergangen. Eigentlich hätte das Lachen schon im 20. Jahrhundert mit den mörderischen Ideologien verschwinden müssen. Aber da gab es, so weist der gelehrte Prediger und lebensnahe Theologe auf, Soziologie und Psychologie, eines Sigmund Freud zum Beispiel, die das Böse und die Schuld des Einzelnen, christlich gesagt, die Sünde, wegzauberten, sie der Gesellschaft ob deren Fehlkonstruktion zuschoben oder einer traumatischen Kindheit anlasteten.
Es sind "die Grenzen" von Psychologie und Soziologie, die der Kardinal freundlich, aber bestimmt aufzeigt. Damit will er als guter Christ jedoch gerade nicht dem einzelnen Menschen Sünde und Schuld neurotisch aufladen. Er macht ihm vielmehr Mut, "dem Bösen zu widerstehen, in der Mitwelt und im Herzen". Das geschieht für den Kardinal natürlich durch den Glauben an einen gütigen und verzeihenden Gott, aber eben auch durch die Einsicht, dass nicht nur im Staat etwas faul sein kann, sondern auch im persönlichen "politischen" Verhalten. Deshalb das "Plädoyer für das individuelle Sündenbekenntnis", im Katholischen kurz "Beichte" genannt, die eben auch das Anerkennen persönlicher Verfehlungsfähigkeit ist. Geldgier kann so nicht mehr ein für alle Mal als Strukturfehler des Kapitalismus wegreguliert werden, sondern steckt offenbar in jedem Menschen als sündhaftes Habenwollen. Da hilft es dem Menschen auch nicht, wenn er die Sünde nicht wahrhaben will, sich wie Adam nach dem Sündenfall im Paradies vor Gott versteckt. Persönliche Sünde und gemeinschaftliches Versagen stehen in Beziehung.
Wenn es so mit dem Menschen und der Gesellschaft steht, müsste man düster in die Zukunft sehen. In dem letzten der vier langen Essays setzt Kardinal Cordes seine Antwort gegen jeden Kulturpessimismus. Er spricht von der "christlichen Mündigkeit", ersetzt den statischen Begriff des "Christseins" durch den politisch-dynamischen des Christ-Werdens, der Mündigkeit des Glaubenden, der nach dem Beispiel des Jesus Christus das Sündhafte wahrnimmt, doch abschüttelt. Es geht vor allem um den Glaubenden, der in lebendiger Gemeinschaft glaubt, auch in jenen jungen "Bewegungen" der Kirche, die aus einem scheinbar naiven Glauben an das Gute dies einfach tun wollen und aus der Überzeugung, dass man nur so das Böse besiegen kann, ganz politisch und ganz aktuell.
Paul Josef Kardinal Cordes, Besiege das Böse mit dem Guten. Grenzen der Psychologie und die Kraft des Glaubens. Sankt Ulrich Verlag Augsburg 2009, 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main