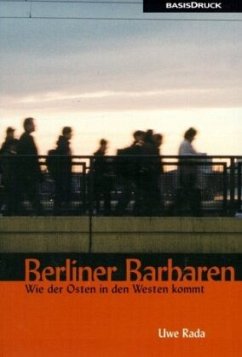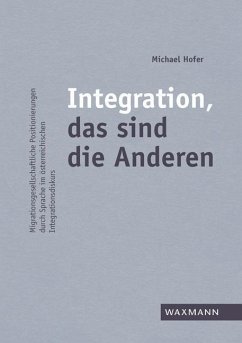Die Osterweiterung der Europäischen Union steht vor der Tür, bis zur polnischen Grenze sind es keine achtzig Kilometer. Doch in Berlin blickt man NOCH IMMER Richtung Westen. Dabei kann man es überall hören und sehen: Die Osteuropäisierung steht in vollem Gange. Aber anstatt die Chancen einer Grenzstadt zum Osten zu begreifen, zieht man in Berlin lieber neue Grenzen. Schon ist von der Häßlichkeit des Ostens die Rede und von der »Zivilisation«, die es gegen den Ansturm der »neuen Barbaren« zu verteidigen gelte. Aus der Frontstadt Berlin ist die Frontier Town geworden.Doch wer, fragt Uwe Rada in diesem Buch, ist hier eigentlich barbarisch? Die, die den Westen beim Wort nehmen? Oder die, die aus dem Osten nichts als einen Angriff auf ihre »zivilen« Errungenschaften erwarten? Fragen, die angesichts eines wieder in die Diskussion gekommenen »Kampfes der Kulturen« aktueller sind denn je.

Gen Osten: Uwe Rada beschreibt verpaßte Hauptstadtchancen
Das "Stadtforum", jene zum Plauderstündchen erodierte Diskussionsveranstaltung von Senators Gnaden, trifft sich in diesem Herbst nicht ein oder zwei, sondern gleich drei Mal, um über Berlin und den "Osten" zu verhandeln. "Osten" bezeichnet dabei, etwa so wie "11. September", einen Sachverhalt, der sich genauer Klassifizierung entzieht: Im "Osten" ist alles anders. Gewisse Diskursgrundlagen aber ließen sich mit dem humanistischen Bildungsmarschgepäck schaffen, denn bereits Tacitus hatte sich mit der terra incognita beschäftigt: "schmutzig, häßlich, roh und abstoßend" sind die Attribute, mit denen er germanische Stämme versieht; über deren einen, so weiß der antike Historiker zu berichten, munkelte man gar, daß sie "Antlitz und Mienen von Menschen, jedoch Rumpf und Glieder von Tieren haben." "Ich lasse das als unverbürgt auf sich beruhen" spricht Tacitus im letzten Satz und steigert damit nicht unbedingt die Reiselust der auf sich selbst gestellten Leser. Dennoch hat sich einer unter ihnen aufgemacht, ist in den "Osten" aufgebrochen, kam glücklich zurück, machte ein Buch daraus - und wird dafür nun vom Stadtforum ignoriert.
Uwe Radas Buch "Berliner Barbaren - Wie der Osten in den Westen kommt" handelt nicht nur von europäischen Grenzverschiebungen, sondern von den Verschiebungen der Wahrnehmung an sich. Unvoreingenommen und nüchtern sondiert er die Lage in Frankfurt an der Oder, durch das täglich Hunderte von Polen nach Berlin sickern, um sich abends wieder in die Heimat aufzumachen. Daß das Geschäft mit Handwerkern, Putzfrauen und Minidienstleistern auch jenseits von "Dussmann" floriert, ist längst kein Geheimnis mehr. Daher hat auch die Regierung reagiert und bei der Europäischen Union in Brüssel jenes vieldiskutierte, gleichwohl erniedrigende Abkommen erwirkt, das eine liberale Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Polen aufzuschieben sucht. Wie weit dadurch ein Teil der Erwerbswilligen in die Illegalität getrieben wird, läßt sich kaum absehen. Sicher aber werden die Pendler kaum auf ein anderes Land ausweichen. Ähnliche Beharrlichkeit zeigt sich auch etliche hundert Kilometer weiter in der polnischen Grenzstadt Przemysl, wo sich ein ähnliches Szenario wie in Frankfurt wiedertreffen läßt - nur daß die Polen diesmal im Westen sitzen und der Nachbar Weißrußland nicht einmal zu den Beitrittskandidaten des "freien" Europa zählt. So verschieben sich die europäischen Binnengrenzen weiter von Berlin weg, und die Stadt, die eine Reaktion bisher versäumt hat, droht endgültig aus dem Blickfeld zu geraten.
Im Osten Europas ist das nachpostmoderne Phantasiekonstrukt von der ultramobilen Gesellschaft längst Realität geworden. Wer nicht täglich kommt, der ist bereits fest installiert und versucht, auf diese Weise die drohende Sanktionierung der Geschäfte zu umgehen. Rada schildert die "Polen-Story" eindrücklich anhand von Erlebnissen und alltäglichen Erfahrungen; er entschlüsselt die Beobachtungen am Beispiel Berlins: Während von Polen aus das gelobte Land noch immer mit Wohlwollen gesehen wird, als Chance und Herausforderung gleichermaßen, schottet sich der Westen zunehmend ab.
Die für den Leser erstaunliche Konsequenz liegt in Radas Interpretation der Nachwendearchitektur deutlich vor Augen: Natursteinplatten, Blockrandbebauung, Traufhöhe, die bis zum Überdruß zitierten Parameter einer klaustrophobischen Baudoktrin, erscheinen plötzlich in einem neuen Licht und werden zu Chiffren der Angst. "Neuteutonia" hat sich architektonisch in sich selbst verkrochen, duckt sich vor den Realitäten einer turbokapitalistischen Welt - und verliert gerade damit die Chance, sich als offenherzige Drehscheibe nach Osteuropa zu etablieren.
Es mag bisweilen heikel erscheinen, von der phänomenologischen Ebene auf die psychologische Disposition zu schließen. In diesem Punkt aber, in der die Flucht vor der Realität unverblümt in eine Neuberliner Vergangenheitsseligkeit abrutscht, erscheint die Argumentation erschreckend plausibel. Daß Rada nicht den Weg der feuilletonistischen Philippika, sondern der ausgeglichenen, politisch neutralen Berichterstattung wählt, die ihren Gegenstand detailgenau von allen Seiten ins Visier nimmt, damit Erwartungshaltungen unterläuft und auf vordergründige Urteile verzichtet, macht die Erkenntnisse für den Leser um so erschreckender.
Während der Kommissar für die EU-Ost-Erweiterung, Günter Verheugen, in dieser Woche noch einmal dafür plädierte, die Chancen einer gesamteuropäischen Integration zu erkennen, fließt in der Hauptstadt die Zeit weiter ungenutzt ins Land. Verschämt resümierte das Stadtforum sein letztes Treffen in der Überschrift "Berlin ist eine Metropole in Mitteleuropa" - und schob schon in der Formulierung den nachhaltig tabuisierten Osten lieber wieder weg. Wie dieser aber auch jenseits aller lokalpolitischen Betroffenheiten längst seinen eigenen Weg nach Deutschland gefunden hat, davon weiß die Berliner Pflichtlektüre aus der Feder Uwe Radas Entscheidendes zu berichten.
CHRISTIAN WELZBACHER
Das Stadtforum trifft sich um 16 Uhr im Bärensaal des Stadthauses. Uwe Radas Buch "Berliner Barbaren - Wie der Osten in den Westen kommt" ist im Basisdruck-Verlag erschienen.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Märkte und Basare: Uwe Radas Streifzüge durch die deutsche Hauptstadt
Hauptstadt und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschland, Vorreiter der politischen Einheit des Landes, kultureller Schmelztiegel und, nicht zuletzt, Drehscheibe zwischen West- und Osteuropa – so präsentiert sich Berlin der Welt. Davon bleiben bei nüchterner Betrachtung die Hauptstadt und der Regierungssitz; der Rest ist mehr als fraglich. Die politische Landkarte Berlins zeigt Risse, die ziemlich genau entlang jener unsichtbar gewordenen Trennlinie verlaufen, die die Stadt vor 1989 sichtbar entzweite. Den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus seit 1990 lässt sich Wahlgang für Wahlgang, Wahlkreis für Wahlkreis entnehmen, wo die alte Wunde, die sich doch schnell schließen sollte, wieder aufbrach.
Die kulturelle Landkarte Berlins spiegelt die politische, ohne ganz deckungsgleich mit ihr zu sein. Man kann im Osten der Stadt wohnen und leben wie im Westen; man kann umgekehrt im Westen in dem Gefühl leben, dem Verfall des Ostens von vor 1989 ausgeliefert zu sein. Die stärkere Durchmischung im Zentrum oder in manchen Quartieren in Prenzlauer Berg und Friedrichshain, in Einheits-Erfolgsbilanzen gebührend herausgestrichen, schlägt in Lichtenberg, Hellersdorf und Marzahn als Verdrängung mit homogenisierender Wirkung zu Buche. Hier ist der Osten noch oder vielmehr wieder ganz bei sich. Überhaupt scheinen die östlichen Bezirke Ostberlins in den letzten Jahren kontinuierlich östlicher, die westlichen Bezirke Westberlins in ihrem komplementären Selbstbehauptungswillen westlicher geworden zu sein.
Dass Ost- und Westberliner schon längst nicht mehr auf rastloser Erkundungsreise in den je anderen Teil der Stadt sind, gehört einerseits ins Bild dieser reflexiven Lagerbildung, andererseits aber auch zur Berliner Normalität. Die polyzentrische Stadt mit ihren vielen Kietzen bindet die Einwohner stärker an ihre unmittelbare Umgebung als Städte, die auf ein einziges Zentrum ausgerichtet sind. Für einen Prenzlauer Berger besteht ohne dringlichen Reisegrund ebenso wenig Veranlassung, in den Wedding wie nach Pankow zu fahren.
Die liebenswerte, aber wirklichkeitsfremde Stadtidee vom „kulturellen Schmelztiegel” zerstob in lauter Fragmentierungen; das Projekt der „europäischen Drehscheibe” erwies sich als Phantasma mit unverkennbarem Hang zur Übertreibung. Es mag genügen, an den Kolhoff-Plan für den Berliner Alexanderplatz aus dem Jahr 1993 zu erinnern; an die dreizehn 150 Meter hohen Türme, umgeben von dichten Blöcken und durchzogen von Schluchten, die die Passanten ans Gängelband der konsumtiven Stadtbegehung nahmen – „Manhattan in Berlin” und zugleich explizite Kampfansage an den vermeintlich leeren Raum, an die „asiatische Steppe”, die die Ostberliner vier Jahre zuvor ganz intuitiv zum Schauplatz ihrer größten politischen Demonstration auserkoren hatten. Eine derart massive und ungeschlachte Bekundung des Volkswillens schien den neuen Verhältnissen offenbar nicht gemäß und sollte sich daher so bald auch nicht wiederholen lassen. Spuren löschen, Bewegungsspielräume einengen, hieß die stadtbildnerische Devise dieser „Urbanisten”, die bald darauf auch den Lustgarten, den zweiten prominenten Versammlungsort aus Wendezeiten, umgestaltete und demnächst wohl auch den Schlossplatz endgültig befrieden wird.
Vom erklärten Willen abgesehen, der ostdeutschen Moderne (wo sie sich nicht gänzlich beseitigen ließ) Zügel anzulegen, bestach der Kolhoff-Plan durch Ignoranz. Er „übersah”, dass das Projekt ein paar hundert Kilometer weiter östlich, in Warschau, bereits einen Standort gefunden hatte:„Wie Perlen an einer Kette reihen sich die Hochhäuser entlang der Aleja Solidarnosci und der Aleja Jerozolimskie. Auf der Marzalkowska herrscht an manchen Tagen eine Geschäftigkeit wie in Downtown New York. Mit der provinziellen Beschaulichkeit des ‚Neuen Berlin‘ ist das Geschäftszentrum von Warschau nicht zu vergleichen. Hier haben die wirklichen Global Players der internationalen Wirtschaft ihre Headquarters errichtet, hier werden Büromieten von nahezu siebzig Mark pro Quadratmeter erzielt. In Warschau bauen amerikanische und britische Banken, am Moritzplatz baut eine Warschauer Aktiengesellschaft das ‚Polnische Zentrum‘. Kein Zweifel: Schon vor der Osterweiterung der europäischen Union ist Warschau, die polnische Hauptstadt, jene Ost-West-Drehscheibe, die die deutsche Hauptstadt Berlin so gerne geworden wäre.”
Das Zitat entstammt dem jüngsten Buch des taz-Redakteurs und Publizisten Uwe Rada – ein in hohem Maße notwendiges Buch. Es bezieht die zumeist illusionären Selbstbilder Berlins auf die Realitäten, misst und korrigiert sie an jenen Bildern, die man sich jenseits der Ostgrenze der Bundesrepublik von Deutschland und von seiner Metropole macht.
Die Differenz von eigener und fremder Sicht beginnt schon mit der Wahrnehmung der Grenze selbst. Für die meisten Deutschen – noch – Bollwerk gegen den Osten des Kontinents, nehmen die dort Lebenden sie als einen prinzipiell offenen, persönlich verschieb- und durchdringbaren Limes wahr. Verschiedene Interessen, verschiedene Distanzen: „Während die achtzig Kilometer, die Berlin von der deutsch-polnischen Grenze entfernt liegt, aus der Warte des Hackeschen Marktes oder des Kollwitzplatzes, dort also, wo sich Berlin ganz als westliche Metropole gibt, einer unüberbrückbaren Distanz gleichen, rückt Berlin auf polnischer Seite immer näher.” Und was für Polen gilt, gilt auch für Moskau, für das Baltikum oder für Kasachstan.
Kurze Wege, schneller Aufbruch: Die „Verostung” der Bundesrepublik, Gegenstand der Furcht seit Wendezeiten, hat längst stattgefunden, allerdings anders als gedacht. Weder haben die Ostdeutschen Westdeutschland „erobert” noch die Ostberliner Westberlin (hier gilt allenfalls das Umgekehrte); die eigentlichen Träger der Verostung waren und sind Osteuropäer. Viele von ihnen zog es, legal oder illegal, nach Berlin, und ein überproportionaler Teil von ihnen nahm seinen Wohnsitz in Ostberlin, dauerhaft oder zeitweise. So wurde der Ostteil der Stadt ganz entschieden östlicher.
Polen, Rußlanddeutsche in großer Zahl, aber auch Ukrainer, Bulgaren, Ungarn, Rumänen und Tschechen haben das Klima dort wie in der ganzen Stadt spürbar verändert. Rada führt den Leser auf Märkte und Basare, zu Autowäschern, zu Putz- und Malkolonnen, er geht mit Fliesenlegern und Stuckateuren aus dem fernen Osten Europas durch Berlin; er heftet sich an die Spuren von „Karol”, einem polnischen Wanderarbeiter, oder an die eines jungen Rumänen, der sich als Dieb durchs städtische Dickicht schlägt. Als wäre er mit einem Nachtsichtgerät ausgestattet, macht er die verschlungenen und manchmal auch geheimen Pfade sichtbar, auf denen sich die Zugereisten oder auf Zeit Zugewanderten durch Deutschlands Hauptstadt bewegen, die „osteuropäische Ökonomie des Provisoriums” im Schlepptau.
Wer Radas Buch gelesen hat, bekommt eine Ahnung von der politischen und kulturellen Geografie Berlins, von seiner tatsächlichen Lage. Nach offizieller Lesart die am weitesten östlich gelegene Metropole des Westens folgt sein informeller Rhythmus schon jetzt ganz anderen Regeln. Berlin ist die am meisten westlich gelegene Metropole des Ostens und ein Tummelplatz für so gut wie jede Spielart höchst provisorischer Wirtschafts- und Lebensformen.
WOLFGANG ENGLER
UWE RADA: Berliner Barbaren. Wie der Osten in den Westen kommt. Mit einem Fotoessay von Claudia C. Lorenz und einem Nachwort von Wolfgang Kil. BasisDruck, Berlin 2001. 245 Seiten, 38 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Berlinbücher nehmen Rezensenten gerne zum Anlass, sich gehörig über ihr Verhältnis zur Stadt auszulassen. Über das zu besprechende Buch erfährt man wenig. So auch bei Wolfgang Engler, der dem vorliegenden Band gerade mal drei Absätze widmet. Dabei bezeichnet Engler das Buch des taz-Redakteurs Rada als "in hohem Maße notwendig". Dem Rezensenten gefällt, dass der Autor Berlins "illusionäre Selbstbilder" mit der Realität vergleicht und dabei etwa feststellt, dass die deutsche Hauptstadt nicht die "Ost-West-Drehscheibe" sei, die es "gerne geworden wäre". Der Buchautor habe sich mit Polen, Ukrainern und anderen Osteuropäern auf den Weg durch Berlin gemacht, um die Stadt zu erkunden. Dabei erfährt der Leser viel über die "tatsächliche" geographische Lage Berlins, schreibt der Rezensent. Die "Verostung" der Stadt hat längst stattgefunden, so Engler; diese ging nicht, wie "zu Wendezeiten" befürchtet, von Ostdeutschen, sondern von Osteuropäern aus. Weitere Einzelheiten sind leider Mangelware.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH