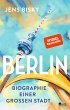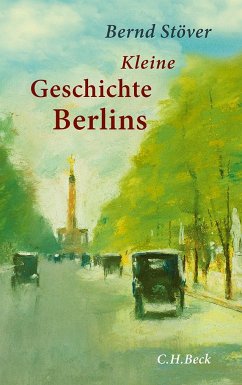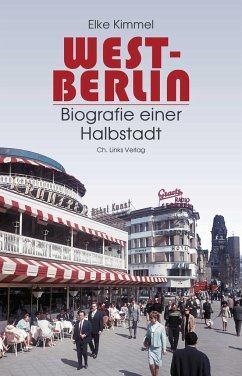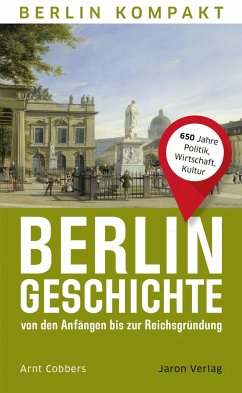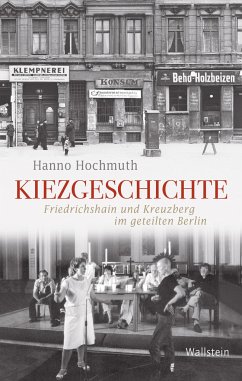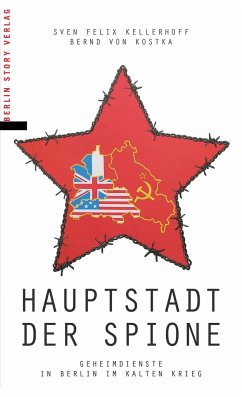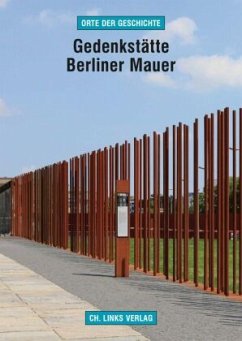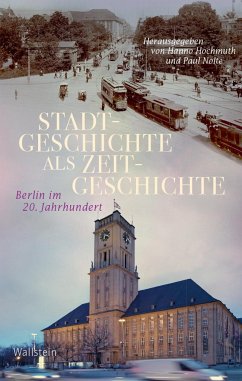Nicht lieferbar

Berlin
Biographie einer großen Stadt
Parvenü der Großstädte, Labor der Moderne, Symbol des zerrissenen 20. Jahrhunderts: In Berlin konzentriert sich nicht nur deutsche, sondern auch europäische Geschichte. Beides hat Jens Bisky im Blick, wenn er die Entwicklung der Stadt seit ihrem Aufstieg zur preußischen Residenz schildert. Berlin war äußerst wandlungsfähig und offen: für die verfolgten französischen Hugenotten und die Denker der Aufklärung unter Hohenzollernherrschaft; später als Metropole der Proletarier und Großindustriellen, der Künstler und Journalisten und als "Place to be" der Goldenen Zwanziger. All das wi...
Parvenü der Großstädte, Labor der Moderne, Symbol des zerrissenen 20. Jahrhunderts: In Berlin konzentriert sich nicht nur deutsche, sondern auch europäische Geschichte. Beides hat Jens Bisky im Blick, wenn er die Entwicklung der Stadt seit ihrem Aufstieg zur preußischen Residenz schildert. Berlin war äußerst wandlungsfähig und offen: für die verfolgten französischen Hugenotten und die Denker der Aufklärung unter Hohenzollernherrschaft; später als Metropole der Proletarier und Großindustriellen, der Künstler und Journalisten und als "Place to be" der Goldenen Zwanziger. All das wird bei Bisky anschaulich erfahrbar, genauso aber auch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und die spannungsgeladene Atmosphäre nach 1945, als sich hier die großen Machtblöcke gegenüberstehen.
Jens Bisky legt eine Gesamtdarstellung der Geschichte Berlins vor, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben hat, vom Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart. Eine faszinierende Erzählung über Entstehung und Aufstieg, Fall und Neubeginn - und zugleich ein packendes Panorama deutscher wie europäischer Geschichte im Spiegel einer einzigartigen Metropole.
Jens Bisky legt eine Gesamtdarstellung der Geschichte Berlins vor, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben hat, vom Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart. Eine faszinierende Erzählung über Entstehung und Aufstieg, Fall und Neubeginn - und zugleich ein packendes Panorama deutscher wie europäischer Geschichte im Spiegel einer einzigartigen Metropole.