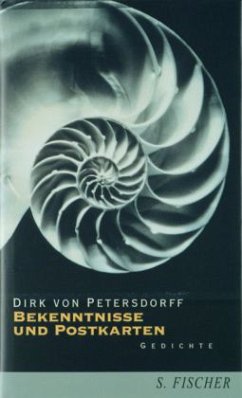In gegenwartssüchtiger Zeit widmet Dirk von Petersdorff seinen neuen Lyrikband den bodenlosen Abgründen, die in die Vergangenheit und Zukunft führen. In langen zwanzigseitigen Prosagedichten und in Emblemen oder Postkarten, die nur wenige Zeilen umfassen, spürt er dem Zusammenspiel von Beständigkeit und Vergänglichkeit nach.

Wulf Kirsten und Dirk von Petersdorff · Von Burkhard Müller
Ein jedes Ding, sagt Nietzsche, liebe sein Gleichnis, und so liebe der Deutsche die Wolke. Das war mit eindeutiger Parteinahme für die Form und nicht ohne Bosheit gesagt. Doch wenn die Formen ungewiß werden, gewinnt die Wolke in ihrer Riesenhaftigkeit und Deutlichkeit einerseits, in ihrer Bedeutungslosigkeit und Instabilität andererseits den Umriß eines perzeptiven Problems, einer Aufgabe, die nicht nur Liebe einflößt, sondern auch leiden macht.
Obwohl von Wolken in Wulf Kirstens Gedichtband "Wettersturz" nur wenig die Rede zu sein scheint, stellt schon der Titel die sächsisch-thüringische Landschaft, von der er fast ausschließlich handelt, ganz in ihr Zeichen: "wo sich der landrücken bäumt, windexponiert, über dem fluß, im wiesenwuchs gefleckte flanken aberzählig, breitgestirnt, wagenrad, kunstvoll gespeicht, hölzerne grundfigur, soll nicht, fährt aber doch, so ist es gewesen, über den kümmel, der wächst und streut sich langerhand unbekümmert aus ins schweifende gewell, zuhinterst gerippt und zugeschaufelt, voller tilken, feuchter gründel, augenfällig eingeschnitten, wo sich der schatten auf den schatten legt, falbig werden die wahrheiten" - gewaltsam muß man den Anfang des ersten, titelgebenden Gedichts abbrechen, denn selber kennt es keinen Einhalt, es zieht in solcher Überstürzung weiter wie ein wildbewegter Himmel, angetrieben von der Angst, es möchten die Gestalten, wenn sie nicht sogleich benannt werden, vorüber sein. Ein Landrücken, sollte man meinen, lädt zum Verweilen ein: der läuft einem nicht so schnell davon. Aber dieser Blick fühlt sich überfordert durch das überreiche Geschenk dessen, was ihm zufällt; und der Reichtum wandelt sich ihm in eine Sukzession von Momentaufnahmen.
Für Sätze, für Strophen oder Metren ist in diesem Sturm kein Atem da. Der Dichter mißtraut dem Verbum und seinem Vermögen, einem zeitlichen Verlauf nachzugehen, eine Gestalt nicht nur abzubilden, sondern herzustellen. Statt dessen regiert das Nomen: als Substantiv, als Adjektiv, besonders gern als Partizip, jene Schwundform des Verbums, die zwar dessen Ausdruck trägt, aber alle Handlungskraft eingebüßt hat. Dem Nomen wird die Last der Darstellung aufgebürdet; und damit es sich, wie es soll, in das beunruhigende Vielerlei schmiegen kann, muß es sich zum Absonderlichen bequemen. Man frage nicht, was "tilken" seien, was "gründel", was man sich unter einem "zerschrammten geschwende" oder einer "gestalkerten zone" vorzustellen habe. Die Benennung kippt ins Unverständliche, ins Namenlose des Konsonantenverhaus.
"Eine Welt voll weitergetragener Namen und Begriffe. Wie sollte ich in meiner Einfältigkeit ahnen, welchen Wert diese Wortfelder einmal bekommen würden, daß daraus Gedichte hervorgehen würden?" Aber sind es Gedichte, die daraus hervorgehen? Wörter machen kein Gedicht, sowenig wie Ziegelsteine eine Architektur; Wörter gehören allen, selbst die seltenen und altertümlichen, und sind für alle gleich. Wörter, Nomina sind es bei Kirsten, die beanspruchen, das, was sie meinen, mit Namen zu rufen, daß es aufhorcht und stillsteht. Das ist jedoch unvereinbar mit den rasenden und von Kommas zerrissenen Zeilen: als hingen von diesen jagenden Wolken schwere Anker herunter, die sich im Gestrüpp des Bodens verfangen. Kirstens Texte, heißt das, finden ihr Tempo nicht.
Es handelt sich hier nicht um die Nettigkeiten der Naturlyrik - obwohl für Wulf Kirsten die Formel gilt, daß der Grad der Schwermut sich direkt proportional zur Anzahl der namentlich genannten Pflanzengattungen verhält (Eichendorff kennt fast keine außer Rosen und Linden). Die Frage lautet vielmehr: Wie kann Welt adäquat wahrgenommen werden? Es ist eine Frage, die zu ihrer Voraussetzung die Erfahrung der Fotografie hat, den Schnappschuß: Wahllos in die Welt hineingehalten und aus der Zeit herausgeschnitten, liefert die Kamera ein Übermaß an Einzelheiten; der Schuhsohle eines Gehenden, die mit ins Bild gerät, widmet sie so viel Geduld wie seinem Gesicht.
Ein Narr knipst mehr, als sieben Weise mit ihren Blicken deuten können. Es steckt darin eine bestürzende Gleichberechtigung alles Sichtbaren. Sie ist in Kirstens Landschaft eingegangen und verleiht ihr das Unfeste und Bestimmte. Die Landschaft ist das ihm naheliegende, das entgegenkommende Exempel: Denn selbst im postagrarischen und postindustriellen Mitteleuropa nehmen die unbebauten Flächen, Acker und Wald, unverändert fast neunzig Prozent des Bodens ein - wer sie nicht wahrhaben will, leidet am Tunnelblick. Und die veränderten Wirtschaftsformen des zwanzigsten Jahrhunderts haben in zwei rasch aufeinanderfolgenden Schüben die gleichsam fotografische Destrukturierung dieses riesenhaften Raumes bewirkt: die Flurbereinigung, die das Gelände ausgeräumt hat, und das Bauernsterben der Gegenwart, dank dem das flache Land, noch vor vierzig Jahren ein eigenständiger Lebens- und Wirtschaftsraum, in eine Gottverlassenheit versinkt wie seit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs nicht mehr.
Und im Osten ging alles noch schneller vor sich als im Westen: "gesträuch schießt aus dem schutt am gängelband / der natur, selbsttätig sinkt in sich zusammen / ein wüstgefallner weiler, zugemessen dem höhenzug / und der abendröte ausgeschmolzenem licht, / zipfelgemeinde, alle deine hirten weidet der wind." Das ist eine Klage, auf die Kirsten mit einer Litanei alter landwirtschaftlicher Nutzbegriffe aus seiner Kindheit reagiert, mit Kumtstock, Krell und Kreuzhacke, die, da die Dinge gemacht sind, als Wörter wie gezeichnet wirken. Doch liegt die Verherrlichung der mühevollen Subsistenzwirtschaft Kirsten fern, er weiß genau, was die Plackerei für die "armen feldteufel" bedeutet hat. Was ihn interessiert, ist der trümmerhaft residuale Zustand, in dem die alte Agrikultur die Welt zurückgelassen hat.
Als Motto des Bandes wählt er einen Satz von Novalis: "die natur ist nichts als lauter vergangenheit." Es enthält die Herausforderung, wie von diesem großen, nunmehr leeren Bereich zu sprechen wäre, wenn nicht mehr menschliche Zwecke und Techniken ihren orientierungsspendenden Blick darauf gerichtet halten: Denn das Wüstfallen hat die Ausführlichkeit seiner Körnung nicht verringert, eher noch gleicht es die Verödung der riesigen LPG-Rübenpläne zu einer kleinteiligeren Vielfalt aus, "schüttboden / mondverfleckt und grundverdorben". "Stimmenschotter" heißt der eine von Kirstens zwei vorherigen Bänden im Ammann Verlag, "Textur" der andere. Die Welt ist beides, Schutt und Textur, wirr und aufs langmütigste durchkalligraphiert, und dem stellt sich Kirstens Lyrik.
Wolkig auf andere Weise ist der Band des 1966 geborenen Dirk von Petersdorff. "Jetzt sind die Wolken verstreut, eine Straße löst sich auf, die Gebirge schichten sich empor und fließen, Berge und Täler und Nichts - was man so denkt, beim Zuseln und Nachsehn der Wolken, schleppend, bis dann" - nichts mehr dann, das war es schon; das Denken läßt es bei dieser Geste bewenden, und die "Postkarte" an den "Liebsten Ordinarius" bricht ab. "Bekenntnisse" ist der erste und wichtigste Teil des Buchs, der Titel ist Augustinus entwendet. Damit hat sich Petersdorff vergriffen, und beim Lesen verstummt der Ärger darüber, selbst wenn der Autor einen provoziert, weil er Blüten streut wie: "Zurück in die Immanenz. Was fühlt meine Generation? Ich will euch ein Bild geben, damit ihr versteht." Denn wo er Sätze zum besten gibt wie "So war mein Herz, das nichts begründen konnte. Kontingenz, sagen die Philosophen", da fühlt man die Entbehrung, mit der ein Schlüsselkind der Postmoderne geschlagen ist, das die Sprache der Bibel und des Kirchenvaters trägt wie eine Sonnenbrille - und daß es trotz allem recht hat (wenngleich der Ton in die Travestie kippt), auf seinem "Herz" zu bestehen, jenem seismographischen Organ der ratlosen Erregung: Das ist eine Gewißheit.
Herr, ich danke dir, daß ich nicht in den Achtzigern sozialisiert wurde! mag man ausrufen, wenn man von den formativen Erlebnissen in Petersdorffs Jugend liest, von dem Eindruck, den ihm die Talking Heads und ihr Hit "Stop Making Sense!" gemacht haben. Das ist grausam und selbstgerecht. Doch das Vergnügen an Äußerungen nach dem Muster von "Mein Essen aß ich während der Werbeblöcke, das bekam mir nicht" oder "Typisch sage ich. Wie auch Heraklit sagt:" - kann nicht ewig währen. Wenn Petersdorff schreibt: "Bis zu diesem Punkt ist hinreichend deutlich geworden, daß mir sowohl das Fundament fehlt als auch der Überbau", so muß man ihm vorhalten, daß er über die Wahrheit dieses Satzes, über dieses buchstäbliche Nichts (ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt, sagt Lichtenberg) nicht tief genug erschrocken ist. "Was wollt ihr von mir Künstlerbiographie / Bildungsroman / Verwerfungen / Widerstand? Trauerarbeit oder was?" Das ist eine verkehrte Frage; sie geht davon aus, daß von ihm eine Äußerung erwartet würde und ihre Berechtigung in sich trüge.
"Gedichte" nennt Petersdorff diese Sammlung aus Bruchstücken einer Konfusion, Postkarten und einem Urlaubsbericht, um jeder Nachfrage enthoben zu sein. Aber das geht eben nicht mehr, wo der Lifestyle sich des tatsächlichen, des zeilengebrochenen, des strophigen und gereimten Gedichts vermißt. Vielleicht gibt dies eine brauchbare Definition von Lyrik ab: Sie darf kurz sein, weil sie darauf verzichtet, mildernde Umstände geltend zu machen.
Heute und morgen: "Die Nachrichtenfrau spricht vom Wetter, und das legt vorm Fenster gleich los: Im Morgengrau treiben die Blätter, die Macht in den Wolken ist groß. Und das gilt für heute und morgen, die Wege der Wolken sind schnell; die Zukunft ist leider verborgen - sagt die Nixe von RTL." Wie das gelingt und aufgeht und nicht einmal, wie bei Friederike Kempner, der charmante Rest des Unfreiwilligen bleibt. Einen traurigeren Fall von Entropie kann man sich schwerlich ausdenken als diese abschnurrenden Kreuzreime und Daktylen, als diesen glattstirnigen Verrat der Tradition an das Wetter.
Wulf Kirsten: "Wettersturz". Gedichte 1993-1998. Ammann Verlag, Zürich 1999. 88 S., geb., 29,80 DM.
Dirk von Petersdorff: "Bekenntnisse und Postkarten". Gedichte. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1999. 96 S., geb., 29,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main