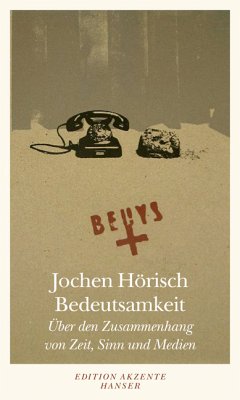Menschen suchen hinter den Dingen, die sie umgeben, und den Ereignissen, in die sie verstrickt sind, eine Bedeutung. Die Fähigkeit, Sinn und Bedeutung zu erschließen, steht am Anfang jeder Kultur. Jochen Hörischs große Studie über den Zusammenhang von Zeitlichkeit und Bedeutsamkeit handelt von den Ursprüngen und fundamentalen Voraussetzungen unserer kulturellen Existenz. Indem er Fragen der Philosophie mit der Interpretation großer Kunst und einer Analyse moderner Medien verbindet, legt der Literatur- und Medienwissenschaftler mit diesem Buch eine Grundlagenarbeit für die Geisteswissenschaften vor.

Der Germanist Jochen Hörisch über „Bedeutsamkeit”
Hätten wir unendlich viel Zeit, nichts würde dringlich für uns. Keine Sache könnte in dem Sinn Bedeutung annehmen, dass sie hier und jetzt sein müsste, getan werden müsste, ergriffen werden müsste – es wäre ja allemal noch Zeit für sie, unendlich viel Zeit. Dass verstandene Endlichkeit kein Mangel ist, der die Welt sinnlos macht, da ohnehin morgen alles vorbei ist, sondern eine positive Qualität, die erst begreiflich macht, weshalb einem Menschen die eine Sache viel bedeutet, die zweite wenig und die dritte nichts, hat wohl als erster der Philosoph Ludwig Feuerbach erkannt und in seinen Vorlesungen über „Das Wesen der Religion” (1845) ausgesprochen. Es ist auch der erste Gedanke von Jochen Hörischs Buch „Bedeutsamkeit”, auf dessen 400 Seiten Feuerbach nirgends vorkommt.
„Über den Zusammenhang von Zeit, Sinn und Medien” heißt das Buch des Mannheimer Germanisten im Untertitel. Diese drei Worte geben ungefähr die Reihenfolge an, in der Hörisch vorrückt. Erstens der Feuerbachsche Gedanke: Bedeutsamkeit ist keine zeitlose Qualität; sie entsteht erst und nur für endliche Wesen. Zweitens: Bedeutsamkeit, Bedeutung, Sinn sind nicht schlicht gegeben oder offenbar, sonst wären sich alle über sie einig. Kulturen unterscheiden sich danach, was sie jeweils, wie Hörisch formuliert, „zum Paradigma von Sinn-Erfahrungen erheben, die einen gewissen Anspruch auf intersubjektive Verbindlichkeit stellen”; und diesen Anspruch teils nuancierend, teils ihm widersprechend, geben Individuen innerhalb von Kulturen ihrerseits die unterschiedlichsten Deutungen der Welt. Es gibt in ihr nicht einfach Bedeutsamkeit, Bedeutung, Sinn im Singular, sondern nur Deutungen im Plural.
Was hält den Laden zusammen?
Was aber hält dann den Laden zusammen? Was vermittelt als ein Drittes zwischen dem, was auseinanderliegt? Damit sind wir in der Argumentation von Hörischs Buch bei Drittens: „ontosemiologische Leitmedien” – so nennt sie der Autor – „wie das Abendmahl, das Geld oder die neuen elektronischen Medien” sind diese Vermittler. Damit sie das sein können, dürfen sie sich keinem von außen kommenden Inhalt unterwerfen. Und so wiederholt Hörisch den Refrain, den die Theoretiker seit 45 Jahren im Chor singen: „Das Medium ist die Botschaft”. Weil das nicht anders sein kann, muss es auch gut so sein, oder jedenfalls nicht ganz schlecht, schließt Hörisch auf der letzten Seite seines Textes: „(Leit-)Medien sind besser als ihr Ruf.” Mit dieser Argumentation, in drei Schritten von Heidegger zu McLuhan, sind aber die beträchtlichen Stärken von Hörischs Buch nicht einmal berührt. Und sie verdienen es, von seiner Schwäche abgehoben zu werden.
Buy one, get two: „Bedeutsamkeit” ist zwei Bücher, von Hörisch gleichsam ineinandergeschoben. Da ist zum einen ein – wie der Autor es nennt – „fundamentalsemiologischer” Traktat, zum anderen aber ein interpretierender und pointierender Essay zur Literatur, Kunst und Kultur der europäischen Neuzeit. Das schwerfällige erste dieser beiden Bücher macht dem zweiten das Leben schwer, aber das brillante zweite schüttelt sich oft genug frei, wahres Lesevergnügen zu gewähren. Zuweilen muss sich Hörisch selbst zur Ordnung rufen, das zweite Buch, das zu verfassen ihm sicher mehr Spaß gemacht hat, zu unterbrechen, um an dem ersten weiterzubasteln.
Zu Buch Nummer 1: Es gibt Fundamentalisten und Fundamentologen (näher spezialisiert in Fundamentaltheologen, Fundamentalontologen, Fundamentalsemiologen u. a.). Gegen Fundamentalisten hat Hörisch nach wie vor etwas. Aber er ist diesmal unter die Fundamentologen gegangen. Die „fundamentalsemiologische Frage” Hörischs lautet, was überhaupt „Koppelungen von Sein und Sinn schalten und halbwegs verbindlich machen” könne. Wenn es so etwas gibt wie „Sinn” und „Bedeutung” – und es gibt in der Tat so etwas –, dann, meint der Autor, muss es ja auch eine Sphäre geben, die „Sinn” und „Bedeutung” allererst möglich macht: die „Bedeutsamkeit”. Dieser Gedanke ist in Hörischs Werk sofort da, und er entwickelt sich durch es hindurch überhaupt nicht. Er wird nur sehr oft wiederholt.
Was Philosophieren auszeichnet, dass nämlich ein Gedanke Einwänden ausgesetzt wird und sich unter Kritik verändert, substituiert Hörisch durch ein starres Behaupten, ausgestattet mit Etiketten der Transzendentalphilosophie: „Bedeutsamkeit ist die Möglichkeitsbedingung von Sinn”. Etwas „spezifisch Unscharfes”, schreibt er, „ist bedeutsam, etwas Bestimmtes hat hingegen eine Bedeutung”. Aber woraus ergibt sich hier der Unterschied zwischen Sein und Haben? Er ergibt sich nicht aus dem Unterschied zwischen Bedeutsamkeit und Bedeutung. Vielmehr verdankt er sich einzig dem Griff in der Formulierung, die Bedeutsamkeit als Adjektiv einzuführen, welches ein „ist” fordert, die Bedeutung hingegen als Nomen, das zum Akkusativobjekt mit „haben” werden muss.
Indes gibt es in Hörischs Buch ein Leben jenseits der Onto- und Fundamentalsemiologie. Dieses Leben, zu dem auch der Tod gehört, die Liebe, das Hören und das Sehen, das Reden und das Schweigen, bringt Hörisch in eine selber sehr lebendige kulturhistorische Erzählung: Buch Nr. 2. Diese Erzählung schweift ab, und man schweift gerne mit ihr ab. Sie erinnert den Leser an bekannte, gelesene Bücher und macht ihn mit wenig oder nur dem Namen nach geläufigen bekannt. In Hörischs Buch steckt eine sehr persönliche, in ihren Konstellationen originelle Anthologie, deren heller Kommentator überraschende Ähnlichkeiten und Unterschiede ins Licht rückt. Wie nebenbei ist „Bedeutsamkeit” eines der schönsten Goethebücher der letzten Jahre, eloquent und elegant. Wem dies nicht auffiel, den weist Hörisch in den letzten Worten des Buches darauf hin; denn er überlässt sie Goethe: „Wie? Wann? und Wo? – Die Götter bleiben stumm! / Du halte dich an’s Weil, und frage nicht: Warum?” Ob Hörisch bemerkt hat, dass dies auch ein Wort gegen Fundamentologie ist? ANDREAS DORSCHEL
JOCHEN HÖRISCH: Bedeutsamkeit. Über den Zusammenhang von Zeit, Sinn und Medien. Carl Hanser Verlag, München 2009. 416 Seiten, 24,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Für Stefana Sabin hat der Autor hier eine schriftstellerische Höchstleistung vollbracht. So trivial ihr Jochen Hörischs These von der Zeitlichkeit als Voraussetzung für Sinn, von Kunst und Kultur als Sublimationen unserer Todesbewusstheit auch vorkommt, so angetan ist die Rezensentin von der Genauigkeit und dem Elan, mit denen Hörisch den Leser auf seine Seite zieht. Deutungen, Anspielungen, Hinweise ergeben für Sabin ein "Riesenpanorama" sämtlicher künstlerischer Gattungen im Hinblick auf den Tod und seine Verwandlung in Sinn. Bedauernswert findet Sabin nur, dass Hörisch mitunter rhetorisch übers Ziel hinausschießt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH