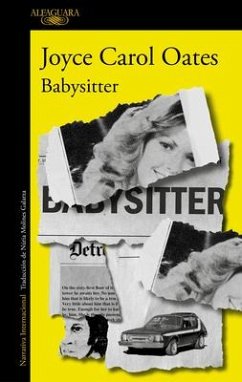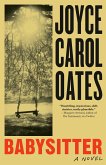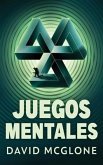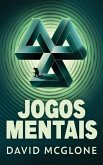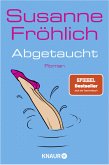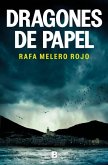Produktdetails
- Verlag: ALFAGUARA
- Seitenzahl: 504
- Erscheinungstermin: 21. Februar 2023
- Spanisch
- Abmessung: 238mm x 152mm x 38mm
- Gewicht: 748g
- ISBN-13: 9788420463087
- ISBN-10: 8420463086
- Artikelnr.: 65953140

Nach der Vergewaltigung führen alle Wege ins Nichts:
Joyce Carol Oates’ Me-Too-Krimi „Der Babysitter“.
Joyce Carol Oates’ Roman „Babysitter“ beginnt in einem Aufzug, aber nicht irgendeinem. Die Szene spielt im März 1977, gerade eben ist in Detroit das Renaissance Center eröffnet worden, eine Gruppe verbundener Riesentürme, und Hannah rauscht in der gläsernen Kabine in den 61. Stock des damals höchsten Hotels der Welt. Es ist ein bisschen schwierig, über Joyce Carol Oates Grundsätzliches zu sagen, weil sie – sie ist inzwischen 85 Jahre alt – so wahnsinnig viele Romane und Erzählungen geschrieben hat. Aber in Detroit und in der Nähe hat sie Jahre verbracht, von denen sie selbst sagt, sie haben sie geprägt; in Detroit kennt Oates sich aus.
Den Ort des Geschehens hat sie mit Bedacht gewählt. Die frisch eröffneten Türme waren das Symbol des Trotzes, den Niedergang der Stadt nach den Rassenunruhen von 1967 zu verhindern; sie wurden später das Sinnbild dafür, dass das nicht geklappt hat. Detroit als Autostadt und Bollwerk des amerikanischen Traums brach zusammen. Wo einst Wohlstand herrschte, stehen heute alte Villen leer.
Das bildet den Hintergrund für die Geschichte von Hannah, der Frau im Aufzug – teure Stöckelschuhe, Seidenbluse, eine reiche Dame aus den Vororten, die nur nach Detroit hineinfährt, wenn sie glaubt, sich in diesen Türmen, die sich abschotten gegen das feindliche Fußvolk, sicher fühlen zu können. Sie ist auf dem Weg zu einem Mann, den sie kaum kennt, für ein heimliches Rendezvous, von dem sonst niemand weiß. Sie hat ihn auf einer Wohltätigkeitsgala kennengelernt, immer wieder kehrt sie in Gedanken zu dem Augenblick zurück, als er ihren Arm packte: endlich nimmt sie jemand wahr. Hannah steht kurz vor ihrem 40. Geburtstag, und heute klingt 39 jung, aber nicht 1977.
„Babysitter“ ist eine Mischung aus Frauenporträt, Krimi und Horror, und manchmal wahrscheinlich eine Geistergeschichte. Was Hannah in dem Zimmer erlebt, ist eine fürchterlich und explizit beschriebene Vergewaltigung. Aber sie wird den Mann, den sie dort trifft, trotzdem ihren Geliebten nennen und versuchen, umzudeuten, was ihr widerfahren ist. „Babysitter“ rührt an diverse Schrecken, Pädophilie, Serienmord an Kindern, Rassismus, aber im Kern folgt der Roman Hannah, in ihren Gedanken und Ängsten und Erinnerungen. Warum ist sie überhaupt dort hingegangen? Sie klammert sich daran, als Frau anerkannt zu werden, weil es in ihrem Leben nur das gibt: Ehefrau von, Mutter von. Auf der Wohltätigkeitsgala wurde sie als neue Leiterin eines Kunstvereins vorgestellt, und die Beschreibung des Abends ist qualvoll, wie sie sich selbst nicht eingestehen will, dass sie unbedingt die Anerkennung haben will, die ihr keiner zollt.
Joyce Carol Oates ist eine gute Beobachterin von Orten und Menschen, aber an Hannah versucht sie auch, eine Art Me-Too-Figur zu schaffen – eine Figur mit Brüchen, die doch nichts damit zu tun haben dürfen, was geschieht, eine Frau, die sich in Gefahr begibt, die sie hätte erahnen können, wiederkommt, leugnet, in Gedanken ungeheuer lang braucht, bis sie sich über das Erlebte im Klaren ist – und nichts davon gibt dem Fremdem im Hotelzimmer irgendein Recht über sie. Dieser Cocktail aus Angst und Trotz und Begehrtwerdenmüssen, um gegen ihre eigene Unsichtbarkeit zu kämpfen, ergibt ein wirklich interessantes Psychogramm.
Gerade weil Hannah so eine wunderbar schwierige Identifikationsfigur bleibt. Sie leidet darunter, dass ihr Mann sie nicht mehr liebt – sie liebt ihn aber auch nicht. Sie wird zulassen, dass ein unschuldiger Verdächtiger von der Polizei erschossen wird. Sie schaut selten über den Rand ihrer wohlhabenden Vorstandswelt hinaus, und dann meist mit Argwohn, sie verschanzt sich hinter Statussymbolen – denn sie hat keinerlei Selbstwertgefühl. Und genau deswegen beginnt man, sie zu verstehen und mit ihr mitzufühlen. Und zu fürchten. Oates wechselt immer wieder in die Perspektive der Kinder, die ein „Babysitter“ genannter Serienmörder in Michigan umgebracht hat in den Monaten, bevor Hannah im März 1977 in das Hotel geht. Hannah hat davon gehört, die Geschichten in der Zeitung befeuern ihre Ängste. Ihre Kinder sind noch zu klein, beruhigt sie sich, die wird es nicht erwischen – ihr Ehemann steigert sich derweil in die Fantasie eines drohenden Angriffs der schwarzen Bürger von Detroit hinein.
Es gibt doch etwas Grundsätzliches, was man über Joyce Carol Oates sagen kann: Sie spinnt gern Geschichten aus realen Ereignissen, wie in ihrem Marilyn-Monroe-Roman „Blond“ oder in „Schwarzes Wasser“, der auf den Unfall des Senators Edward Kennedy auf einer Brücke auf der Insel Chappaquiddick anspielt, bei dem er nach einer Party 1969 seine Begleiterin zurückließ und sie im Autowrack starb. Auch den Serienmörder hat es gegeben, im Frühjahr 1977 ermordete er Kinder im Oakland County in Michigan, das bei Oates Oklahoma County heißt, und die Zeitungen nannten ihn „Babysitter“, weil er die Kinder tagelang bei sich behielt. Der echte Babysitter wurde jahrelang gesucht, aber nie gefunden – die Figuren, denen Hannah begegnet und die mit dem Fall zu tun haben, das Spinnennetz des Bösen, das sich durch den Roman zieht, sind fiktiv. Was nicht bedeutet, dass nicht etwas Wahrhaftiges darin steckt.
„Schwarzes Wasser“ ist die Halluzination einer Ertrinkenden, und bei „Babysitter“ kann man sich auch nie ganz sicher sein, woran man ist: Wenn Hannahs Gedanken in die Zukunft weisen, liest sich das, als würde Oates unterschiedliche Varianten ausprobieren, wie es für sie noch weitergehen kann nach dem Vorfall im Hotelzimmer. Depression und Wiederauferstehung, entdeckt werden, wehren, verschwinden, all das wird sie in Zukunft ausprobieren – aber man weiß bei Oates nie, ob es diese Zukunft auch gibt.
Auf jeden Fall ist „Babysitter“ das, was man im Englischen einen page-turner nennt, die Sorte Buch, die sich, einmal angefangen, nur noch schwer aus der Hand legen lässt. Vielleicht, weil der Roman auch ein richtig gut geschriebener Krimi ist, und weil Joyce Carol Oates das Milieu und die Orte und die Figuren so ungeheuer plastisch beschreibt. Vor allem aber entwickelt „Babysitter“ wohl einen solchen Sog aus der Hoffnung nach Auflösung und Erlösung. Die kann es für Hannah nicht geben. Jeder Weg hinaus aus diesem Hotelzimmer führt, auf unterschiedliche Arten, ins Nirgendwo.
SUSAN VAHABZADEH
Der echte „Babysitter“-
Mörder wurde lange
gesucht, aber nie gefunden
Joyce Carol Oates:
Babysitter. Roman.
Aus dem Englischen
von Silvia Morawetz.
Ecco Verlag,
München 2024.
624 Seiten, 24 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

In "Babysitter" erzählt Joyce Carol Oates die Geschichte einer freiwilligen Unterwerfung
Joyce Carol Oates äußerte einmal in einer Dokumentation über ihr Lebenswerk, dass ihre Romanfiguren von Gefühlen geleitet werden, die ihnen selbst ein Rätsel bleiben. Oates' Interesse an der verborgenen Motivlage menschlicher Handlungen speist sich wohl aus schlichter Lebenserfahrung: Im Moment einer Entscheidung kann ein undurchsichtiges Gefühl die Motivation für eine Handlung sein, das keine Antwort auf die Frage zulässt, warum man dies oder jenes getan hat. In arger Umdeutung Adornos könnte nach der Lektüre von Oates' Werken folgender Eindruck verbleiben: Wahr sind nur die Gefühle, die sich nicht verstehen lassen.
In Oates' neuem Roman "Babysitter", der zu Beginn der Siebzigerjahre in der Stadt Detroit spielt, kanalisiert sich diese unklare Handlungsmotivation in einer Schlüsselszene: Hannah Jarret, Mutter zweier Kinder und Ehefrau, steht vor der Entscheidung nach einer Spendengala entweder nach Hause zu ihrer Familie zu fahren oder sich in ein Hotelzimmer zu einem Mann zu begeben, den sie bisher nur einmal gesehen hat, und sich mit ihm auf eine Affäre einzulassen. "Ein Uhr, dann 13:15 Uhr: Erstaunlich, dass Hannah (noch) zu keinem Entschluss gekommen ist. Die vor Aufregung feuchtkalten Hände zittern, so ängstlich und nervös ist sie. Wird sie von der Zufahrt zum Marriott nach links (in Richtung Auffahrt auf die Interstate an der Marple Road) oder wird sie wie das brave kleine Frauchen gleich nach rechts abbiegen (und nach Far Hills zurückfahren)."
Y.K. nennt sich der Fremde, den sie bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt hat. Hannah entscheidet sich dafür, zu ihm zu fahren. Eine fatale Entscheidung, denn sie wird vergewaltigt. In expliziter Darstellung lässt Oates keinen Zweifel daran, dass es sich um keinen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr handeln kann. Die Verbalisierung von sexueller Gewalt durch Oates ist unangenehm zu lesen, verfällt aber nicht in einen Voyeurismus, denn die konkreten Schilderungen unterstehen einem Zweck: die defizitäre Urteilsfähigkeit der Protagonistin offenbar werden zu lassen. Denn Hannah Jarret ist nach dem Übergriff, der nicht der einzige bleiben soll, zwar körperlich lädiert, aber in Hochstimmung, hat sie, ihrer Meinung nach, doch endlich einen Geliebten, der unbegrenztes, liebevolles Interesse an ihr zeige. In der Folge entfaltet sich ein tragisches und intensives Geschehen, in dem das Innenleben von Oates' Romancharakter durch eine Schicht an chronischen Schuldgefühlen und Minderwertigkeitskomplexen schonungslos an die Oberfläche gebracht wird.
Das geschilderte Umfeld bietet dabei einen gelungenen Hintergrund, vor dem sich Hannahs Selbstunterwerfung entwickelt. Als Tochter eines reichen und angesehenen Familienpatriarchen aufgewachsen und mit einem wohlhabenden Mann verheiratet, über dessen Geschäfte Hannah nichts weiß, verfolgt sie in Far Hills, einem Wohnort mit großen, isoliert stehenden Anwesen, nur ein einziges Ziel: das amerikanische Familienbild einer erfolgreichen Oberschicht zu repräsentieren.
Ein Gefühl der Selbstwirksamkeit will sich in einem solchen Leben nicht einstellen, sind doch Schlüsselaufgaben zum Erhalt der Familie in andere Hände gegeben. Die geldbringende Arbeit übernimmt ihr Ehemann Wes und die Erziehung der Kinder die philippinische Hausangestellte Ismelda. Da bleibt nur die Organisation der traditionsreichen Spendengalas für ehrenamtliche Zwecke, die Hannah kurzlebige Momente des Triumphes bescheren.
Detroit ist noch dazu ein raues Pflaster, nachdem Unruhen 1967 zu vielen Todesfällen geführt und die Angst vor einem sogenannten Rassenkrieg bei der weißen Oberschicht genährt haben. Dazu kommt eine Serie an Kindermorden von einem Täter, der in der Presse nur "Babysitter" genannt wird. Die Babysittermorde sind wahren Kindesentführungen eines Serienkillers in Detroit nachempfunden. Der gesamte Roman kann als eine historische Betrachtung einer gehobenen, amerikanischen Gesellschaftsschicht zu Beginn der Siebzigerjahre gelesen werden. Joyce Carol Oates lebte selbst lange Zeit in Detroit und ließ hier einige ihrer berühmtesten Geschichten vor dem Hintergrund tatsächlicher, historischer Ereignisse stattfinden.
In gewisser Weise tragen die MeToo-Debatten der letzten Jahre dazu bei, dass dieser Roman einen so überwältigenden Eindruck auf den Leser macht. MeToo hat nicht nur der Schauspielwelt den Glamour geraubt, sondern auch den Wohlfühlort des Luxushotelzimmers in einen Tatort verwandelt. Oates nutzt diese Assoziation, um ihrer Erzählung den Schrecken realer Ereignisse zu verleihen. Hinzu kommt die Frage um die Ursache von Selbstunterwerfung in Zwangsverhältnisse, die häufig mit juristischen Schuldzuweisungen und moralischen Überzeugungen diskutiert wird. Oates zeigt, dass Literatur solche menschlichen, rätselhaft erscheinenden Handlungen plausibel zu sezieren vermag. Denn sie weiß ihrer Figur die nötige Tiefe zu geben, jeden Schritt ihrer Gedanken dem Leser preiszugeben und so ein Psychogramm von einer Frau zu erstellen, die es nicht schafft, sich von Abhängigkeiten zu lösen, sondern diese explizit sucht.
Wie eine im Spinnennetz gefangene Beute gerät ihre Protagonistin mit jedem Widerwillen nur noch fester in die Gefangenschaft ihres Peinigers. Entstanden ist ein packendes, herausragendes Buch. HENDRIK BUCHHOLZ
Joyce Carol Oates: "Babysitter". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz. Ecco Verlag, Hamburg 2024. 512 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main