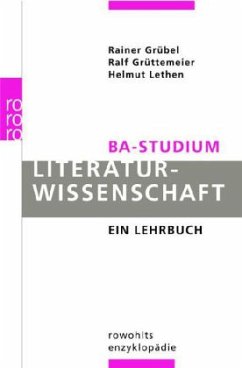Das Lehrbuch "Literaturwissenschaft" gliedert sich in drei Modulblöcken sowie einen Ausblick auf Theorien und Methoden des Masterstudiengangs. Es dient als Baustein für Lehrveranstaltungen und begleitet die Studierenden, auch mithilfe eines Glossars grundlegender Begriffe, von Merksätzen und Registern. Mit der neuen Studienstruktur ändern sich auch die Inhalte mit ihren Lehr- und Lernformen: Im Zentrum der Organisation in so genannten Modulen steht der Anspruch, Kompetenzen zu vermitteln, die in der Wissenschaft, aber auch außerhalb der Hochschule zur jeweiligen Problemlösung angewendet werden können. Dieses Studienbegleitbuch, das erste in seiner Art, greift die grundlegende Neustrukturierung auf und liefert dazu das Handwerkszeug.
Die neue Serie "BA-Studium" in rowohlts enzyklopädie reagiert auf eine unaufhaltsame Reform, indem sie Studierenden einen Kanon des zu erwerbenden Wissens vermittelt und Lehrenden ein Angebot für ihre Veranstaltungen liefert.
Die neue Serie "BA-Studium" in rowohlts enzyklopädie reagiert auf eine unaufhaltsame Reform, indem sie Studierenden einen Kanon des zu erwerbenden Wissens vermittelt und Lehrenden ein Angebot für ihre Veranstaltungen liefert.

Eine entspannte Einführung in die Literaturwissenschaft
Früher war in deutschen Hörsälen alles besser: da saßen begabte und belesene Studenten, die mit Feuereifer glanzvollen, von einer Phalanx von diensteifrigen Assistenten begleiteten Gelehrten lauschten und dabei unanfechtbar erfuhren, worin "das spezifische Sein der Literatur" besteht. Bei der Abschlußprüfung verfügte ein jeder über gründliche Kenntnisse der philologischen Untersuchungsmittel und der Edition, über eine umfassende literaturgeschichtliche Bildung und verstand sich auf die "Kunst der Interpretation". Früher war alles schlechter: unnahbare und weltfremde Kathederfürsten unterdrückten ihre Mitarbeiter, vermittelten den Studenten einen für die gesellschaftliche Praxis unbrauchbaren, "bürgerlich-idealistischen Kanon" und verpaßten ihnen so eine "herrschaftskonforme Ideologie".
In jedem Fall hätte die Propädeutik der Literaturwissenschaft damals kein Problem sein dürfen. Beim Wiederlesen von Karl Otto Conradys 1966 in rowohlts enzyklopädie erschienener Einführung erfährt man es anders. Gleich zu Beginn spricht Conrady sorgenvoll von der Literaturwissenschaft als einem "Massenfach", in dem eine "auf die Fähigkeiten und Neigungen des einzelnen zugeschnittene Lenkung und Unterweisung so gut wie unmöglich geworden" ist. Er spricht von der "Hilflosigkeit der Studierenden" wie der Universität selbst. Insbesondere sorgt er sich um die Qualität der Lehre und die Motivation der Studierenden und fordert zu strenger Selbstprüfung auf, und er denkt auch über Abhilfe nach, "die straffe Lenkung mit der Freiheit des Lernens paart".
Der vergleichsweise entspannte Ton, in dem drei heutige Professoren an gleicher Stelle für ihr Fach werben (darunter ein ehedem namhafter Kritiker der "Ordinarienuniversität"), scheint zu zeigen, daß die Massenuniversität trotz stetig gestiegener Zahlen von Studienanfängern wie -abbrechern, trotz notorischer Klagen, trotz Unterpersonalisierung und auch trotz neuerlicher Reformwut Normalität geworden ist. So beginnt die Einführung mit einer frohgemuten Setzung: "Wer Literaturwissenschaft studieren will, fühlt sich von Literatur angezogen und will mehr darüber wissen, wie sie funktioniert." In solcher Allgemeinheit galt das schon für Conrady nicht, heute ist es vollends ein frommer Wunsch. Gerade sehr engagierte Lehrende beklagen bei mindestens der Hälfte der Studierenden der Literaturwissenschaft beziehungsweise der Germanistik eine diffuse oder sachfremde und oft eskapistische Motivation.
Grübel, Grüttemeier und Lethen sehen dagegen die Hauptschwierigkeit in der inzwischen unwiderruflichen pluralistischen Verfassung der Literaturwissenschaft. So erwarteten die vorhandenen Einführungen von den Studierenden, daß diese "die Tugend des fröhlichen Relativismus" erlernen, was aber die "Orientierungsnot" in dieser "zerklüfteten Landschaft" nur vergrößere. Die soll nun zumindest abgemildert werden, indem die verschiedenen Ansätze an Beispielen und Fällen aus der Forschungspraxis erläutert werden.
Hier hat der Band in der Tat seine Verdienste. Mit einer angesichts der aktuellen Gegenstandsdiskussion erstaunlichen Selbstverständlichkeit wird die Literatur beziehungsweise der literarische Text ins Zentrum eines Kommunikationsmodells gestellt, um sodann die "Produktion" (Autor und Poetologie), die "Rezeption" (Leser, Kritik) und "Kontext und System" (Verstehen und Bezeichnen, Diskursanalyse und Intertextualität, Literaturgeschichte und -soziologie, Empirie) abzuhandeln. Dies geschieht anschaulich und in einer im ganzen vertretbaren Vereinfachung.
Mit den inneruniversitären und den gesellschaftlichen Belastungen des literaturwissenschaftlichen Studiums gehen die Autoren gelassen pragmatisch um. Auch im Eskapismus sehen sie keinen Schaden und betonen die Chancen im Verlust. Die verminderte Bedeutung der Literatur sorge für Entlastung und damit für die Entfaltung von Möglichkeiten der Reflexion jenseits gesellschaftlicher Normen und Ansprüche. "Wenn Literatur ihre Schlüsselstellung für Orientierung und Selbstreflexion einbüßt, wenn ihre Bedeutsamkeit in der aktuellen Kommunikation schwächer wird, könnte sich die Literaturwissenschaft mit der wichtigen Aufgabe trösten, das kulturelle Gedächtnis zu inventarisieren und auszuloten." Entsprechend klingen die Ausführungen über das Verhältnis von "Beruf und Studium" am Ende gelegentlich so, als sollten gebildete Nachtwächter herangezogen werden.
Lockere Anschaulichkeit und weitgehender Verzicht auf Bildungsprunk und Wichtigtuerei sind aber zweifellos Qualitäten dieser neuartigen Einführung. So scheint heute alles besser als früher: die Professoren sind locker und zuversichtlich, daß "das intellektuelle Vergnügen eines literaturwissenschaftlichen Studiums in die Möglichkeit einmündet, mit den erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten weiterarbeiten zu können".
Auf jene Studienanfänger, und das sind nicht wenige, die von einem literaturwissenschaftlichen Studium nach dem Motto "Lesen kann ich ja" die Leichtigkeit des akademischen Seins erwarten, könnte sich diese Lockerheit freilich kontraproduktiv auswirken. Deutliche Warnungen vor der Mühsal methodischer Arbeit im Massenfach und auch vor gesellschaftlich bedingter Enttäuschung werden allzu entspannt entschärft. So ergibt sich zuletzt nur eine Verschiebung jener Paradoxie, der keine Einführung ganz entgeht: Auch diese Orientierung wird vor allem denjenigen nützlich sein, die sich über ihre Motivation und Eignung schon ernsthafte oder gar sorgenvolle Gedanken gemacht haben.
FRIEDMAR APEL
Rainer Grübel, Ralf Grüttemeier, Helmut Lethen: "Orientierung Literaturwissenschaft". Was sie kann, was sie will. Rowohlts Enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2001. 224 S., br., 9,50
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main