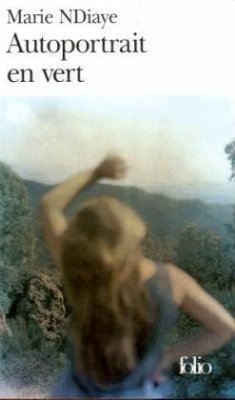L'auteure se pose des questions dans ce livre en forme d'autoportrait qui à la manière d'un tableau joue avec les couleurs et les motifs pour raconter l'étrangeté d'un regard, le sien. Un regard qui l'a rendue écrivaine, qui lui a donné la force d'être à la fois attentive aux moindres variations d'un visage, d'un paysage et d'être indifférente, presque absente.

mit Hexenbesen
Marie NDiayes abgründiges
„Selbstporträt in Grün“
Grün gilt als Farbe der Hoffnung und der Fruchtbarkeit – beides verkörpert von den Kindern. In Marie NDiayes abgründiger Erzählung „Selbstporträt in Grün“ ist das anders: Hier schmückt „die Bosheit sich besonders gern mit allen möglichen Grüntönen“, ist es die Farbe Grün, die Ehen zerrüttet und Frauen vor Fruchtbarkeit „schützt“, als sei das Lebendige ein Fluch. Zu Beginn der Erzählung ist der Fluss, an dessen Ufern die Ich-Erzählerin mit ihrem Mann und den Kindern lebt, gefährlich „angeschwollen“ und droht, über die Ufer zu treten. Die Garonne, im Gegensatz zu anderen Flüssen kein Vater, sondern „vom Wesen her weiblich“ und möglicherweise die Urmutter all der Frauen in Grün, die der Frau im Buch begegnen, ist gleichsam schwanger, „prall“, wie es heißt, und wenn sie unheilvoll niederkommt, die Deiche brechen und die Wassermassen alles überfluten, dann wird die große Lebensader zum Totenfluss.
Noch aber halten die Dämme, noch hat auch die Erzählerin ihr Baby nicht zur Welt gebracht – am Ende wird sie Mutter von fünf Kindern sein, und es ist wesentlich für das Buch, dass sie während der diskontinuierlichen Handlung, die sich über mehrere Jahre erstreckt, fast durchgehend schwanger ist. Diese Schwangerschaften sind hier mit der Erfahrung von Selbstentfremdung verbunden, einer bis ins Halluzinatorische übersteigerten Wahrnehmung von Unwägbarkeiten und Paradoxien, einem Leiden unter dem unerlösten Widerspruch zwischen der Unhintergehbarkeit von Familie, Abstammung und Herkunft und dem gleichzeitigen Erleben, wie kündbar diese Bindungen sind. All das ruft höchst ambivalente Gefühle bei der Frau hervor, Sehnsucht ebenso wie Angst und Abscheu. Im Laufe der Zeit trifft sie lauter Menschen, die ihr einmal nahe standen und die – anders als sie, die ganz ungebrochen mit dem Nestbau für die größer werdende und sich damit verfestigende Familie beschäftigt ist – ihrem Leben eine abrupte Wendung gegeben haben: Da ist die Freundin, die nie Kinder hatte, plötzlich aber ihr Herz ausschüttet darüber, wie überfordert sie mit der Erziehung sei. Da gibt es eine andere Freundin, die jetzt mit ihrer einstigen Jugendliebe zusammen ist, nachdem dessen Frau sich im Keller erhängt hat. Und da wartet eine Untote im Schatten einer Bananenstaude, um die Erzählerin wie ein Dämon zu verfolgen. Letztlich erscheinen all diese Frauen mit ihren mäandernden Biographien, ob real oder nur Wahngebilde, metamorphotische Inkarnationen des Archetypus der hexenhaften Frau in Grün zu sein, deren Urbild eine sadistische Erzieherin in der Vorschule war. Auch die eigene Familie bleibt von der schleichenden Verunsicherung nicht ausgenommen: die Mutter, deren Postkarte die Frau im Garten vergräbt und die mit den zwei drogenabhängigen Schwestern in einer Sozialwohnung haust, der Vater, der die beste Freundin zu seiner Frau und Schwiegermutter der Erzählerin gemacht hat – ein Stammvater unzähliger Kinder, die er zwar in die Welt gesetzt, aber dort allein gelassen hat, eine nomadisierende Genschleuder.
Die in Berlin lebende Marie NDiaye, Tochter eines Senegalesen und einer Französin, ist eine Meisterin des subtilen Horrors, des leisen Schreckens und der verflimmernden Gewissheiten. „Selbstporträt in Grün“ erschien im französischen Original bereits 2005 in einer Buchreihe mit literarischen Selbstporträts, auf Deutsch hat es der Kritiker Denis Scheck in der von ihm betreuten Reihe Arche Paradies herausgegeben. Marie NDiaye hat sich dem Genre einer planen Autobiographie raffiniert entzogen. Ihr scheinbar kunstloses Büchlein, dessen Wortmagie so klar ist wie die Kristallkugel einer Wahrsagerin, hat Claudia Kalscheuer kongenial in ein durchtriebenes Deutsch übertragen, das elegant ins Ohr geht – man merkt gar nicht, dass einem da Gift eingeträufelt wird. Ohne falsche Verdunkelung umspielt diese kleine Phantasmagorie die Abgründe von Familie und Identität. Das Selbstbildnis, das dabei entsteht, lässt hinter den Konturen eine andere Realität durchschimmern. NDiayes Verfahren gleicht den antiquarischen Fotografien, die dem Band beigegeben sind. Wie die dort nur unscharf abgelichteten Menschen sich in die Landschaft zu verströmen scheinen, wodurch ihnen etwas Geisterhaftes anhaftet, gibt es auch in NDiayes Erzählen eine Osmose zwischen Realistik und Phantastik. Die Figuration verflüssigt sich und mündet ins Delta einer Genealogie, die wie Wasser zwischen den Fingern zerrinnt.
CHRISTOPHER SCHMIDT
MARIE NDIAYE: Selbstporträt in Grün. Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer. Arche Literatur Verlag, Zürich/Hamburg 2011. 128 S., 18 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Ich träume mir mein Wesen: Die Schriftstellerin Marie NDiaye sollte ein Selbstporträt schreiben, doch dann überlegte sie es sich anders - und zeichnete das Bild ihrer selbst als eine Mischung aus Vermutungen, Erinnerungen, Verfälschungen und Projektionen.
Es ist ein witziges Spiel, das die in Berlin lebende französische Erfolgsautorin Marie NDiaye mit dem eigenen Spiegelbild treibt. Das im Titel ihres neuen Buches annoncierte "Selbstporträt" fungiert als Deklaration, die allerdings von den ersten Seiten an unterlaufen wird. Damit packt sie das vordergründige Leserinteresse am Schopf, um es sofort zu düpieren. Wer möchte denn nicht, angetrieben von banaler Neugierde, erst einmal ein paar Zusatzinformationen erfahren über eine geheimnisvolle Schriftstellerin, die Marie NDiaye ohne Zweifel ist?
Die vierundvierzig Jahre alte Autorin, als Tochter einer französischen Lehrerin und eines Senegalesen in Frankreich aufgewachsen, lebt seit 2007 mit ihrem Mann und den drei Kindern in Berlin. Ihre Heimat, die ihr vor zwei Jahren für den kämpferischen Roman "Drei starke Frauen" mit dem Prix Goncourt die renommierteste französische Literaturauszeichnung verlieh, verließ sie im Zorn. Ihre Kritik an Sarkozys Immigrationspolitik, die sie als verabscheuenswürdig bezeichnete, provozierte einen heftigen Schlagabtausch unter französischen Intellektuellen und Politikern über die Redefreiheit preisgekrönter Künstler. Deutschland als neue Wahlheimat hat auch mit diesem lautstarken Protest an der Atmosphäre polizeilicher Überwachung zu tun, die Marie NDiaye in Frankreich wahrzunehmen glaubt - wobei es sich, kein Zweifel, um eine Heimat bis auf weiteres handelt. Denn das Setting des Ausbruchs, des Abschieds und des Neuanfangs an einem unbekannten Ort war schon immer zwingende Konstante ihres Schreibens. Sie braucht das vibrierend Fremde für die Inspiration, den Wechsel der Kulisse für die Einfälle. Amsterdam, Rom, Barcelona oder Guadeloupe sind Stationen ihres Lebens.
Wer sich nun allerdings genauere Details zum Autorinnenleben im neuen, in Frankreich bereits 2005 erschienenen Buch "Selbstporträt in Grün" erhofft, bewegt sich auf der falschen Fährte, auch wenn die Spielvorgabe ursprünglich sehr wohl autobiographisch war. "Autoportrait en vert" erschien im Pariser Verlag Mercure de France in der Reihe "Traits et Portraits", die Selbstdarstellungen von Cinéasten, Modeschöpfern, Lyrikern und Malern vorstellt. Marie NDiaye aber hat nicht journalistisches Enthüllen, sondern spielerisches Verhüllen im Sinn.
Sie stellt das ursprüngliche Konzept mutwillig auf den Kopf. Die vorgegebene Versuchsanlage dient ihr nur als Trampolin, um sich elastisch von der platten Selbstbespiegelung abzufedern. "Selbstporträt in Grün" ist ein trickreiches Vexierspiel mit den rätselhaften Facetten des eigenen Ich. Ein ständiges Gleiten, Schillern und Verwandeln geht durch dieses Buch und bestimmt den Erzählfluss. Denn die "Frauen in Grün" erscheinen unerwartet in immer neuer Form aus dem Textfluss. Bald ist es das gespenstische Bild einer Frau, die plötzlich neben dem Bananenstrauch steht; dann die Erinnerung an eine rigide Person aus der Kindheit: eine eckige, grobe Frau in langen Karoröcken, Rollkragenpullovern, mit grünen Augen; dann wieder erscheint eine Figur in grünen Shorts und Sandalen - eine quicklebendige, reizende Person, welche die Erzählerin für ihre Freundin Christina hält. Frauen in Grün zeigen sich mit unterschiedlichen Masken und Kostümen. Plötzlich tauchen sie wie mirakulöse Schemen aus dem Nichts auf - und versinken sogleich wieder im undurchdringlichen Nebel der Erinnerung. Festhalten kann man sie nicht, beschreiben nur bedingt, abschließend definieren schon gar nicht. Es sind halb reale, halb geträumte Wesen, die aber immer in einer Beziehung zur Erzählerin stehen.
Zu diesem Konzept der Fragmentierung des Ichs passt die keineswegs einer logischen Chronologie unterworfene Erzählanlage. Marie NDiaye klebt Fetzen von Ereignissen aus der Vergangenheit bruchlos aneinander. Ihr Selbstporträt kennt keine Kapiteleinteilungen. Neue Abschnitte sind häufig mehr oder weniger willkürlich mit Daten zwischen den Jahren 2000 und 2003 versehen - wieder ein deutliches Signal, dass es in diesem "Selbstporträt in Grün" keineswegs um die kohärente Abbildung der Wirklichkeit geht. Vielmehr hebt die Autorin in scheinbar zufälligem Rhythmus versunkene Bewusstseins- und Erlebnis-Seinschichten ans Licht. Ihre "autobiographische Figur" ist nicht greifbar, sondern eine Mischung aus Vermutung, Erinnerung, Verfälschung und Projektion. Nicht das eingerahmte, genau strukturierte Bild einer Frau will sie uns zeigen, sondern gebrochene Abbilder von "Frauen in Grün".
Dieses Ich ist nicht zu greifen und nicht zu fassen, sondern einem ununterbrochenen Wandel unterworfen. Es ist gleichzeitig fremd und vertraut, überraschend und alltäglich. Und so bekommt der Leser am Ende doch eine Form von Selbstporträt serviert. Marie NDiaye gelingt es mit der Strategie der Zersplitterung, gleichzeitig die Fassade der Frau in den Blick zu nehmen und hinter der vordergründigen Silhouette alle Schatten des Ichs anzudeuten, die ihm auch noch einbeschrieben sind.
PIA REINACHER
Marie NDiaye: "Selbstporträt in Grün". Roman.
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer. Arche Verlag, Hamburg 2011. 128 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main