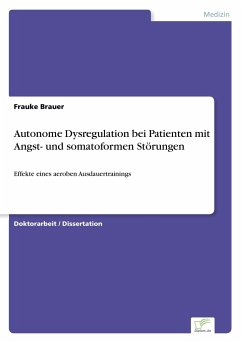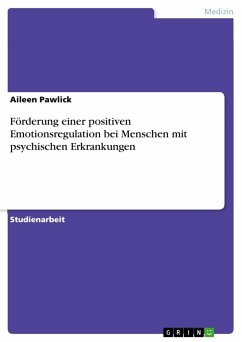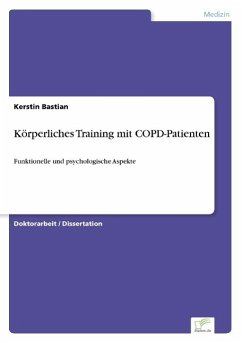Doktorarbeit / Dissertation aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Medizin - Chirurgie, Unfall-, Sportmedizin, Note: 1,0, Deutsche Sporthochschule Köln (Medizin- und Naturwissenschaften, Rehabilitation und Behindertensport), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Angst- und somatoforme Störungen stellen zwei klinisch problematische und besonders gefährdete Patientengruppen dar. Bei einem bedeutenden Anteil der Betroffenen liegen gestörte autonome Regulationsprozesse vor, die mit einer durch Schonverhalten verminderten körperlichen Leistungsfähigkeit sowie einer verzerrten Wahrnehmung und Interpretation körperlicher Sensationen, insbesondere kardiovaskulärer Symptome, verbunden sind. Da regelmäßiges Ausdauertraining bei gesunden Probanden die autonome Regulation zu verbessern scheint, stellt sich die Frage, ob eine autonome Dysregulation bei Patienten mit einer Angst- oder somatoformen Störung durch ein moderates, aerobes Ausdauertraining normalisiert und eine Verbesserung der psychischen Befindlichkeit und des Rehabilitationserfolges bewirkt werden kann. In der vorliegenden Studie wurde diese Fragestellung an Patienten mit einer Angst- und Patienten mit einer somatoformen Störung in einer Psychosomatischen Fachklinik untersucht.
Die zentralen Indices kardiovaskulärer autonomer Regulation Herzratenvariabilität und Baroreflexsensitivität wurden unter Ruhe und Belastung (Reaktionstest) frequenzanalytisch bestimmt, und die Stress-Reaktivität aus der Differenz berechnet. Die körperliche Leistungsfähigkeit wurde in einer fahrradergometrischen Belastungsuntersuchung nach dem WHO-Schema bestimmt. Psychometrische Parameter wurden mit der Symptom Checklist, dem Fragebogen zum Gesundheitszustand und der Hospital Anxiety and Depression Scale erhoben. Das Aktivitätsverhalten wurde mit dem Freiburger Fragebogen zur körperlichen Aktivität erfragt. Alle Daten wurden zu Beginn der Rehabilitationsbehandlung, vier Wochen später und als Katamnese sechs Monate später erhoben. Zum zweiten Messzeitpunkt wurde der subjektiv eingeschätzte Rehabilitationserfolg mit dem Fragebogen zur Beurteilung der Rehabilitation erfragt.
An der Studie beteiligten sich 139 Patienten, 106 weiblich, durchschnittlich 43,8 Jahre alt, 167 cm groß und mit einem BMI von 24,1 kg/m². Die Patienten wurden getrennt nach Geschlecht und Störungsbild per Zufallslisten randomisiert der Experimental- bzw. Kontrollgruppe zugeteilt. Als Intervention wurde mit der Experimentalgruppe dreimal wöchentlich über vier Wochen ein 30minütiges aerobes Ausdauertraining durchgeführt. Die Trainingsintensität wurde anhand der ersten Ergometrie mit 70% der Leistung festgelegt, die der metabolischen Intensität von 4 mmol/l Blutlaktat entsprach. Die individuelle Trainingsherzfrequenz sollte mit Hilfe eines Herzfrequenzmessers während des Trainings konstant gehalten werden. Die Kontrollgruppe erhielt über die klinische Standardbehandlung hinaus keine zusätzliche Intervention.
Anhand des Medians der Baroreflexsensitivität in der ersten Ruhemessung wurde die Gruppe beim Cut-Off-Point von 6,819 ms/mmHg halbiert, so dass sich sowohl für die Experimental- als auch die Kontrollgruppe jeweils eine Gruppe mit unauffälliger autonomer Regulation und eine Gruppe mit autonomer Dysfunktion bildeten. Hinsichtlich der Kontrollvariablen gab es lediglich einen signifikanten Altersunterschied der Gruppen dysfunktional vs. normalreguliert, so dass das Alter als Kovariable bei der statistischen Auswertung berücksichtigt wurde.
Bei einer Drop out-Rate von 33% absolvierten 93 Patienten alle drei Untersuchungen. Die Patienten der Experimentalgruppe zeigten eine signifikant höhere Aktivitätssteigerung als die Kontrollgruppe zum zweiten und dritten Messzeitpunkt bezüglich ihrer gesamten körperlichen Aktivität (T2: H(1,93) = 12,42, p ,001; T3: H(1,93) = 14,73, p ,001) und ihrer sportlichen Aktivität (T2: H(1,93) = 17,04, p...
Angst- und somatoforme Störungen stellen zwei klinisch problematische und besonders gefährdete Patientengruppen dar. Bei einem bedeutenden Anteil der Betroffenen liegen gestörte autonome Regulationsprozesse vor, die mit einer durch Schonverhalten verminderten körperlichen Leistungsfähigkeit sowie einer verzerrten Wahrnehmung und Interpretation körperlicher Sensationen, insbesondere kardiovaskulärer Symptome, verbunden sind. Da regelmäßiges Ausdauertraining bei gesunden Probanden die autonome Regulation zu verbessern scheint, stellt sich die Frage, ob eine autonome Dysregulation bei Patienten mit einer Angst- oder somatoformen Störung durch ein moderates, aerobes Ausdauertraining normalisiert und eine Verbesserung der psychischen Befindlichkeit und des Rehabilitationserfolges bewirkt werden kann. In der vorliegenden Studie wurde diese Fragestellung an Patienten mit einer Angst- und Patienten mit einer somatoformen Störung in einer Psychosomatischen Fachklinik untersucht.
Die zentralen Indices kardiovaskulärer autonomer Regulation Herzratenvariabilität und Baroreflexsensitivität wurden unter Ruhe und Belastung (Reaktionstest) frequenzanalytisch bestimmt, und die Stress-Reaktivität aus der Differenz berechnet. Die körperliche Leistungsfähigkeit wurde in einer fahrradergometrischen Belastungsuntersuchung nach dem WHO-Schema bestimmt. Psychometrische Parameter wurden mit der Symptom Checklist, dem Fragebogen zum Gesundheitszustand und der Hospital Anxiety and Depression Scale erhoben. Das Aktivitätsverhalten wurde mit dem Freiburger Fragebogen zur körperlichen Aktivität erfragt. Alle Daten wurden zu Beginn der Rehabilitationsbehandlung, vier Wochen später und als Katamnese sechs Monate später erhoben. Zum zweiten Messzeitpunkt wurde der subjektiv eingeschätzte Rehabilitationserfolg mit dem Fragebogen zur Beurteilung der Rehabilitation erfragt.
An der Studie beteiligten sich 139 Patienten, 106 weiblich, durchschnittlich 43,8 Jahre alt, 167 cm groß und mit einem BMI von 24,1 kg/m². Die Patienten wurden getrennt nach Geschlecht und Störungsbild per Zufallslisten randomisiert der Experimental- bzw. Kontrollgruppe zugeteilt. Als Intervention wurde mit der Experimentalgruppe dreimal wöchentlich über vier Wochen ein 30minütiges aerobes Ausdauertraining durchgeführt. Die Trainingsintensität wurde anhand der ersten Ergometrie mit 70% der Leistung festgelegt, die der metabolischen Intensität von 4 mmol/l Blutlaktat entsprach. Die individuelle Trainingsherzfrequenz sollte mit Hilfe eines Herzfrequenzmessers während des Trainings konstant gehalten werden. Die Kontrollgruppe erhielt über die klinische Standardbehandlung hinaus keine zusätzliche Intervention.
Anhand des Medians der Baroreflexsensitivität in der ersten Ruhemessung wurde die Gruppe beim Cut-Off-Point von 6,819 ms/mmHg halbiert, so dass sich sowohl für die Experimental- als auch die Kontrollgruppe jeweils eine Gruppe mit unauffälliger autonomer Regulation und eine Gruppe mit autonomer Dysfunktion bildeten. Hinsichtlich der Kontrollvariablen gab es lediglich einen signifikanten Altersunterschied der Gruppen dysfunktional vs. normalreguliert, so dass das Alter als Kovariable bei der statistischen Auswertung berücksichtigt wurde.
Bei einer Drop out-Rate von 33% absolvierten 93 Patienten alle drei Untersuchungen. Die Patienten der Experimentalgruppe zeigten eine signifikant höhere Aktivitätssteigerung als die Kontrollgruppe zum zweiten und dritten Messzeitpunkt bezüglich ihrer gesamten körperlichen Aktivität (T2: H(1,93) = 12,42, p ,001; T3: H(1,93) = 14,73, p ,001) und ihrer sportlichen Aktivität (T2: H(1,93) = 17,04, p...