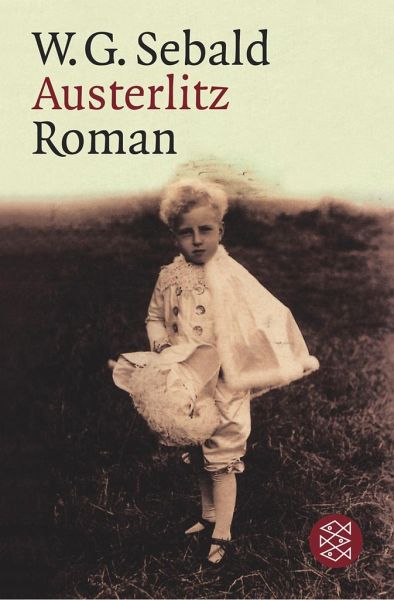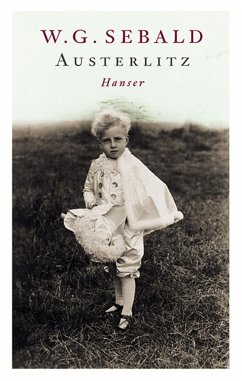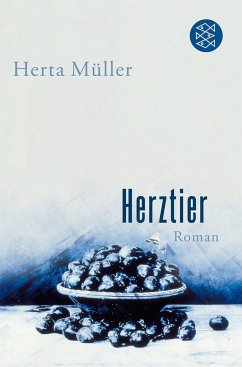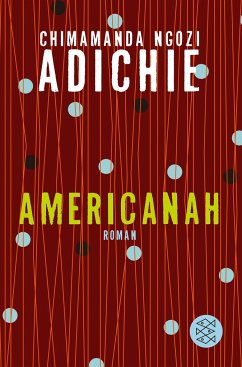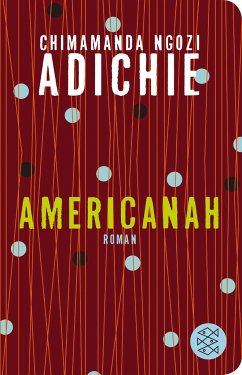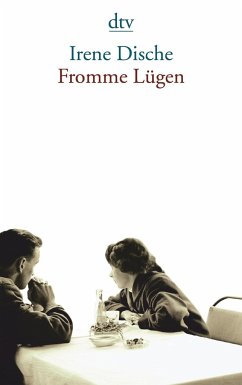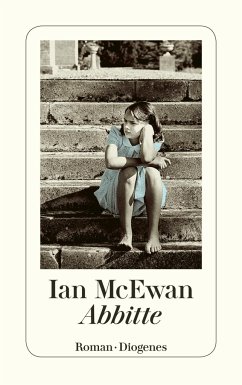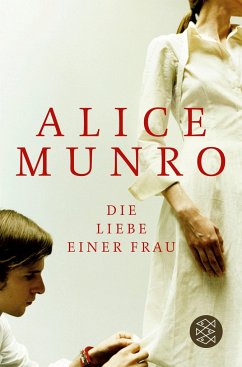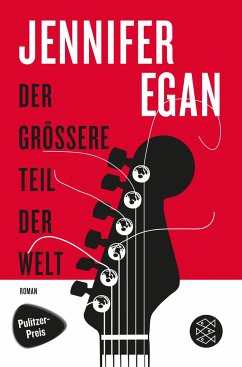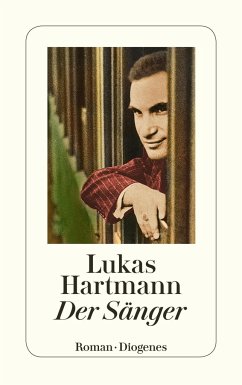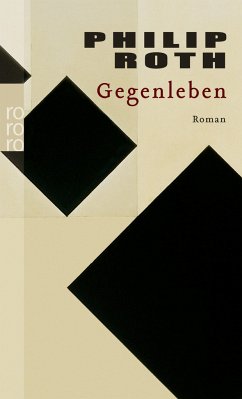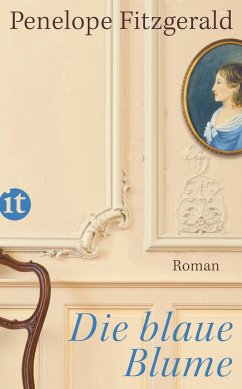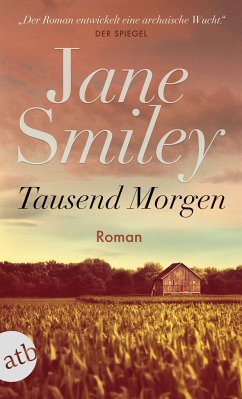Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Wer ist Austerlitz? Ein rätselhafter Fremder, der immer wieder an den ungewöhnlichsten Orten auftaucht: am Bahnhof, am Handschuhmarkt, im Industriequartier ... Und jedes Mal erzählt er ein Stück mehr von seiner Lebensgeschichte, der Geschichte eines unermüdlichen Wanderers durch unsere Kultur und Architektur und der Geschichte eines Mannes, dem als Kind Heimat, Sprache und Name geraubt wurden.
W. G. Sebald, geboren 1944 in Wertach im Allgäu, lebte seit 1970 im ostenglischen Norwich, wo er als Dozent für Neuere Deutsche Literatur an der Universität lehrte. Er starb 2001 bei einem Autounfall. Zu seinen Werken gehören die Prosabände ¿Schwindel. Gefühle¿, ¿Die Ringe des Saturn¿, ¿Die Ausgewanderten¿ und ¿Austerlitz¿ sowie der Nachlassband ¿Campo Santö; weiterhin die Essaybände ¿Logis in einem Landhaus¿ und ¿Luftkrieg und Literatur¿ sowie die beiden Bände zur österreichischen Literatur ¿Unheimliche Heimat¿ und ¿Die Beschreibung des Unglücks¿. Das lyrische Werk liegt vor in den beiden Bänden ¿Nach der Natur. Ein Elementargedicht¿ und ¿Über das Land und das Wasser¿. Zudem ist lieferbar der Interviewband ¿¿Auf ungeheuer dünnem Eis.¿ Gespräche 1971 bis 2001¿, herausgegeben von Torsten Hoffmann. W. G. Sebald wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Mörike-Preis, dem Heinrich-Böll-Preis und dem Joseph-Breitbach-Preis.
Produktdetails
- Fischer Taschenbücher 14864
- Verlag: Fischer (TB.), Frankfurt
- Artikelnr. des Verlages: 1006834
- 12. Aufl.
- Seitenzahl: 417
- Erscheinungstermin: 1. Januar 2003
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 121mm x 27mm
- Gewicht: 304g
- ISBN-13: 9783596148646
- ISBN-10: 3596148642
- Artikelnr.: 10643274
Herstellerkennzeichnung
FISCHER Taschenbuch
Hedderichstr. 114
60596 Frankfurt
produktsicherheit@fischerverlage.de
"Schon lange ist W.G. Sebalds Erzählkunst in der gegenwärtigen deutschen Literatur etwas Einzigartiges. In dieser beunruhigend formvollendeten Geschichte hat sie eine Art Vollkommenheit erreicht. Dass der Versuch gelingen könnte, Hebels Unverhofftes Wiedersehen, diese anderthalb Seiten makellose Prosa über die Wiederkehr der Toten und die Aufhebung der Zeit, in einem vierhundertseitigen Buch gleichsam neu zu erzählen: das wäre ein poetisches Wunder. Hier ist es geschehen." (Heinrich Detering, Literaturen, 3/4 2001)
"Man liest das Buch wie im Sog, gefesselt und fasziniert wie von einem jener bösen deutschen Märchen in denen man, wie es in den "Ausgewanderten" heißt, "einmal in Bann geschlagen, mit dem Erinnern fortfahren muss, bis einem das Herz bricht". (Andrea Köhler, Neue Zürcher Zeitung, 24./25.02.01)
"Man liest das Buch wie im Sog, gefesselt und fasziniert wie von einem jener bösen deutschen Märchen in denen man, wie es in den "Ausgewanderten" heißt, "einmal in Bann geschlagen, mit dem Erinnern fortfahren muss, bis einem das Herz bricht". (Andrea Köhler, Neue Zürcher Zeitung, 24./25.02.01)
Spurensuche
Er mochte seine Vornamen nicht, Winfried und Georg würden ihn an die Nazis erinnern, deshalb benutzte der 2001 verstorbene Schriftsteller lieber W. G. Sebald als Autorenname, so auch im Prosawerk «Austerlitz», das in seinem Todesjahr erschien. Ein Buch, das sich …
Mehr
Spurensuche
Er mochte seine Vornamen nicht, Winfried und Georg würden ihn an die Nazis erinnern, deshalb benutzte der 2001 verstorbene Schriftsteller lieber W. G. Sebald als Autorenname, so auch im Prosawerk «Austerlitz», das in seinem Todesjahr erschien. Ein Buch, das sich literarisch allen Zuordnungen entzieht, weder Roman ist noch Essay oder Biografie, aber auch keine Dokumentation, obwohl die vielen exakt an der richtigen Stelle in den Text eingefügten Fotos das suggerieren. In Deutschland erst Mitte der neunziger Jahre entdeckt, gelangte der Autor besonders im englischen Sprachraum schnell zu großer Popularität, die BBC wählte «Austerlitz» 2015 sogar unter die zwanzig bedeutendsten literarischen Werke des neuen Jahrhunderts.
Jaques Austerlitz heißt der Protagonist, den ein namenloser Ich-Erzähler in der Bahnhofshalle von Antwerpen kennenlernt, ein seltsam gekleideter junger Mann, der unentwegt beschäftigt ist mit Notizen, der auch immer wieder mit seiner Ensign Rollfilmkamera fotografiert. Der Zufall führt sie noch mehrmals zusammen, und Austerlitz beginnt, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Als kleiner Junge sei er Anfang der vierziger Jahre als jüdisches Flüchtlingskind nach Wales gekommen und dort von einem gestrengen Dorfprediger und seiner Frau großgezogen worden, freudlose Zieheltern, die seine einsame Kindheit zum Trauma werden lassen. Im Internat war er denn auch der Einzige, der sich nicht auf die Ferien freute, weil er dann zurück musste ins ungeliebte Pfarrhaus. Später hatte er dreißig Jahre als Kunsthistoriker in London gearbeitet und irrt, seit er seine wahre Herkunft erfahren hat und auch seinen richtigen Namen, entwurzelt und rastlos durch Europa auf der Suche nach seiner im Holocaust verschwundenen Familie, was ihn schließlich über Prag nach Theresienstadt führt.
Sebald kontrastiert seine rückwärts erzählte Geschichte bis hin zum Grauen des Kriegsbeginns und dem als letzte Rettung veranlassten «Kindertransport» ins sichere Ausland immer wieder mit den Schönheiten der Natur, vertieft sich in detaillierte Beschreibungen von Bahnhöfen, Hotelhallen, Justizpalästen oder Befestigungsanlagen, kritisiert aber auch vehement den architektonischen Wahnsinn der neuen «Bibliothèque nationale de France» in Paris. Am Einzelschicksal des Titelhelden spiegelt sich schemenhaft das historische Geschehen, verdeutlicht sich das Unfassbare an dem ganz individuellen Betroffensein. Bewundernswert klar hat der Autor die Persönlichkeitskrise seines Helden herausgearbeitet, die so weit geht, dass er irgendwann nicht mehr schreiben kann, später dann auch nicht mehr lesen, dass er von Schlaflosigkeit gepeinigt in Depression verfällt. Lebensfreude ist ihm fremd, die Bekanntschaft mit Marie, die sich rührend um ihn kümmert, führt ins Leere seinetwegen, er scheint zu jeder Art von Bindung unfähig.
Nun ist das nicht gerade eine neue Herangehensweise an ein ebenfalls nicht gerade neues Thema. Der fiktive Lebensbericht wird in Sebalds melancholischem Buch in einem dem 19ten Jahrhundert entstammenden Idiom entwickelt, das angenehm zu lesen ist, wortgewaltig, kunstvoll gebaut, gleichwohl aber auch recht aufgesetzt wirkend, ein überheblicher Gelehrtenton, der da angeschlagen wird. Äußerst manieriert erscheinen mir zudem die ineinander verschachtelten Erzählebenen, ohne Anführungszeichen wird fast komplett in direkter Rede erzählt, an die zu erinnern nun ständig «sagte Austerlitz» eingeschoben wird, was in der dritten Ebene dann unfreiwillig komisch wirkt, wenn beispielsweise immer wieder«..., sagte Vĕra, sagte Austerlitz, ...» eingefügt ist. Ein mir fragwürdig erscheinendes Stilelement Sebalds, welches seine Thematik keinesfalls erfordert. Davon abgesehen ein berührendes, nachdenklich machendes Buch, das ziemlich abrupt endet in der Festung Breendonk, ein ehemaliges SS-Verlies, wo der Ich-Erzähler, am Wassergraben sitzend, Dan Jacobsons «Heshel’s Kingdom» liest, auch dies eine Spurensuche zurück in die Zeiten des Holocaust.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für