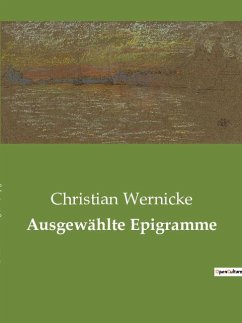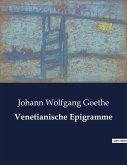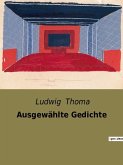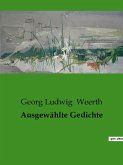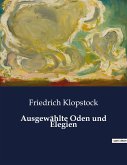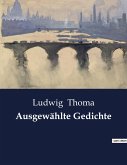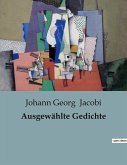Artemon hat gelernt, an mehr als einem Ort' Ein unverständlich Nichts durch aufgeblas'ne Wort' In wohlgezählte Reim' ohn' allen Zwang zu bringen; In jedem Abschnitt hört man klingen: »Schnee, Marmor, Alabast, Musk, Bisam und Zibeth, Sammt, Purpur, Seid' und Gold, Stern, Sonn' und Morgenröth',« Die sich in Unverstand verschanzen Und in geschloßner Reihe tanzen. Zwar les' ich selten sie vom Anfang bis an's Ende; Doch klopf' ich lachend in die Hände Und denk': es sind nicht schlechte Sachen, Aus Schell'n ein Glockenspiel zu machen. Melintes, den der Feinde Macht Um seine Wohlfahrt hat gebracht, Dem sprach man tröstlich also zu: »Melintes, stelle dich zur Ruh', Weil deiner Unschuld Nichts gebricht Und Jeder von dir rühmlich spricht, Der sich mit jenen nicht verschworen.« Melintes hört' es an und rief: »Was nützt ein guter Wind dem Schiff, Das Mast und Segel hat verloren?«