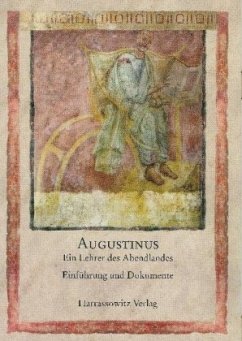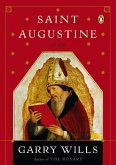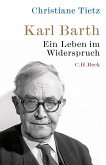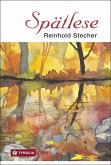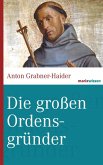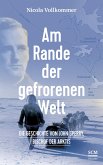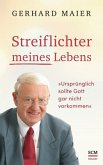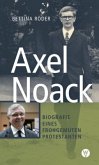Augustinus gilt als einflussreicher Lehrer des Abendlandes, der das Denken der mittelalterlichen Philosophen und Theologen weithin prägte und Anregungen bis in die Gegenwart gibt. Mit der Rezeption Augustins beschäftigten sich im Januar 2008 zahlreiche namhafte Forscher bei einem internationalen Symposion in Mainz, dessen Erträge von Norbert Fischer herausgegeben und in einer eigens hierfür konzipierten Ausstellung vorgestellt werden. Dort präsentiert die Universitätsbibliothek der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt eigene Bestände sowie Leihgaben bemerkenswerter handschriftlicher Zeugnisse der Rezipienten, beispielsweise die 1990 entdeckten Sermones Dolbeau sowie Autographen von Blondel, Rilke und Heidegger. Der dazu erscheinende Band bietet eine Einführung in die Grundlagen der Erforschung der Wirkungsgeschichte, zu den Anfängen der Augustinus-Rezeption, zur Bedeutung Augustins für die gegenwärtige Philosophie und Theologie und stellt die Sammlung der Eichstätter Augustinus-Bestände vor. Ergänzt wird der Band durch einen Bildteil mit Faksimiles der bedeutendsten Dokumente. (Katalog zur Ausstellung vom 14.5.09-31.7.09 in der Handschriftenabteilung/ Staats-und Seminarbibliothek der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.)

Die Universität Eichstätt zeichnet in einer Ausstellung die Spuren nach, die der Heilige Augustinus in Kunst und Philosophie hinterlassen hat
Was ist er nicht alles gewesen: Landkommunarde und Gemeinschaftsgründer, Philosoph und Bischof, Freund der Freiheit und Verteidiger der Gnade, Theoretiker der Sünde und Praktiker der Keuschheit, vor allem aber ein Alleserfasser, der im Finden suchend blieb. Das älteste bekannte Bild des Augustinus von Hippo, eine Wandmalerei aus dem Lateranpalast zu Rom, trägt die Widmungszeilen: Die Väter hätten Verschiedenes geschrieben, „doch dieser hier hat in lateinischer Sprache alles behandelt.”
Mit Augustins schwierigster Hinterlassenschaft, der Lehre von der Erbsünde, hatte Gilbert Keith Chesterton gerade kein Problem. Sie besage nämlich, dass alle „folgenschweren moralischen Gefahren, die jeden beliebigen bedrohen, alle Menschen bedrohen. Alle Menschen können Verbrecher sein, wenn sie in Versuchung geraten; alle können Helden sein, wenn ihnen die Erleuchtung zuteil wird.” Wie hält es da die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)? Schließlich ist ihr von Papst Benedikt XVI. aufgetragen, ein Leuchtturm zu werden in der deutschen Bildungslandschaft. Joseph Ratzinger wiederum nennt Augustinus „meinen großen Meister” und rühmt ihm nach: Ein Freund sei er, ein Zeitgenosse, „der zu mir spricht, der mit seinem frischen und aktuellen Glauben zu uns spricht.”
In der Ausstellung, mit der die KU ihr Augustinus-Projekt abschließt, kommt das Erbsündendogma nicht eigens vor. Stattdessen präsentiert man im abgedunkelten Kabinett mit den Inkunabeln jene exzentrische Stelle aus den Predigten, in der Augustin das „Gut des Heiratens” würdigt. „Sexuelle Selbstverleugnung”, also innereheliche Askese, habe er abgelehnt. Initiator Norbert Fischer wird im Ausstellungskatalog deutlich: Das augustinische Erbe sei Schatz und Bürde; „unannehmbar sind aber seine Lehren von der allgemeinen Bosheit des Menschengeschlechts, von der Erbsünde und von der Prädestination, nach der Gott aus bloßer Gnade wenige Erwählte ihrem verdienten Schicksal entreißt”.
Schatzstück im Kabinett ist eine zweibändige Basler Ausgabe der Predigten von 1494/95. Beide Inkunabeln enthalten imposante Holzschnitte. Der eine zeigt Augustinus als Prediger in der Kirche. Das Volk sitzt vorne auf dem Boden, der Klerus in den Bänken, vier Stenographen schreiben mit: Die Nachwelt war Zeuge. Der andere Holzschnitt imaginiert den Tag der ewigen Gelübde. Augustinus kniet vor einem riesigen Herzen, das zwei Pfeile durchbohren. Sie tragen die Inschriften „Gottesliebe” und „Eigenliebe”. Das in den „Bekenntnissen” nur einmal erwähnte ruhelose Herz des Menschen machte philosophisch ebenso Epoche wie ikonographisch. Mal durchbohrt, mal brennend, wurde es sein Insignium. Zur Conditio humana taugt es, sah Augustinus doch jedes Menschenleben in wissender Unwissenheit verzehrt von der Suche nach dem Unauffindbaren. Deshalb sei der Mensch ein Rätsel und ein gewaltiger Abgrund zugleich.
Jenseits der Schatzkammer, in den mitunter nachlässig arrangierten Vitrinen, will die Ausstellung der „mächtigen Wirkungskraft Augustins” (Katalog) nachspüren. Zu den interessantesten Fundstücken zählt die Beschäftigung Blondels, Heideggers, Rilkes mit dem Kirchenlehrer. Die beiden voluminösen Aufsatzbände (Verlag Felix Meiner) glänzen mit genauen Beobachtungen über das Verhältnis von Jacques Derrida zum Denken Augustins. Auch für Leibniz war der spätantike Vielschreiber „immer Gegenstand meiner Bewunderung”.
Maurice Blondel ist in der Ausstellung mit vier unveröffentlichten Texten vertreten. Der französische Philosoph rekapituliert Augustins synthetisierende Fähigkeit, „alle Aspekte des philosophischen Problems sowie des religiösen Problems, die nur eine Bestimmung bilden und nur eine Lösung umfassen, zu vereinigen”. Das „reale Wesen des Menschen” sei stets der Ausgangspunkt gewesen. Heidegger wiederum hat nicht nur in Vorlesungen, deren Skripte nun zu sehen sind, Augustin behandelt. Er bündelte auch dessen Liebesphilosophie in der Formel Volo ut sis – ich will, dass Du seiest; Liebe will das Sein des Geliebten. Darüber schrieb er 1928 in einem Brief an Elisabeth Blochmann. Ihr schenkte er auch zum Geburtstag 1933 die „Bekenntnisse”, denn „die Kraft des Existierens” darin sei „in der Tat unerschöpflich”.
Weniger die Liebes- und die Seinsphilosophie als der psychologische Zeitbegriff zog Rilkes lebenslange Neugier auf sich. Die ersten zwölf Kapitel der „Bekenntnisse” hatte er sogar übersetzt. Die Frage, ob er an Gott glaube, beantwortete Rilke 1920 ganz augustinisch: Falsch sei es, so zu fragen, „als ob Gott auf dem Wege menschlicher Anstrengung und Überwindung überhaupt zu erreichen sei”. Schon 1914 griff er Augustins Kindheitserinnerungen auf und führte sie in einem Brief weiter: „Ist es möglich, sie wäre wirklich noch da, in uns, die Kindheit, die nicht hatte, wo sie hätte hin gehen können, fort von uns?”
Dass selbst ein Ahnherr der Postmoderne wie Jacques Derrida sich in Augustin spiegeln konnte, spricht für dessen Durchdringungstiefe. Derrida veröffentlichte 1991 einen autobiographischen Text mit dem Titel „Zirkumfession”. Das Kunstwort ist zusammengesetzt aus Beschneidung und Bekenntnis, Zirkumzision und Konfession. Ausführlich zitiert er Augustins „Bekenntnisse” und überträgt das Konzept vom unauffindbaren Gott auf die eigene Lebensgeschichte. Das, wie Florian Bruckmann kommentiert, „Phänomen anwesender Abwesenheit” war das Lebensthema des säkularen Juden Derrida, der einzig durch eine Leerstelle, durch das Fehlen von Haut, dem Judentum und dessen Gott sich unauflöslich verbunden wusste. Derrida redet ihn sogar an, den Wissenden, den Zeugen, „nach dem ich suche, da ich ihn zu finden versucht – beim Finden gesucht”.
Wer den Kreis der Spuren noch weiter zieht, als es in Eichstätt geschah, der stößt sogar auf Jean-Francois Lyotard. Der zweite der postmodernen Dioskuren sah im Gott des alten Bundes den „Fortwährend-Begehrten”, der seinem Volk die Zusage gegeben habe seiner Abwesenheit. Ob eine solche negative Theologie noch Erbe des Bischofs aus Hippo ist? Sie ist jedenfalls eine Stimme im Hallraum namens Abendland, den Augustinus ins Leben rief. ALEXANDER KISSLER
„Augustinus, ein Lehrer des Abendlandes” in der Staatsbibliothek Eichstätt bis 31. Juli. Katalog (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden): 19,80 Euro.
Augustin im spätantiken Wandmalereifragment des Lateran Foto: Katalog
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de