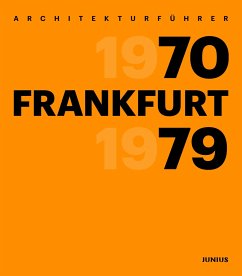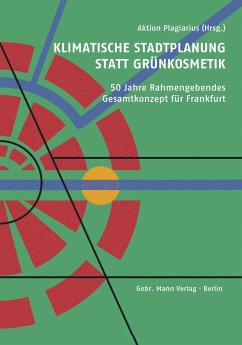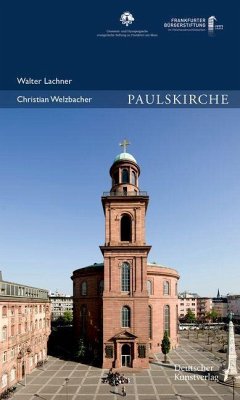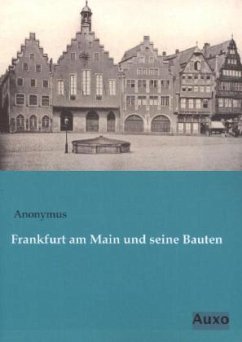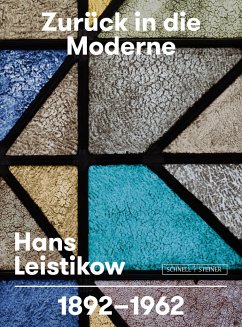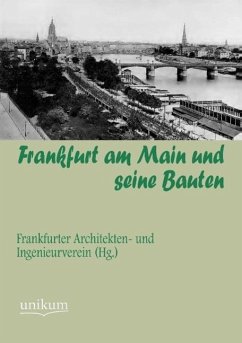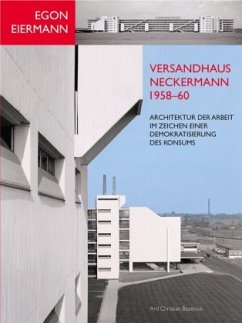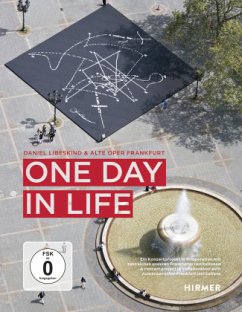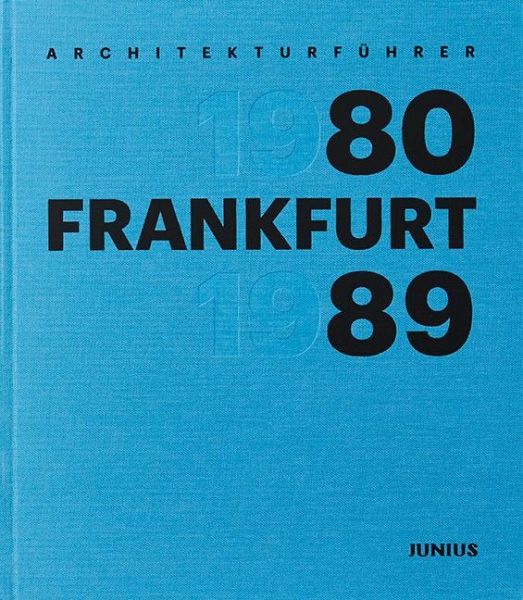
Architekturführer Frankfurt 1980-1989
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
44,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Jetzt also die Achtziger! Der vierte Band der beliebten Reihe zur Frankfurter Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt wie schon die Bände über die 1950er bis 1970er Jahre zehn besondere Bauten der jüngeren Vergangenheit. Und wider Erwarten bietet die Frankfurter Architektur dieser Dekade eine große Bandbreite an qualitätvollen Gebäuden: von verspätet umgesetzten Planungen der 1970er Jahre über technoide Ingenieursentwürfe bis zur mit baukulturellen Zitaten gespickten Postmoderne sowie einem architektonischen Highlight aus dem Taunus, dem Speckgürtel der Stadt. Zu d...
Jetzt also die Achtziger! Der vierte Band der beliebten Reihe zur Frankfurter Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt wie schon die Bände über die 1950er bis 1970er Jahre zehn besondere Bauten der jüngeren Vergangenheit. Und wider Erwarten bietet die Frankfurter Architektur dieser Dekade eine große Bandbreite an qualitätvollen Gebäuden: von verspätet umgesetzten Planungen der 1970er Jahre über technoide Ingenieursentwürfe bis zur mit baukulturellen Zitaten gespickten Postmoderne sowie einem architektonischen Highlight aus dem Taunus, dem Speckgürtel der Stadt. Zu den unübersehbaren Zwillingstürmen der Deutschen Bank gesellen sich Museumsbauten, eine große Wohnanlage, Häuser für Kinder und für Studenten, in einem Haus wird jüdische Kultur gelebt, in einem anderen lässt sich der Flora beim Gedeihen zuschauen. Außerdem stellt ein damals noch am Anfang einer großen Karriere stehender Architekt seine visionären Entwürfe von einst vor, bekennt eine Architekturprofessorin ihre Liebe zu Möbeln eines großen Architekten, und ein in München lehrender Designprofessor beleuchtet die Designszene dieses in Gestaltungsfragen verkannten Jahrzehnts. Das Vorwort hat Ursula Kleefisch-Jobst, Generalkuratorin des Museums für Architektur und Ingenieurkunst NRW (M:AI), geschrieben, wieder dabei sind der Fotograf Georg Dörr und Adrian Seib, der die zehn ausgewählten Bauten ausführlich vorstellt.