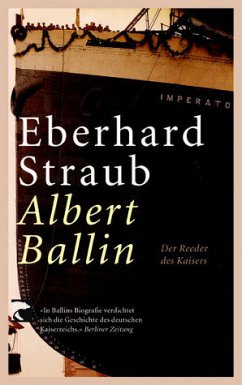Produktdetails
- Verlag: Berliner Taschenbuchverlag
- ISBN-13: 9783442761081
- ISBN-10: 3442761085
- Artikelnr.: 22141587

Hapag-Generaldirektor Ballin in verengter Perspektive
Eberhard Straub: Albert Ballin. Der Reeder des Kaisers. Siedler Verlag, Berlin 2001. 270 Seiten, 39,90 Mark.
Albert Ballin, bis 1918 Generaldirektor der größten Reederei der Welt, der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, kurz Hapag genannt, war ein Mann der Widersprüche. Der kosmopolitische Hamburger jüdischen Glaubens war stets umstritten. Doch weder seine Wettbewerber auf den Weltmeeren noch seine Gegner im Inland haben dem "Souverän der Seefahrt" ihren Respekt versagt. Als er am 9. November 1918 zusammen mit dem Kaiserreich gestorben war, würdigte selbst die sozialistische "Rote Fahne" den Klassenfeind als eine "zweifelsohne geniale Persönlichkeit, mit weitem Blick, größter Entschlossenheit und nie versagendem Wagemut".
Ein Ballin-Biograph hätte wohl herausfinden müssen, was eigentlich die Abkürzung "Hapag" korrekt bedeutet und wann Ballin erster Mann an der Spitze des Unternehmens wurde. Doch auch ohnedies steckt Straubs Schiffahrtsgeschichte voller Fehler. So häufen sich zum Beispiel falsche Schiffsnamen und ihnen zugeordnete Daten, weht die blau-weiß-gelbe Hapag-Flagge bei ihm symbolträchtig schwarz-weiß-rot und offenbart der Autor über den größten Wettbewerber - den Norddeutschen Lloyd - Unkenntnis. Auswanderer als "Humanware" oder "liquide, in Bewegung geratene Biomasse" zu bezeichnen unterliegt der Freiheit des Autors. Diese jedoch findet beim Umgang mit Fakten ihre Grenzen.
In seinem Bemühen, Ballins Aufstieg vor allem mit "Glück" zu erklären, verhaspelt sich Straub - so etwa, wenn er unterstellt, der kleine Auswandereragent habe, als er von Mai 1881 an beispiellos günstige Überfahrten nach Amerika anbot (und damit seinen Durchbruch schaffte), lediglich spekuliert: "Er konnte schließlich nicht ahnen, daß 1882 der russische Kaiser Alexander II. ermordet werden" würde und Pogrome eine gewaltige Auswanderungswelle aus Rußland auslösten. Ballin brauchte das nicht zu "ahnen". Der Zar wurde schon im März 1881 ermordet, und die Folgen waren durchaus für ihn vorhersehbar.
Auch bei einem der größten Erfolge Ballins, der Erfindung der Kreuzfahrt, habe letztlich "das Glück des Spielers" zum Erfolg verholfen? Wohl kaum, denn er - kreativster Kopf seiner Branche mit der Fähigkeit, sein Gespür mit kaufmännischem Kalkül umzusetzen - bereitete die zweimonatige Mittelmeer-"Excursion" geradezu generalstabsmäßig vor. Er habe, so ein weiterer Vorwurf, kleinere notleidende Reedereien aufgekauft und so den Einflußbereich der Hapag imperial ausgedehnt? Sicher, das tat er, sogar mit bemerkenswertem Geschick. Und schließlich, unter Berufung auf zwei noble hanseatische Ballin-Hasser: Nur der Erste Weltkrieg habe die Hapag davor bewahrt, vom Größenwahn ihres Chefs ruiniert zu werden? Die Bilanzen sprechen dagegen. Die waren 1914 - trotz des Baus dreier Großschiffe, von denen der "Imperator" bereits seit 1913 erfolgreich den Nordatlantik querte - kerngesund und wesentlich besser als die der Bremer.
Ein schiffahrtspolitisches Ereignis sei wegen seiner Bedeutung für das deutsch-britische Verhältnis, die Straub ihm zumißt, erwähnt: Der amerikanische Bankier John P. Morgan, der in den Vereinigten Staaten den größten Stahl- und Kohletrust sowie die meisten Eisenbahnen, vor allem an der Ostküste, kontrollierte, strebte zu Beginn des vorigen Jahrhunderts nach der Vorherrschaft auch auf dem Nordatlantik. Die Vereinigten Staaten besaßen bis dahin keine nennenswerte Handelsflotte. Morgan erwarb eine Reihe namhafter europäischer Reedereien (darunter in Großbritannien die White Star Line, die 1912 mit dem Untergang ihrer "Titanic" Schlagzeilen machte). Von den deutschen Großreedereien sah sich insbesondere die Hapag bedroht; ihre Stärke war der hohe Frachtanteil, und der war im Zu- und Ablauf in den Vereinigten Staaten auf Morgans Eisenbahnen angewiesen.
Ballin streckte damals Verhandlungsfühler aus. Straub behauptet nun (den wirtschaftlichen Hintergrund ignorierend), Ballin habe in seiner Machtgier auf dem Umweg über Morgan die größte britische Reederei, die Cunard Line, erwerben wollen. Die Verhandlungen mit dem Morgan-Trust, die auch den Kaiser auf den Plan gerufen hatten, endeten schließlich mit einem Interessenvertrag der Hapag und des Lloyd mit den Amerikanern ohne gegenseitige Kapitalbeteiligung.
Nach Straubs Worten sind an dem von ihm unterstellten Versuch Ballins, die Cunard Line "feindlich" zu übernehmen, "1901/02 die von vornherein vergeblichen und letzten Bemühungen Englands, sich vielleicht mit Deutschland zu verbünden", gescheitert. Diese Schlußfolgerung hat weder innere Logik noch Wahrheitsgehalt. Fraglich wird sie mit der These, Ballin sei einer der Verantwortlichen für die exzessive deutsche Seerüstung mit allen bekannten Folgen. Die entscheidende Rolle des Kaisers wird nicht mit einem einzigen Wort erwähnt.
Ballin, der zunächst - wie seine Kollegen - für die Flotte plädiert und geworben hatte, sah von 1908 an das Ziel erreicht und engagierte sich nun für Rüstungskontrolle zur See. Zusammen mit dem deutsch-britischen Bankier Sir Ernest Cassel versuchte er 1908/09 zum ersten Mal, deutsch-britische Verhandlungen in Gang zu bringen. Noch im Juni 1914 hoffte er, Winston Churchill zu Gesprächen mit Tirpitz zusammenzubringen, und reiste Ende Juli zu einem letzten, verzweifelten Vermittlungsversuch nach London. Vor allem initiierte er 1912 den Versuch, ein Rüstungskontroll- und Neutralitätsabkommen zwischen Deutschland und Großbritannien zustande zu bringen. Der britische Rüstungsminister Lord Haldane kam im Dezember 1912 nach Berlin, doch die Verhandlungen scheiterten. Ballin wird mit der "Haldane-Mission" in jeder Geschichtsschreibung dieser Epoche erwähnt. Warum ausgerechnet ein Ballin-Biograph sie unterschlägt, ist nicht nachzuvollziehen.
KLAUS WIBORG
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Eberhard Straubs Biografie von Albert Ballin, dem Reeder des Kaisers Wilhelm
Wie „kaiserlich” gesinnt die auf ihre republikanische Unabhängigkeit und Reputation so stolze Hansestadt Hamburg einst war, das wird einem jäh klar, wenn man die Bar des Hamburger Hotels Atlantic betritt. Da prangen seine Majestät Wilhelm II. überlebensgroß auf Kacheln gemalt an der Stirnwand, angetan mit einer jener Operettenuniformen, die S. K. H. über alles liebte, die Schnurrbartenden mit Pomade betoniert und steil nach oben gezwirbelt, den Blick in eine Ferne gerichtet, die nur ein Ozean ausfüllen kann. Ja, Hamburg liebte diesen Herrscher der unverantwortlichen Rede, in dessen Wesen mindestens soviel falsch verstandenes England steckte wie es die tonangebenden Kreise der Hansestadt bis heute gerne für sich selber in Anspruch nehmen.
„Wenn der Kaiser nach Hamburg kam”, so beginnt Eberhard Straubs Biografie von Albert Ballin, dem „Reeder des Kaisers”, wie ihn der Untertitel treffend apostrophiert, „verwandelte sich die Stadt in einen Festspielraum unter freiem Himmel, wie manche Freunde Richard Wagners ihn sich wünschten für die großen Momente im kollektiven Dasein. ” So war es wohl, wenn der Kaiser zu Schiffstaufen, Regatten, Flottenparaden oder sonstigen Festanlässen die Hansestadt huldvoll mit seiner Gegenwart beehrte. Albert Ballin, der Chef der Hamburg-Amerika-Paketfahrt-Aktiengesellschaft (Hapag), der ältesten deutschen Schifffahrtslinie, fungierte bei diesen hamburgischen „Kaisermanövern” stets als der Oberzeremoniar. Der Publizist Maximilian Harden, der mit Ballin befreundet war, bezeichnete ihn deshalb als des Kaisers „Hofozeanjuden”, ein Spottwort, das die Beziehung, die der Kaiser zum Reeder hatte, vorzüglich charakterisierte.
Albert Ballin stammte aus kleinen Verhältnissen. Sein von der Jütländischen Westküste gebürtiger Vater war zu Beginn der 1830er Jahre nach Hamburg gekommen, wo er sich mit wechselndem Geschick in der Tuch verarbeitenden Industrie versuchte. 1852 eröffnete er eine Agentur, die Auswanderungswilligen ihre Dienste anbot. Das Gewerbe war übel beleumundet, standen doch diese Agenten nicht von ungefähr im Ruch, die armen Teufel, die ihr Glück in der Neuen Welt zu finden hofften, um ihre letzten sauren Blutpfennige zu erleichtern. Das mag es erklären, dass man diesen „Menschenhandel” im reputierlichen Hamburg für lange mied und dieses Geschäft lieber den Bremern oder gar holländischen oder englischen Schiffseignern überließ, die weniger skrupellos waren.
Als Albert Ballin am 15. August 1857 geboren wurde – er war das dreizehnte und letzte Kind – „bewegte sich die Familie”, wie Eberhard Straub schreibt, „in den trüben Zonen, in denen der Übergang vom Kleinbürgertum ins Proletariat oft nicht aufzuhalten ist”. Diese Herkunft aus dem „Zille-Miljöh” der Hansestadt mag es erklären, dass von Ballins Jugendjahren so gut wie nichts bekannt ist, er seinerseits es auch umsichtig vermied, in den Jahren schwindelnden Erfolgs darüber Auskunft zu geben.
Im Dienst der Hapag
Albert Ballin stilisierte sich zum Muster eines „self-made-man”, dessen Lebensgeschichte mit seinem geschäftlichen Erfolg identisch ist. Ballin, der seit 1879 die Agentur des Vaters in alleiniger Verantwortung führte, erweiterte dessen lediglich vermittelnde Geschäftsgrundlage und unterhielt auf eigene Rechnung zunächst zwei ältere, langsam laufende Frachtschiffe, die ausschließlich Auswanderer nach Amerika schafften. Das erlaubte es ihm durch einen hohen Auslastungsgrad kombiniert mit einer scharf kalkulierten Preispolitik der Konkurrenz bald das Fürchten zu lehren.
Als im Zarenreich nach der Ermordung Alexanders II. Pogrome ausbrachen, ließ dies die Zahl der auswanderungswilligen Juden in Russland sprunghaft ansteigen. Das war Ballins große geschäftliche Chance, die er mit Glück und Umsicht sehr erfolgreich zu nutzen verstand. Bereits 1886 trat er in die Dienste der Hapag. Seine Aufgabe war es hier zunächst, die Werbung und die Personenpassage für seine eigene Reederei, die Union-Linie, wie für die Hapag zu koordinieren und zu leiten. Damit hatte Ballin endgültig das Trampolin betreten, das ihn bis an die Spitze der Hapag schnellte, die er in atemberaubendem Tempo bis 1898 zur führenden Reederei in der Welt ausbaute.
Straub schildert diese Erfolgsstory mit einem Detailreichtum, der zwar Zeugnis gibt von seinen archivalischen Recherchen, den Leser aber etwas ermüdet, zumal diesen die Bruttoregistertonnen weniger interessieren dürften als der ebenso spannende wie farbenreiche Aufstieg des Juden Ballin aus ärmlichen Verhältnissen in die Spitze der Hamburger Gesellschaft, die von Kaiser und Reich trunken war. Gottlob kommen aber auch diese Aspekte nicht zu kurz. Außerdem versteht es Straub sehr gut, die Lebensgeschichte des Parvenüs Ballin in die ebenfalls mit parvenühaften Zügen ausgestattete Zeitgeschichte des Deutschen Reichs einzuspiegeln, die in der Erscheinung Wilhelms II. ihren charakteristischen Ausdruck fand. Straub erzählt dies alles mit sehr viel Schwung, bisweilen allzu großem Schwung, der dann gelegentlich seine Metaphern gleichsam aus der Kurve trägt.
Diesem Schwung sind wohl auch zwei kleine Unrichtigkeiten geschuldet, die der Rezensent ihm ankreiden muss: Falsch ist, wie Straub schreibt, dass „avisierte Sondersteuern für die (Kriegs-) Flotte . . . sich jedoch nicht durchsetzen” ließen. So wurde 1902 eine Schaumweinsteuer von 50 Pfennigen pro Flasche für im Reich erzeugten Sekt mit der erklärten Absicht erhoben, dass auch die besser gestellten Klassen ihr Scherflein zur deutschen „Seegeltung” beitragen sollten. Falsch ist auch, dass der „rote Adlerorden” die höchste preußische Auszeichnung in Friedenszeiten gewesen ist; richtig ist, dass dies der „Orden vom schwarzen Adler” war, weshalb gern gespottet wurde, den „roten” so lange liegen zu lassen, bis er „schwarz” geworden sei.
JOHANNES WILLMS
EBERHARD STRAUB: Albert Ballin. Der Reeder des Kaisers. Siedler Verlag, Berlin 2001. 272 Seiten, Abbildungen, 39,90 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de