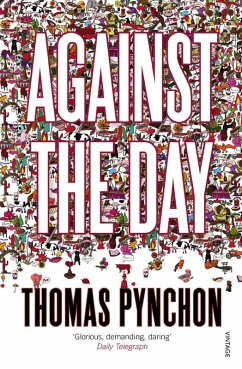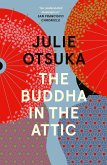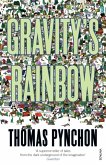Spanning the period between the Chicago World's Fair of 1893 and the years just after World War I, Against the Day moves from the labour troubles in Colorado to turn-of-the-century New York; Maybe it's not the world, but with a minor adjustment or two it's what the world might be.

Der Friedhofsengel
„Against the Day” entpuppt sich als romantischer Roman
Auch die längste Reise nimmt einmal ein Ende; und es wäre gelogen zu sagen, dass sie nicht ermüdet hätte. Denn spätestens seit sie ihren Zenit überschritten hatte, war es klar, dass sie zwar ein Ende haben würde, aber kein Ziel. Was will Pynchon eigentlich? Diese Frage, mal mit Unmut vorgetragen, mal in eher amüsiertem Ton, grundiert nicht wenige Rezensionen. Vielleicht fängt man, um „Against the Day” Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, am besten mit dem an, was das Buch offensichtlich nicht will und was nicht vollbracht zu haben man ihm darum billigerweise nicht vorwerfen sollte: es will ganz bestimmt keine zur Teilnahme einladende Psychologie.
Obwohl Pynchon alles über seine Figuren weiß und sich nicht scheut, gegebenenfalls auch Auskunft über ihr Seelenleben zu erteilen, steht er ihnen doch mit einer schwer zu übersehenden Kälte gegenüber. Dass, wie manche Romanciers berichten, sich eine Figur pinocchiohaft verselbständigt und dem Schreibenden ihren Willen aufzwingt, wäre bei Pynchon undenkbar. Je mehr Personal er auffährt, auch und gerade mit dem Vorsatz der Variation – etwa bei den fünf Luftschiffern der „Inconvenience” oder den drei Gebrüdern Traverse, die je auf ihre Weise den ermordeten Vater rächen wollen –, desto mehr gerät ihm das Arrangement zu einem Ballett im Eispalast.
Vor allem gilt das von den Frauen. Im Grunde lässt Pynchon nur zwei Typen zu: Auf der einen Seite die zähe Wildwestgattin, die den Laden zusammenhält und ihr wahrlich nicht leichtes Leben zu den Klängen von „Stand by your man” hinbringt; auf der anderen die Abenteurerin. Die phantomhafte V im früheren gleichnamigen Roman hat sich in ein ganzes Bouquet von Jugendstilsphingen zerfächert, deren austauschbares Geheimnis darin besteht, dass ihr erotischer Flattersinn sie für die geheimdienstliche Verwendung prädestiniert. Pynchon ist in seinem Element, wenn er die Toiletten schildern darf, in denen sie auftauchen und hinreißen: Da greift er voll in die Tasten der vorletzten Jahrhundertwende, da tummeln sich Hutungeheuer mit Reiherfedern, deren blasslila Ton genau den der Robe trifft, und Stiefelchen zum Niederknien. Betrüblich hingegen geraten ihm die frivolen Sex-Szenen, an denen das Buch keinen Mangel hat: Ihre Sinneslust ist die eines Knabentraums, ihre Keckheit trägt infantile Züge. (Noch mehr Missvergnügen bereiten die beiden Folterszenen, die dem Leser nichts erlassen als das Entsetzen der Opfer.)
Erkennbar strebt „Against the Day” älteren Modellen nach, zurück hinter alles, wodurch sich der Roman im letzten Vierteljahrtausend hat Achtbarkeit verschaffen wollen. Das Buch hat Heimweh nach Ritter- und Schelmen-Epen, in denen immer eine Ankunft den Reifungsprozess und eine Abreise die Konsequenz ersetzt. Es ist ein Haifisch von einem Roman: Um Sauerstoff zwischen die Kiemen zu kriegen, muss er ununterbrochen in Bewegung bleiben. Das Tempo der Ortswechsel (so kommt es dem Leser vor) erhöht sich im Fortgang des Buches.
Ein Spiel, nichts weiter
Nach dem nordamerikanischen Kontinent wird in der zweiten Hälfte Eurasien zum Schwerpunkt der Geschehnisse, Paris und London, Venedig und Triest, Ostende, Göttingen, Wien, Budapest und Szeged, die unüberschaubaren Landmassen Zentralasiens und Sibiriens, denen Pynchon mit der Leidenschaft des Landkartenfexes nachspürt – das Wörterbuch in der linken Hand sollte man hier gegen einen Atlas vertauschen –, zum Schluss hin dann bevorzugt der Balkan, durch den er eine kleinere Gruppe seiner Helden vor den diversen türkischen, serbischen, bulgarischen und griechischen Truppen zu Fuß fliehen lässt: Denn das Jahr ist nunmehr 1913, das Donnergrollen der Dauerkrise beginnt sich im Gewitter der Kriege zu entladen. Als schwache Koda folgt noch eine Art fliegender Landkommune, zu der sich die „Inconvenience” durch Familienzuwachs und Bricolage gemausert hat, mit einer Schlusseinstellung so um 1920, und wenn sie nicht gestorben sind, so segeln sie noch heute, hüten ihren Kindersegen und gießen ihr Tomatenbeetlein hoch über den Wolken.
Befriedigen, wie gesagt, kann das alles nicht. Es ist ein Spiel – den Begriff nicht wie bei Schiller genommen, sondern wie ein Brett- oder Kartenspiel, bei dem sich aus einer vorgegebenen Zahl von Grundbausteinen potentiell unendliche Variationen ergeben, allein zur Unterhaltung der Spielenden und ohne weitere Bedeutung. Welches Recht hat ein solches Spiel in der Literatur? Es scheint ihm etwas zu fehlen wie einem Eunuchen, der sich ansonsten völliger Gesundheit erfreut.
Auf der Hand liegt, dass es Pynchon mit nichts, mit nichts Einzelnem jedenfalls in Plot und Personal ernst ist, am allerwenigsten mit den wechselnden Mysterien, wenn sich wieder mal mit allerlei raunendem Schnickschnack andeutet, es wäre vielleicht doch möglich, an den Rädchen von Tod und Leben, Raum und Zeit zu drehen. Da wird nichts draus; oder, schlimmer noch, es kommt zur schäbigen Realisierung, zum öden Wiedergängertum von ein paar bitteren Toten oder zu einer Zeitmaschine mit dem optischen Appeal eines alten Drahtesels.
Im Zentrum steht, erreichbar nur auf dem Weg durch andere Dimensionen, die Oasenstadt Shambala, in der für englische Ohren „sham”, der Schwindel, anklingt. Die zweite, unablässig beschworene Wirklichkeit hinter der empirischen Oberfläche der Welt – es hat nicht mehr mit ihr auf sich als mit der Doppelbrechung des Lichts im Islandspat, die das Buch so beschäftigt, sie reicht nicht tiefer als ein Nagel, der den durchscheinenden Wachs- oder Paraffinblock ritzt. Sie ist nur der unscharfe Rand der ersten.
Das Defilée der Klischees
Wozu aber dieses gewollte Missverhältnis von Aufwand und Ertrag? Nur dann wird man über Pynchon gerecht urteilen, wenn man ihn als Romantiker versteht. Wie bei den deutschen Romantikern um 1800 entspringt auch bei ihm eine ironische Grundgestimmtheit dem Verhältnis von Poesie und Fragment. Dass dieses Verhältnis stimmt, ist wichtiger als alles, das sich nach außen hin ereignet. Da das Wesentliche als uneinholbar, unsagbar gilt, kommt jeglicher Konkretion nur der Rang eines Zeichens oder Platzhalters zu. So gerät auch bei Pynchon alle Handlung zur Schnitzeljagd, und den Charakteren ist es aufgetragen, von einer Trauer überzuströmen, die ihr flacher Rand nicht fassen kann; das Geheimnis der Welt aber verkleidet sich in eine Serie billiger Zauberkunststücke.
Unter dieser Voraussetzung ist selbst den ältesten Klischees die Rückkehr gestattet; Venedig bietet sich dar als Gondelmärchen, in Ungarn liebt man sich mit extrastarkem Feuer, wenn die Paarung im Paprikafeld stattfindet, die Russen werden auf offener Straße vom Kosakentanz gepackt. Und wenn die Stimmung einen gewissen Punkt erreicht, ergießen sich alle in ein schmissiges Couplet, dessen Text sie nicht kennen können und doch sogleich beherrschen, von prosaischer Folgerichtigkeit selig befreit wie in einer Offenbachschen Operette. Das Feste soll sich verflüssigen, das Flüssige aber lässt sich nicht halten: In diesem Widerstreit entfaltet sich der Abschiedsblick, den das Buch auf alle seine Schauplätze wirft, in einem Gemisch aus Belustigung und Wehmut. Es ist, obwohl es nicht auf Anhieb so aussieht, auch ein sentimentales Buch.
Pynchon hat, wie jeder Autor, ein Recht darauf, dass man ihn mit einer Passage zitiert, in der das Beste seiner Art zu schreiben hervortritt; und er braucht das mehr als jeder andere, weil es in diesem buntscheckigen Riesenwerk sonst einfach unterginge. Dally, eine seiner sphingischen Frauengestalten, die sich ihr Geld zeitweilig als Modell für Friedhofsengel verdient, nähert sich einem gigantischen dunklen Gebäude, in dem sie Archive ihres Geliebten auszuspionieren hofft. Das Gebäude präsentiert sich so: „Draußen schoss der Wind wild über Figuren hin, für die sie vielleicht selbst vor kurzem noch Modell gestanden hatte, jetzt zu Hunderten reproduziert in einer modernen Version des Portland-Kunststeins, der in den langen Böen schwach zu klingen schien, Ausklang des Nachmittags, und niemand hörte zu. Geschöpfe auf Friesen, Gesichter von Karyatiden in den oberen Geschossen, mineralische Einsamkeit. Wo gab es da menschliche Augen, zu schweigen von den leeren Halbmonden, welche anderen ihresgleichen als Augen dienten, die einem über diese gefährlichen Abgründe hinweg begegnet wären? Sie mussten sich begnügen, die Schatten zu verzeichnen, die über die vielfältigen Gradationen von Ruß hin rasten, welcher zu den Gipfeln dieser Türme aufstieg, täglich zu perlmutternem Glanz gescheuert von den Winden, so blankpoliert, dass es die Formen der Wolken reflektierte, die fern über dem Dunkel schwebten, das goldene Dach der Stadt, Wolken, umrandet wie Gesichter, klar konturiert wie das Klatschen von Händen, wie sie über die Stadtgrenze hinaus jagten, quer über die Panoramen trüben eisigen Graslands, an diesem Sturmtag, hoch über diesem nassen Unglück der ländlichen Räume . . . ”.
Die deutsche Übersetzung gibt nur einen unvollkommenen Eindruck von diesem syntaktischen Wolkenzug, in dem sich, als sollte er nie enden, eine freie Partizipialgruppe an die vorangegangene hängt wie ein letztes Wölkchen an ein vorletztes. Und doch erscheint dieser dunkle Bau mit seinen einander zum Verwechseln ähnlichen Steinfiguren, über deren starre leere Augen ein höheres, beweglicheres Sein in der flüchtigen Gunst des Sturmtags hinweggeht, als passendes Symbol für das, was Pynchon geahnt, gewünscht und geleistet hat. „Das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis”, ließe sich mit dem Schlusschor aus Goethes „Faust” sagen. Das klingt, zugegeben, etwas süßsauer – so süßsauer eben wie Pynchons grotesker Kandis, der in verhaltenen Tränen schmilzt. Ein großes Buch? Zweifellos. So groß wie das zu Boden drückende Gehörn eines ausgestorbenen Riesensäugers. BURKHARD MÜLLER
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
A fine example of a successful marriage between the popular and intellectual, between fiction and science... gloriously, demandingly, daringly, Pynchon has rediscovered vulgarity and continues to prove the novel has never been more vibrant, more various or better able to represent our complex world. Give this book your time - you'll agree its worth it Michael Moorcock Daily Telegraph