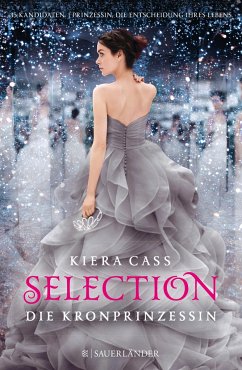von Buch und Leben zu erhellen, indem das Zopfgeflecht, das so entsteht, etwa einerseits von der Liebesgeschichte berichtet, die der jungen Schriftstellerin nach der Begegnung mit einer anderen, etwas älteren Schriftstellerin widerfährt, während die Heldin im Buch der Heldin eine Liebesgeschichte mit einem männlichen Fremdenführergespenst im Jenseits erlebt, dann ist das wahrscheinlich so viel Arbeit, dass man sich das als Mann Anfang fünfzig nur zumuten sollte, wenn es beim Schreiben ganz großen Spaß macht.
Beim Lesen macht es das jedenfalls recht oft, denn Scott Westerfield, der Mann von Anfang fünfzig, hat seine schwere Arbeit sowohl bei "Afterworlds" - so heißt das Buch, das von seiner ausgedachten Teenagerfigur erzählt - wie auch bei "Afterworlds" - so heißt das Buch, in dem seine ausgedachte Teenagerfigur von ihrer ausgedachten Teenagerfigur erzählt - sehr gut erledigt.
"Spaß" bedeutet hier freilich nicht unbeschwerte Ausgelassenheit oder die Verklärung der ersten Schritte eines im Gegensatz zum Vollprofi Westerfield naiven und frischen Geistes im intellektuellen und künstlerischen Traumberuf "Schriftstellerin" - es geht um viel Todernstes, Bitteres und Komplexes, das man gar nicht abbilden oder gestalten könnte, würde man sich ausschließlich unter Voraussetzungen wie Unschuld oder Kindlichkeit daran wagen: um bewaffneten Terror, im Geheimen wuchernde Familienverschlingungen, das Sterben, das Lügen und das Scheitern. Der Schauplatz, auf dem Darcy (so heißt Westerfields Heldin) und Lizzy (so heißt Darcys Heldin) mit all dem und außerdem Mietsorgen, Liebeskummer, dem Finanzamt und einer unkooperativen Universität fertig werden müssen, ist im weitesten Sinne "die Literatur", der Kosmos, in dem Sprache verletzen und heilen kann und dazu da ist, die eigene Geschichte zu verstehen, sich fremde Geschichten zu erschließen (um anderer, wirklicher Menschen willen) und aus solchen wahren auch mal kühn erfundene Geschichten zu synthetisieren, die dann im kontrastspendenden Vergleich mit dem eigenen wie dem fremden tatsächlichen Leben diese beiden klarer aus dem Chaos der Weltdaten hervortreten lassen können.
"Die Literatur" ist dabei einerseits, nämlich in Darcys Roman, eine phantastisch-spekulative Multisphäre zahlreicher in Erzählflächen eingebetteter Möglichkeitsräume, die in deutscher Übersetzung statt "Afterworlds" auch direkt "Nachwelten" hätten heißen können, da zur Literatur ja gehört, dass für die Lesenden dasjenige zur alle Sinne und allen Sinn bindenden Gegenwart werden kann, was für die Schreibenden Nachwelt ist, weil sie nicht mehr leben, ihre Texte aber nur so sterblich sind wie das Interesse der Lesenden.
Diese metaphorische Ausgestaltung dessen, was "Schreiben" heißt, überlässt Westerfield ganz seiner Darcy, die ihre große Zentralmetapher "Nachwelt als Textwelt" mit zahlreichen kleineren Metaphern stabilisiert und ausschmückt, bei denen Westerfield ein feines Gefühl dafür beweist, wie wenig Angst Anfängerinnen und Anfänger davor haben, dass ihre Sprachbilder ins Überproduzierte, Schwülstige ausbüchsen könnten: "Selbst in dieser schrecklichen Lage entging mir die Schönheit des Jungen nicht. Er schimmerte förmlich, als bräche die Sonne durch Nebel und Wolken, um ihn mit Licht zu umschmeicheln."
Ein besonderes Kunststück gelingt dem wirklichen Autor und seiner Übersetzerin mehrfach dabei, den unterirdischen, im Dunkel des Vor- und Unbewussten strömenden Kanälen zwischen Erleben und Schreiben nachzuspüren: Wenn die fiktive Darcy in einem der ersten Realienkapitel von der "Kraft ihrer eigenen Wörter" ergriffen ist, dann sagt eine spukhafte Gestalt der fiktiven Lizzy dieser fiktiven Darcy ein Kapitel später über ihre Ankunft in der Nachwelt: "Du bist durch deine Gedankenkraft hierhergelangt" - es wäre nicht übertrieben, zu behaupten, dass Westerfields Kunst (und die der sehr präzisen, aber nie steifgelenkig wörtlichen Übersetzung von Angela Stein) an solchen Stellen mit ihrer Kraft (sowohl "Force" wie "Power") etwas überaus Seltenes erreicht, das in der Literatur für Erwachsene zwischen Italo Calvino und Jorge Luis Borges meist der "Avantgarde" zugeschlagen wird, nämlich, mehrere Texte so zu einem Text zu verbinden, dass daraus nicht mehr einfach eine Autorin oder ein Autor spricht, sondern der Zauber unwahrer, aber wahrhaftiger Zeugnisse der Sprachphantasie selbst.
Was nicht heißt, dass in "Afterworlds" die nüchterne zeitgenössische Buchmarkt-Wirklichkeit zu kurz käme - die hat, sagt Darcy am Ende erschöpft, "mit Bücherblogs zu tun und mit Jugendbuch-Twitter-Feeds, mit Pseudobuchpreisen und Rezensionen". Darcy hat davon aus durchaus privaten, nicht zeitkritischen Gründen mitunter genug - und geht dann, um sich zu erholen, mit ihrer schlauen kleinen Schwester einfach in "eine der letzten großen unabhängigen Buchhandlungen von Manhattan" - die wahre Nachwelt, wenn es eine gibt.
DIETMAR DATH
Scott Westerfield: "Afterworlds. Die Welt zwischen uns"
Aus dem Englischen von Angela Stein. Verlag Fischer Sauerländer, Frankfurt 2015. 704 S., geb., 22,99 [Euro]. Ab 14 J.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
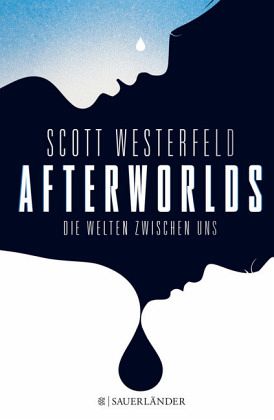





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.02.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.02.2016