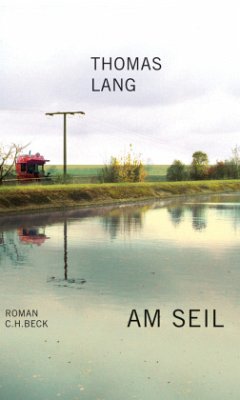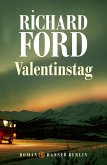Bert Kesperg kann nicht mehr laufen, jedenfalls nicht ohne Gehhilfe, seine Hände zittern, der ehemalige Englisch- und Sportlehrer verfällt mitunter in eine minutenlange Starre. Nach der Scheidung von seiner Frau lebt er in einem Seniorenwohnheim. Er liebt seine Pflegerin, die schöne und ihm ungewöhnlich zugewandte Pauline. Am gleichen Tag, an dem sie ihm eröffnen muß, daß ihr gekündigt wurde, erhält Bert überraschend Besuch von seinem Sohn Gert. Im Dämmer seines Zimmers glaubt er einen Moment lang, es sei der Tod, der ihn holen kommt.
Bert hat nie viel von seinem Sohn gehalten. Und Gert scheint dieses Bild mit jedem Wort, jedem Schritt zu bestätigen. Der ehemals bekannte Fernseh-Moderator steckt nach einem Übergriff auf seine Assistentin und nach einem schweren Autounfall, bei dem seine junge Geliebte ums Leben kam, in einer tiefen Krise. Doch als die beiden das Altersheim verlassen und in Berts Auto zu dem Hof fahren, auf dem sie früher gelebt haben, wendet sich das Blatt. Jenseits ihres lebenslangen Machtkampfes entwickelt sich eine prekäre Nähe, und es ist Gert, der den Entschluß, den sie beide stillschweigend gefaßt haben, zielstrebig umsetzt ...
Thomas Lang erhielt für einen Auszug aus diesem Roman den Ingeborg-Bachmann-Preis 2005. Er erzählt aus wechselnder Perspektive und mit einer perfekten Choreographie, präzis und packend, von einem geradezu archaischen Vater-Sohn-Konflikt, der eine überraschende Lösung erfährt. Dabei gelingen ihm gleichzeitig bewegende und nicht selten von absurder Komik aufgeladene Bilder, die einen tief berühren und lange nachwirken.
Bert hat nie viel von seinem Sohn gehalten. Und Gert scheint dieses Bild mit jedem Wort, jedem Schritt zu bestätigen. Der ehemals bekannte Fernseh-Moderator steckt nach einem Übergriff auf seine Assistentin und nach einem schweren Autounfall, bei dem seine junge Geliebte ums Leben kam, in einer tiefen Krise. Doch als die beiden das Altersheim verlassen und in Berts Auto zu dem Hof fahren, auf dem sie früher gelebt haben, wendet sich das Blatt. Jenseits ihres lebenslangen Machtkampfes entwickelt sich eine prekäre Nähe, und es ist Gert, der den Entschluß, den sie beide stillschweigend gefaßt haben, zielstrebig umsetzt ...
Thomas Lang erhielt für einen Auszug aus diesem Roman den Ingeborg-Bachmann-Preis 2005. Er erzählt aus wechselnder Perspektive und mit einer perfekten Choreographie, präzis und packend, von einem geradezu archaischen Vater-Sohn-Konflikt, der eine überraschende Lösung erfährt. Dabei gelingen ihm gleichzeitig bewegende und nicht selten von absurder Komik aufgeladene Bilder, die einen tief berühren und lange nachwirken.

Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht: Thomas Langs Vater-Sohn-Roman / Von Tilmann Lahme
Felix hieß er früher. Eine bittere Ironie in der Namensgebung des Autors Thomas Lang, denn sein "Glücklicher" ist ein Gescheiterter, der mit seinem Vater, einem schwerkranken alten Mann, die Tenne in der Scheune des einsamen Bauernhofes, auf dem beide aufwuchsen, besteigt, um dort auf ein dramatisches Finale zuzusteuern. Mit seiner achtzehn Seiten umfassende Kurzgeschichte "Am Seil" gewann Lang im vergangenen Jahr mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Nun hat er den Roman gleichen Titels vorgelegt, in dem der prämierte Text das Schlußkapitel bildet.
Jetzt heißt der Sohn also nicht mehr, wie zu Klagenfurter Zeiten, Felix, sondern Gert, und man erfährt in fünf Kapiteln, die dem showdown vorangestellt sind, die Vorgeschichte der beiden, vor allem den zwischen ihnen schwelenden Konflikt. Der Vater leidet am körperlichen Verfall und wünscht sich statt eines Dahinsiechens im Heim ein selbstbestimmtes Ende, zu dem ihm sein Sohn verhelfen soll. Dieser war ein erfolgreicher Fernsehmoderator. Mit dem Begrabschen einer Assistentin begann sein Niedergang; ein Autounfall, bei dem seine minderjährige Geliebte starb - sie hat nun die Namensironie geerbt und heißt Felicitas -, sowie das anschließende Getöse in der Boulevardpresse haben ihm den Rest gegeben. Als Wrack, psychisch und finanziell, steht er nun vor seinem Vater, den er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat.
Gert und Bert haben sich wenig zu sagen, sie vereint eine herzliche Abneigung, aber eben auch, wie der Namensklang andeutet, viel Gemeinsames. Vom Leben zermürbt sind sie beide, der eine nach einem kurzen und intensiven Leben, der andere nach einem langen, ereignislosen. Der Vater ist schwer von Parkinson gezeichnet, und auch der Junge hat schon ein "Zucken in den Gliedern" nervösen Ursprungs. Beide führen Pillendosen mit sich, beide tragen die gleiche Kleidung vom Unterschichtenausstatter C&A - Symptom des Abstiegs -, beide erhoffen sich vom Leben nichts mehr. "Wir wissen einfach nicht genug Bescheid, um unser Leben hinzukriegen", stöhnt Gert einmal.
Es gehört zu den entschiedenen Stärken der Erzählung von Thomas Lang, daß er nicht Partei ergreift, daß er sich aber ebensowenig um eine ausgewogene, verständnisvolle Haltung schert. Wir erfahren die Vater-Sohn-Geschichte aus der Perspektive der Protagonisten, die sich gegenseitig mit Schärfe und wenig Zuneigung betrachten. Vor allem der Vater dokumentiert seine Enttäuschung über die verfehlten Hoffnungen, die er in seinen Sohn steckte: Zu träge, unsportlich, haltungs- und antriebslos erschien er ihm stets. Zornesausbrüche ("eine dämliche Fresse") werden in Gedanken formuliert, Demotivierendes wird auch ausgesprochen: "Du müßtest vielleicht versuchen, etwas ... aufgeweckter dreinzuschauen." Ebendiesen "Besserwisser-Oberlehrer-Ton" empfindet der Sohn als existentielle Hypothek. Sein ganzes Leben habe er ihm mit solchen Bemerkungen "versaut", schreit er später. Und recht scheinen ja beide zu haben: Den Schnürsenkel des Vaters hat der Sohn beim Zubinden abgerissen, die Freundin in den Tod gefahren. Ein echter Versager, in allen Lebenslagen. Und der Vater stützt den Sohn, frei nach Trotzki, wie der Strick den Gehenkten. Schließlich stehen Vater und Sohn, mit einem Seil nun auch äußerlich verbunden, auf der Tenne, bereit zum Sprung in den Tod, wie es scheint.
Man versteht gut, was die Bachmann-Jury bewog, Thomas Langs furioses Schlußkapitel auszuzeichnen: erstickte Gefühle, Vorwürfe, Lebensschlußstrich, alles nur in Andeutung und mit knappen, aber präzisen erzählerischen Mitteln dargeboten, dazu Genauigkeit der äußeren Abläufe und der Szenerie. Nur: Reichte das nicht? Darin kam schon alles vor, der Konflikt, die Vorgeschichte, der beidseitige Todeswunsch - wofür also noch die vorhergehenden 143 Seiten? Die, wie man hört, Lang erst nachträglich schrieb, um aus seiner Geschichte ein Buch zu machen. So funktioniert das nicht. Dem Schlußkapitel fünf weitere voranzustellen, um das ganze dann "Roman" nennen zu können, ist vom Marketing her verständlich, aber erzählerisch und kompositorisch kaum gelungen.
Zehn Jahre haben sich Vater und Sohn nicht gesehen, aber exakt an dem Tag, an dem Gert (auf einem geklauten Motorrad) zu Besuch kommt, erfährt die vom Vater geliebte Pflegerin Bubi, daß sie entlassen wird. Weitere Nahrung für den Todeswunsch Berts, aber trotz der intensiven Beziehung zu Bubi verschwindet sie fortan fast vollständig aus seinem Sinn. Und Gert? Hätte nicht der Tod der minderjährigen Geliebten oder die Grabscherei genügt, um seinen tiefen Fall zu motivieren?
Einzelne Beobachtungen überzeugen, etwa die Ausgrenzung der Pflegefälle unter den Heimbewohnern, weil man mit dem drohenden Schicksal nicht konfrontiert werden will; schön auch die Relativierung der Alterserotik: "Junge Mädchen wirken nur in der Vorstellung anziehend. In der Wirklichkeit sind sie psychische und soziale Ich-AGs"; oder, in Langs Art des Wie-nebenher-Formulierens, ein Hinweis zum Thema Abtreibung: "Unheimliche Macht der Frauen über Leben und Tod".
Doch solch leuchtende Stellen können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die zusätzliche Motivierung dem Schluß eine Kolorierung verpaßt, die das Offene und Doppelbödige tilgt. Handelt es sich wirklich um einen Doppelselbstmord? Die dichte Todessymbolik legt dies nahe - mehrfach betont ja auch der Sohn, er sei am Ende. Und doch hat der Vater in Todesangst eine Art Vision, wie Gert seine Geliebte absichtlich totfährt, erscheint der Sohn, der tapsige, schließlich stark, geschickt und unergründlich. "Die Trotteligkeit ist seine Maske." Der Beginn von Nick Caves "Let Love in" steht als Motto der Erzählung voran: Von Verzweiflung und Täuschung, den "häßlichen Schwestern der Liebe" ist da die Rede. Nach 170 Seiten hat der Leser nur noch die Verzweiflung im Blick.
Thomas Lang: "Am Seil". Roman. Verlag C.H. Beck, München 2006. 174 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Tilmann Lahme unterschreibt voll und ganz das Urteil der Klagenfurter Jury, die Thomas Lang für das letzte Kapitel seines Vater-Sohn-Romans den Ingeborg-Bachmann-Preis zuerkannte: "erstickte Gefühle, Vorwürfe, Lebensschlusstrich" - und das knapp, aber präzise beschrieben. Das Buch selbst allerdings erntet herbe Kritik des Rezensenten. Es ist erst nachträglich geschrieben worden, um aus der preisgekrönten Geschichte einen Roman zu machen, meint Lahme. Aber "so funktioniert das nicht!" echauffiert sich der Rezensent, der das Unternehmen nur "vom Marketing her" verständlich findet. Erzählerisch kann er ihm nichts abgewinnen. Lang schildere die komplizierten Beziehung zwischen einem Mann, der im Alter dem köperlichen Verfall anheimgegeben ist, und seinem Sohn, dessen vielversprechende Karriere als Moderator abbricht, als er eine Assistentin begrabscht. Das Drama endet im Doppelselbstmord, jedenfalls legt die Symbolik diesen Schluss für den Rezensenten nahe. Sicher ist er nicht. Besonders übel nimmt Lahme, dass die nachträglich geschriebenen Kapitel dem in Klagenfurt ausgezeichneten Text das "Offene und Doppelbödige" austrieben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Kaltes Vergnügen: „Am Seil”, der Roman des Bachmann-Preisträgers Thomas Lang
Man tut diesem beklemmenden und beeindruckenden Text keinen Gefallen, wenn man ihn einen Roman nennt. Thomas Langs Prosastück „Am Seil” ist viel weniger, ein Zweipersonenstück, eine ausgemalte Situation, ein Konstrukt mit fast geometrischen Qualitäten. Aber in seiner Beschränkung ist es durchaus von monotoner Wucht. Lang hat eine Studie in jenem klassisch-malerischen Sinn vorgelegt, den das Wort für die Literatur einmal besaß, ein fotorealistisch anmutendes, vielfach lasiertes und hintergründig glühendes Stück langsamer Literatur.
Gert und Bert, die beiden Hauptfiguren - ihr Namensgleichklang ist eine der wenigen handwerklichen Schwächen des Buches -, sind Vater und Sohn. Der eine, Bert, ist ein Greis am Ende seiner Bahn, angekommen in einem Pflegeheim, wo er, bei brillanter geistiger Wachheit, das elende Restleben eines körperlich kaum noch handlungsfähigen Menschen führt. Der andere, Gert, ist ein Mann in jenen besten Jahren, die oft die übelsten sind, ein soeben noch erfolgreicher Talkshowmoderator, den erst eine Grapscher-Affäre und dann ein Autounfall, bei dem seine minderjährige Freundin ums Leben kam, aus seiner Karriere geschleudert haben. Bert war Turnlehrer, und die damit verbundene Freude am ungeduldigen Herumkommandieren hat er nicht verloren. Gert ist ein selbstmitleidiger Zyniker, der seine ungebrochene Prominenz dafür ausnützt, Wildfremde schlecht zu behandeln.
Gert und Bert haben sich seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen, sodass der Alte den Absturz des Jungen nur in den Medien, dort aber in allen Implikationen mitverfolgen konnte. Nun fährt Sohn Gert zu Vater Bert ins Pflegeheim, aus dunklen Motiven, gewiss aber aus existenzieller Verunsicherung, die ihn zurück zum autoritären Erzeuger treibt. Beide sind innerlich und äußerlich gebrochen, den einen quälen die Folgen seines Unfalls in Form von traumatischen Erinnerungen und eines immer wieder tauben Arms, der andere zittert von Parkinson und hat immer wieder minutenlange Phasen körperlicher Bewegungsunfähigkeit. Am Ende ihrer Bahn fühlen sich beide: der Versager und der Sterbende.
So ist Gerts Reise zum Vater eine Hadesfahrt, ein Abstieg in die Unterwelt. Wechselnde Wolkenstimmungen tauchen dieses Jenseits in flackernde Beleuchtungen, als würden unentwegt die Linsen einer Kamera gewechselt. Die todesnahe Überwirklichkeit der Szenerie zeigt sich in einer zeitlupenhaften Verlangsamung der Abläufe, die körperliche Schwäche ins Medium der Prosa übersetzt und tiefe Depressivität ausdrückt. Schon nach wenigen Sätzen befindet der Leser sich in einem ungewohnten Fluidum, so als müsse er durchs Wasser gehen - oder wie in einem Traum mit starkem Fluchtimpuls, dem der vom Schlaf ans Bett gefesselte Körper nicht folgen kann.
Die Farben des Verfalls
Dieser quälenden Konstellation gewinnt Thomas Lang Reize ab, für die nicht jeder geschaffen sein mag, deren artistische Qualitäten aber ganz unbestreitbar sind. Da ist eine virtuose Veranschaulichungskraft äußerer und innerer Abläufe. Die kalte und ziemlich rücksichtslose Beobachtung menschlicher Schwäche ist flankiert von Humor und Schauder, von Groteske und mythischem Schrecken. Grauenhaft komisch sind die Abläufe im Pflegeheim, dessen farblich markierte Bereiche die Stufen des Abstiegs zum Ende bezeichnen: Wer bei Grün ist, der ist schon bettlägerig, während man bei Orange noch mit Gehhilfen humpelt, und vermutlich hat die Pflegeversicherung ähnlich gefärbte Formulare für die verschiedenen Ebenen der Hinfälligkeit.
Der Alte will dieser Welt entkommen und mit aller verbleibenden Kraft seinen eigenen Tod finden. Seinen unerwartet eintreffenden Sohn sieht er zunächst im Gegenlicht, aber schon ahnt er, dass dieser ihn herausholen kann. So reagiert der Vater instinktiv, physiologisch. Thomas Langs Feld ist nicht zuletzt eine Nervenkunst, die sich solcher vegetativen Sensationen annimmt: „Er hat tatsächlich eine Gänsehaut bekommen . . . Das Prickeln wird stärker, die Haut fühlt sich am ganzen Körper straff gespannt an. Innerlich dagegen ist er weich wie frisch geschnittenes Gras, das feucht und kühl auf seine Hände fällt.”
Es erweist sich, dass der Alte dem Jungen an Willenskraft und Intellekt immer noch weit voraus ist. Mit Kennermiene registriert der einstige Sportlehrer den frühen körperlichen Verfall seines Sohns, und binnen kurzem hat er den Schwächling so weit, dass er ihn zum früheren Wohnhaus der Familie, der Stätte von Gerts Kindheit, bringt, zu einem alten Hof inmitten weiter, kahler Ländereien. Nun wird die Landschaft endgültig höllenhaft, düster und verloren, aber nicht ohne groteske Akzente: „Mitten auf den Feldern, die sich über die Ebene fast bis in die Unendlichkeit erstrecken, steht eine riesige Erdbeere, dem Anschein nach fast so groß wie ein Haus. Ein Verkaufsstand oder eine vom Frühjahr übrig gebliebene Werbung. Die UV-Strahlung eines Sommers hat sie gebleicht, und der Himmel verfinstert sich zusehends. Trotzdem knallt sie aus dem herbstlichen Braun und welken Grün der Fläche wie eine Bombe.”
Der anstrengende Ausflug gerät unweigerlich zur Reise in die Vergangenheit, vor allem für Gert, denn das Quälende seiner Kindheit kommt stechend in sein Bewusstsein zurück. Söhne mögen unsicher sein und leiden; Väter sind im Zweifelsfalle kalt und von mitleidloser Scharfsicht: An dieser höhnischen Wahrheit kann aller physische Niedergang der Alten nichts ändern. Im Hades übernimmt der Vater definitiv wieder das Kommando.
Der verfallende Hof, Bühne für den letzten Akt, gleicht dem Schauplatz eines Horrorfilms, über den der gebildete Autor etliche symbolische Requisiten gestreut hat. Ein von Gert und Bert weggescheuchtes Liebespaar lässt einen faulen biblischen Sündenapfel liegen. Und längst weiß man, wie es ausgeht - der Titel „Am Seil” deutet es an, die scheußlich konsequente Symmetrie zwischen den beiden Hauptfiguren macht es zwingend -, und doch folgt man der Handlung, die sich nun ganz auf die Ebene minutiös beschriebener äußerer Abläufe verlagert, bis zum Schluss mit faszinierter Aufmerksamkeit. Thomas Lang, der mit diesem Text den Bachmann-Preis 2005 gewann, kam 1967 zur Welt. Viel älter darf man wohl nicht sein, wenn man ein solches Stück schreibt - und vielleicht auch nicht, wenn man es mit dem ihm zustehenden kalten Vergnügen lesen will. GUSTAV SEIBT
THOMAS LANG: Am Seil. Roman. Verlag C.H. Beck, München 2006. 174 Seiten, 16,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH