Mit sorgsam inszenierten Instagramfotos nehmen die Models Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi Dean) ihre Follower auf eine Reise durch ihre perfekte (Mode-)Welt mit - und zwar rund um die Uhr. Als das junge Paar die Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt annimmt, treffen sie an Bord der Megayacht auf russische Oligarchen, skandinavische IT-Milliardäre, britische Waffenhändler, gelangweilte Ehefrauen und einen Kapitän (Woody Harrelson), der im Alkoholrausch Marx zitiert. Zunächst verläuft der Törn zwischen Sonnenbaden, Smalltalk und Champagnerfrühstück absolut selfietauglich. Doch während des Captain's Dinners zieht ein Sturm auf und das Paar findet sich auf einer einsamen Insel wieder, zusammen mit einer Gruppe von Milliardären und einer Reinigungskraft (Dolly De Leon) des Schiffes. Plötzlich ist die Hierarchie auf den Kopf gestellt, denn die Reinigungskraft ist die Einzige, die Feuer machen und fischen kann.
Bonusmaterial
Interviews mit Regisseur Ruben Östlund und Schauspielerinnen Trailer Wendecover
Ruben Östlunds Film "Triangle of Sadness" macht den Urlaub auf dem Balkon zum unvergleichlichen Erlebnis.
Eigentlich schien sich die Sache mit den Kreuzfahrtschiffen erledigt zu haben, seit sich herumgesprochen hat, dass sie so umweltschädlich sind, dass es zum Himmel stinkt. Sie fahren mit Schweröl, ihre Passagiere erzeugen Berge an Abfall - wer eine Woche auf einem solchen Schiff verbringt, heißt es, verursache so viel CO2-Emission wie neuntausend im Auto gefahrene Kilometer. Bei zwei- bis siebentausend Passagieren plus Crew je Schiff bricht einem beim Nachrechnen der Schweiß aus. Wie überhaupt bei der Vorstellung vom sozialen Nahkampf auf engstem Schiffsraum. Dabei schien die Pandemie dem Spuk auf den Weltmeeren ein Ende zu bereiten - so dachte man jedenfalls.
In Wahrheit erleben die Ozeanriesen einen ungeahnten Höhenflug, die Reedereien melden gerade einen Buchungsrekord nach dem anderen. Allein zwanzig neue Schiffe gehen in diesem Jahr vom Stapel, darunter die " Icon of the Seas" - die fast einen halben Kilometer lang und mit 7600 Passagieren das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sein wird. Und auch die "Verrückt nach Meer"-Doku schippert nach wie vor unverdrossen durch ARD-Gewässer, als gäbe es all die journalistischen Formate nicht, die im selben Sender auf die Klimaschäden des Schiffstourismus hinweisen.
Als Kreuzfahrt-Detox sei der ARD daher Ruben Östlunds Kinogroteske "Triangle of Sadness" fürs Programm empfohlen, möglichst zur besten Sendezeit. Sie wird ihre Wirkung nicht verfehlen. Derzeit kann man den 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Kinofilm bei Amazon Prime Video schauen - zu abendlicher Stunde funktioniert das sogar auf dem Sommerferien-Balkon per Tablet. Denn die Filme des schwedischen Autors und Regisseurs sind nicht so ausgelegt, dass man das Wesentliche übersehen könnte. Auch in dieser satirischen Abrechnung mit der Luxuskreuzfahrt macht Östlund keine Gefangenen. Seine Bildsprache ist plastisch, sie ist drastisch - und daher noch auf dem kleinsten Bildschirm lesbar. Nur auf einer Kreuzfahrt sollte man den Film keinesfalls sehen. Eine Vorführung im Bordkino könnte folgenreich sein - all inclusive bis hin zum Massenexodus der Passagiere auf die Rettungsboote. Wer den Film jedoch gesehen hat, wird im womöglich insgeheim gehegten Traum von der Schiffsreise den Albtraum sofort erkennen.
Hatte Ruben Östlund in seinem ebenfalls in Cannes prämierten Film "The Square" 2017 noch die Bigotterie der Kunstwelt aufs Korn genommen, wendet er sich nunmehr den perlenbehängten Superreichen auf hoher See zu. Einige ihrer ekligsten Vertreter tummeln sich auf dem Luxus-Cruiser. Die Figuren sind mal fade und grausam wie das Model Yaya (Charlbi Dean), mal fade und überempfindlich wie ihr Freund Carl (Harris Dickinson) mal liebevoll und monströs wie das ältere britische Pärchen, das zufälligerweise mit Waffen handelt, oder der Oligarch Dimitri (Zlatko Buric), der seine Milliarden mit Abfall macht und dessen Gattin (Sunnyi Melles) das Personal wie Spielzeug behandelt.
Auf Entlastung ist hier nicht zu hoffen. Vielmehr verknüpft der Film bittere Wahrheiten eines Michael Haneke mit der schrecklichen Komik Monty Pythons. Östlund geht sogar so weit, das eigene Werk der Heile-Welt-Ästhetik von Parfümwerbung unterzuordnen - was die Exzesse nur umso übler und den exklusiven Klub nur umso vulgärer erscheinen lässt. Östlunds Blick auf den Konsumkapitalismus gerät so plastisch wie die neue Nase der Milliardärin. Das ließ den verschreckten Filmkritiker der "New York Times" prompt Abbitte leisten bei europäischen Autorenfilmern wie Lars von Trier, die er für ihre "sadomasochistischen Erregungen" sonst immer abmahnt und nach deren formaler Strenge er sich angesichts von Östlunds eingängiger Überwältigungsästhetik sehnt.
Bei dem Schweden ist es die Natur - in Gestalt eines Sturms, dem nachgeholfen wird von einer Handvoll Piraten -, die dem Champagner-Treiben auf dem Boot ein jähes Ende bereitet. Eben noch beim Captain's Dinner, kommt es im nächsten Moment zu durchfallartigen Überschwemmungen, die alle Decks in ein Schlammbad des Erbrochenen verwandeln. Nur der selbstmitleidige Kapitän (Woody Harrelson), ein dauerbetrunkener Marxist, macht sich einen Spaß daraus. Hat er sich am Ende all das etwa ausgedacht, um seine Gästeschar zum Ausspucken ihrer Gourmetessen und in die Erniedrigung zu zwingen - während er, der amerikanische Antikapitalist, sich mit dem russischen Kapitalisten Dimitri per Lautsprecher ein Marx-Duell liefert?
Der letzte Akt dieser Allegorie auf das traurige Dreieck aus Macht, Mensch, Natur führt auf eine Insel irgendwo in der Südsee. Während das Sittenbild auf dem Schiff die Klassen noch sorgsam voneinander getrennt hatte, die Gäste, die Crew, die Putzkolonne, die Arbeiter im Maschinenraum, dreht Östlund den Spieß auf dem Eiland um, als sich die Klofrau (herrlich: Dolly de Leon) nunmehr an die Spitze der Neu-Insulaner setzt. Weil nur sie über die Fähigkeit verfügt, mit buchstäblich nichts als Sonne und weißem Sand zu überleben. Hier schließlich kommt auch die Szene von Bord zur höhnischen Vollendung, als die Oligarchengattin die Crew zum Rollentausch mit Champagner und Poolbad gezwungen hatte. Aus dem Spiel ist bitterer Ernst geworden. Doch wenn sich das neue Herrschaftsregime auf der Insel nun als genauso ausbeuterisch erweist wie die alte, könnten wir auf unserem Balkon das so verstehen, als sei der Mensch in maritimen Extremsituationen dem Menschen ein Wolf - und Schluss. Doch da ist der Film noch nicht am Ende.
Erst in den letzten Minuten erweist sich, dass die Insel so einsam nicht ist, sondern Untergrund eines Luxusressorts, womit wir wieder beim Anfang wären. Womöglich gehört sie ja sogar der Reederei, die das Boot überhaupt erst in See stechen ließ, um ebendort für ein Südseegefühl der Gästeschar anzulanden, das reine Fiktion ist. Solche Inseln in Privatbesitz von Reedereien, die zum Fantasyland für Kreuzfahrer umgebaut wurden, gibt es tatsächlich.
Manche Wahrheiten Ruben Östlands mögen sattsam bekannt sein, erträglicher werden sie nicht. "Triangle of Sadness" ist ein Tauchgang in die grenzenlose Schrecklichkeit der modernen Welt, ein abgründiger Spaß, der seine Schadenfreude über unser Unbehagen nicht verbergen kann. Wir aber stoßen unter Geranien im zweiten Stock doppelt darauf an, dass wir zu- hause geblieben sind. SANDRA KEGEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

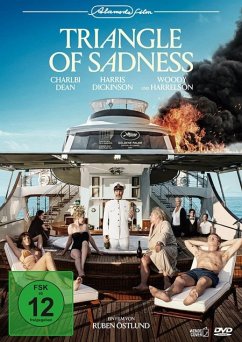





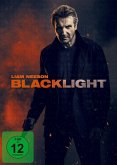

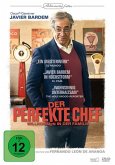



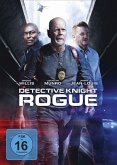
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG