Nicolas Berg untersucht die Schwierigkeiten der westdeutschen Geschichtswissenschaft im Umgang mit dem Holocaust. Geschichte und Gedächtnis, so Charles Péguy Anfang des Jahrhunderts, stehen im »rechten Winkel« zueinander: jene verlaufe parallel zum Ereignis, dieses gehe senkrecht durch es hindurch. Nicolas Berg zeigt, wie das Verhältnis der deutschen Nachkriegshistoriographie zur NS-Judenvernichtung nur mit dem Blick auf beides zugleich historisiert werden kann. Er ergänzt den historiographiegeschichtlichen Ansatz durch die Gedächtnisgeschichte und fragt nicht nur nach dem Wissensstand im Verlauf der Jahrzehnte, sondern auch nach seiner jeweiligen Historizität und seiner Veränderung. Fokus der Analyse ist der sich wandelnde Begriff von »Auschwitz« in der westdeutschen Geschichtswissenschaft vom Ende des Zweiten Weltkrieges an bis zur gegenwärtigen Diskussion. Beleuchtet werden sowohl die Spannungen zwischen den Perspektiven verschiedener Generationen, als auch die Auseinandersetzungen um die angemessenen Theorien, Methoden und Begriffe. Dabei werden nicht nur die kanonisierten Schlüsselschriften herangezogen, sondern auch lebensgeschichtliche Texte wie Briefwechsel, Tagebücher, Erinnerungen und Autobiographien berücksichtigt, viele von ihnen aus Archivbeständen. Daß es hinter der bekannt mühevollen deutschen Geschichtserinnerung an den Holocaust eine jüdische Außenseiter-Perspektive gab, der viele Jahre lang der wissenschaftliche Wert aberkannt wurde, wird an der Ablehnung der Arbeiten von Joseph Wulf deutlich, die in der vorliegenden Studie erstmals rehabilitiert werden. 1. Platz der Sachbuch-Bestenliste der Süddeutschen Zeitung, BuchJournal und NDR (30. Juni 2003)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

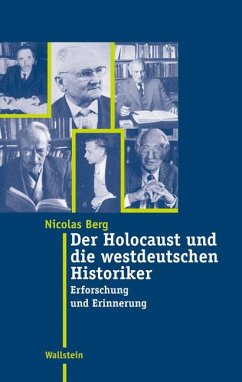

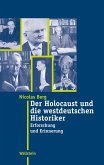



![Nichts ist so unsichtbar wie ein Denkmal [für Ernst Thälmann] (eBook, PDF) Nichts ist so unsichtbar wie ein Denkmal [für Ernst Thälmann] (eBook, PDF)](https://bilder.buecher.de/produkte/68/68079/68079438m.jpg)

