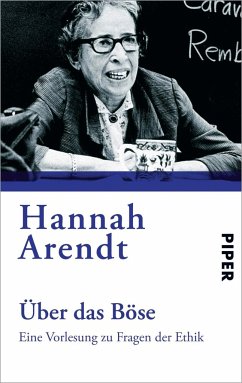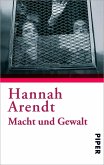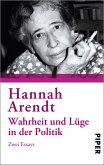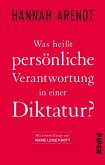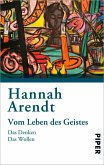DER FLUCH DER GLEICHGÜLTIGKEIT
Das Denken der deutsch-jüdischen Philosophin Hannah Arendt ist aktueller denn je. Vor dem Hintergrund des Eichmann-Prozesses und der »Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte«, denkt Hannah Arendt 1965 in einer New Yorker Vorlesung über Fragen der Ethik und vor allem über das Böse nach. Eine Ethik »nach Auschwitz« kann, so Arendt, nur auf dem Denken und Erinnern gründen. Denn die größten Verbrecher sind, so sagt sie, diejenigen, die beides verweigern.
Ein wichtiger Text zu einem zentralen Thema im Werk Hannah Arendts wird hier erstmals auf deutsch zugänglich gemacht. Franziska Augsteins Nachwort »Taten und Täter« nimmt Arendts Argumentation auf und führt sie weiter zum Thema Widerstand.
Das Denken der deutsch-jüdischen Philosophin Hannah Arendt ist aktueller denn je. Vor dem Hintergrund des Eichmann-Prozesses und der »Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte«, denkt Hannah Arendt 1965 in einer New Yorker Vorlesung über Fragen der Ethik und vor allem über das Böse nach. Eine Ethik »nach Auschwitz« kann, so Arendt, nur auf dem Denken und Erinnern gründen. Denn die größten Verbrecher sind, so sagt sie, diejenigen, die beides verweigern.
Ein wichtiger Text zu einem zentralen Thema im Werk Hannah Arendts wird hier erstmals auf deutsch zugänglich gemacht. Franziska Augsteins Nachwort »Taten und Täter« nimmt Arendts Argumentation auf und führt sie weiter zum Thema Widerstand.