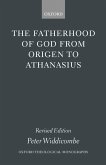Chesterton verteidigt die Tradition, das Wunder, die Phantasie und das Dogma, aber auf eine Art und Weise, die jedem Dogmatiker von Herzen zuwider sein muss; denn er beruft sich dabei einzig und allein auf die alltägliche Erfahrung, den common sense, die Vernunft und die Demokratie. Man kann sein Buch auch als die Autobiografie eines Abenteurers lesen, der mit zwölf ein Heide, mit sechzehn ein Agnostiker war und den einzig und allein sein wildes Denken zum Glauben führte. Chesterton wurde 1874 in London geboren und starb dort 1936. Er war Zigarrenraucher und Dialektiker, Vielschreiber und Gourmand. Er verfasste hundert Bücher.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Gilbert Keith Chesterton liebt Paradoxien, und weil die Welt, das Leben und das Christentum voller Widersprüche sind, passen sie für ihn auch so gut zueinander, berichtet Elmar Schenkel. Von "Orthodoxie" hat der Autor selbst gesagt, dass es sich um eine Art lapidarer Autobiografie handelt, verrät der Rezensent. So richtig klar wird dann aber nicht, ob es wirklich eine ist - nur die Themen arbeitet Schenkel deutlich heraus. Für Chesterton weist das ganze Dasein auf das Übernatürliche hin: Die Welt "ist erstaunlich, und es kann nur eine erstaunliche Religion sein, die dieser Absurdität standhält". Während der Autor sich über allerhand Irdisches und Überirdisches wundert, teilt er ordentlich nach allen Seiten aus, berichtet der Rezensent. Neobuddhisten aufgepasst, Naturanbeter, nehmt euch in Acht - aber auch Bänker und Philosophen bekommen ihr Fett weg, warnt Schenkel. Zum Glück gibt es den modernen agnostischen Leser, der sich auch über dieses Buch wundern kann, findet der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH