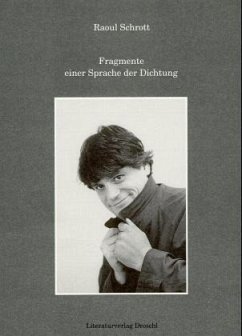Produktdetails
- Verlag: Literaturverlag Droschl
- 1997.
- Seitenzahl: 173
- Deutsch
- Abmessung: 210mm
- Gewicht: 288g
- ISBN-13: 9783854204718
- ISBN-10: 385420471X
- Artikelnr.: 08060495

Die einen haben Fackeln in der Hand, die andern Pfeile: Der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott erfindet sich und die Maschine der Poesie
Selten sah man einen solchen Überflieger. Auf einem Schiff zwischen Südamerika und Europa geboren, die Kindheit im Maghreb verbracht wie Albert Camus, die Jugend in Zürich, wo Elias Canetti und James Joyce starben - so beginnt ein literarischer Gesamtlebenslauf im Expreßverfahren.
Der junge Mann beginnt zu lesen, zunächst nur Asterix und Obelix, aber das gleich auf französisch. "Mit elf oder zwölf stieß ich auf die Surrealisten und auf Camus." Drei Jahre später entstehen die ersten Gedichte, für die Paul Celan die Vorbilder liefert. Und so geht das weiter: Erst wird der Nachwuchswettbewerb für Amateurmusiker in der Tiroler Provinz gewonnen, dann wird in Norwich, Berlin und Paris studiert.
Es folgen die Wanderjahre als Sekretär bei Philippe Soupault, damals dem letzten lebenden Surrealisten (das Vorbild könnte Rainer Maria Rilke als Sekretär bei Auguste Rodin gewesen sein oder Samuel Beckett bei James Joyce), als Buchhändler bei Shakespeare & Company in Paris und als Lektor am Istituto Orientale in Neapel. Dann habilitiert sich der Dichter, und am Ende heißt es: "Wenn er nicht auf Reisen ist, lebt er in Südfrankreich." Raoul Schrott ist heute dreiunddreißig, und daß sein Name wie der "nom de guerre" eines Dadaisten klingt, hat er selbst bemerkt.
Ein solcher Lebenslauf muß zu einem großen Buch führen. Bereits 1995, als der Roman "Finis Terrae" erschien, ließ sich ahnen, daß hier ein Talent am Werk war, das Bedeutendes vorhatte. "Die Erfindung der Poesie" heißt der Band, den Raoul Schrott jetzt in der "Anderen Bibliothek" herausgegeben hat. "Ein solches Buch hat es noch nicht gegeben", behauptet der Verlag. Es enthält alte und älteste Gedichte, Gedichte aus dem Sumerischen, dem Griechischen, Lateinischen, Arabischen, Keltischen, Hebräischen, Aquitanischen, Okzitanischen und Walisischen, alle gesammelt, übertragen und kommentiert von Raoul Schrott.
Daß ein junger Dichter so viele tote Sprachen beherrscht, fast so viele wie der romantische Poet und Übersetzer Friedrich Rückert in seinen reifen Jahren, ist nur die eine Verblüffung, auf die das Buch angelegt ist. Die andere besteht in der Unwahrscheinlichkeit, daß diese Gedichte so vertraut wirken. Raoul Schrott will keine historischen Rekonstruktionen präsentieren, sondern unerhörte Ausgrabungen vorstellen, uralte Fundstücke, die aber wirken sollen wie am ersten Tag.
"Varus du kennst ja diesen Suffenus ebenfalls ganz gut", dichtet bei ihm der Römer Catull fast hundert Jahre vor Christi Geburt, "ein intelligenter mensch sehr urban und eloquent." Das klingt erst einmal, als habe jemand unter den Trümmern des Forum Romanum eine Espressomaschine hervorgezogen. Doch es ist keine Torheit und hat eine eigene Tradition, wenn jemand alte Texte so zeitgemäß vorträgt: Den schnoddrigen Ton hat Ezra Pound den antiken Dichtern Euripides oder Properz schon vor fünfzig oder sechzig Jahren verliehen.
Raoul Schrott will mit einer Anthologie ein Weltbild verändern, und in seiner Idee ist mehr Vernunft, als man zunächst glauben möchte. In den vergangenen Jahrzehnten hat es viele Versuche gegeben, das Universum der Dichtung in Anthologien neu auszumessen: Walter Höllerer, Hans Magnus Enzensberger und Harald Hartung haben zu diesem Zweck ganze "Museen" und andere Sammlungen veröffentlicht. Zuletzt folgte Joachim Sartorius mit seinem 1995 erschienenen "Atlas der neuen Poesie". Dieser hatte sich zudem noch eine pädagogische Aufgabe gesetzt: die Vision einer postkolonialen Welt, eines Globus, auf dem jedes Land seine Dichter hat, weil es eine Poesie gib, die alle verbindet. Aber die Verhältnisse haben sich geändert. Heute gibt es zwar eine Weltliteratur, sie scheint jedoch wenig bedeutsam zu sein. Man kann vielleicht in einer Sprache sprechen, doch ist es nie die eigene eines anderen. Alles ist zugänglich, jeder ist für sich allein.
Dagegen setzt Raoul Schrott seine poetische Archäologie. Seine Karten unterscheiden sich sehr vom Weltatlas der zeitgemäßen Dichtung. Es sind historische und melancholische Karten, denn auf ihnen sind nur versunkene Länder eingetragen. Dabei stört es den Kartographen nicht, daß die meisten dieser weißen Flecken von den Philologen bis auf den letzten Zentimeter aufgenommen worden sind, hat doch in seinen Augen der akademische Betrieb den alten Gedichten die Poesie ausgetrieben. "Verschüttet" heißt eines seiner Lieblingswörter, und er meint damit den Staub der Philologen, der sich auf die Wahrhaftigkeit des Wortes gelegt hat. Bei Raoul Schrott ähneln die Gelehrten noch immer den Ärzten bei Molière. Das ist gewiß eine Übertreibung, aber man nimmt sie hin: "Wozu eine Polemik punktgenau ausfeilen, wenn schon ein erster Rundumschlag die Hälfte trifft?"
Vom Dunkel der Gelehrsamkeit befreit, torkelt Catull nun als unglücklicher, ironischer Liebhaber durch die Gassen und stößt dort auf eine Schlägerbande. Es sind Götter: "die einen hatten fackeln in der hand die anderen pfeile und / ein paar von ihnen ketten wie um mich zu fesseln / Aber alle waren nackt - da sagte einer von den wilderen: / Nehmt ihn euch vor - ihr kennt ihn doch genau . . ." Das klingt fast wie New York, spielt im alten Rom und ist eine Traumszene von Urlust und Schmerz.
Diese Gedichte können fünfhundert Jahre alt sein oder dreitausend, es ist im Grunde gleichgültig. Ihre Stelle in der Zeit spielt keine Rolle - nur: daß sie nicht in eine Tradition gehören und daß sie sich nicht dem modernen, nachromantischen Kunstverständnis fügen. Raoul Schrott hat nach Gedichten gesucht, die sich immer auch unmittelbar verstehen lassen, nach Werken, bei denen man nicht auf den Gedanken kommen muß, hier solle man nach poetischem Tiefsinn graben. Deshalb besteht er auch so auf dem Rhythmus, dem Klang und dem Reim, dem Gegentakt zum Lauf der Zeit. Er will etwas sehr Entferntes nahe heranrücken. Die Literatur kommt ihm dabei zu Hilfe. Denn noch immer spricht sie vom Krug und von der Waffe, vom Kuß und vom Bett, von der Natur, dem Kampf und der Liebe - man denke nur an Seamus Heaney. Einem fast dreitausend Jahre alten Gedicht, das so einfach redet, kann man im übrigen nicht vorwerfen, daß es kitschig sei. Darin liegt ein Nutzen dieser Fundstücke: "Und untergegangen ist der Mond mit / den pleiaden, versunken mitten im / dunkeln, aus der schale der nacht rinnt / die zeit und nur ich, ich schlafe allein." Das ist nicht Ingeborg Bachmann, sondern Sappho, und es klingt auf eine verwirrende Weise modern.
Diese Nähe ist vielleicht eine Illusion. Aber wenn man darauf vertrauen kann, daß die älteren Zeiten nicht die dümmeren gewesen sein müssen, mag ja einiges für diese unverhoffte Nachbarschaft sprechen: Der moderne Klang der Übertragungen von Raoul Schrott entsteht aus einer Ironie, die wir für eine Errungenschaft der neuesten Zeiten halten, die bei ihm aber von vornherein den Ton der Dichtung bildet. Da tritt zwar stets jemand auf, der "ich" sagt und Bilder für seinen Zustand sucht, der hadert und liebt und haßt und zweifelt. Aber dieses "ich" schwärmt nicht, es versucht nicht, sich einzunisten in Befindlichkeiten und Selbstvergewisserungen. Es ist eine vage, sehr brüchige Angelegenheit - stets setzt sich jemand einer Welt entgegen, die ihm bereits unmißverständlich klargemacht hat, daß er ihr herzlich gleichgültig ist: Von einem "Haus" dichten die irischen Mönche im neunten Jahrhundert: "ein haus in das kein regen rinnt / wo eine lanze nur ins leere fällt / und jeder tag an licht gewinnt / weil das dunkel keine wände hält."
Dieses "ich" ist bloß ein Bild, eine fixe Idee, die sofort zerfällt, wenn die Welt ihr widerspricht. Die Vorstellung, daß Dichten ein persönliches Verdienst sein könnte, ist ihm völlig fremd. Das ist vielleicht die größte Überraschung in diesem Rückblick auf die angeblichen Anfänge der Dichtung: daß es sich stets schon um reflektierte Dichtung gehandelt haben kann, daß das Naive vielleicht immer schon das Sentimentalische war. Bei dieser scheinbaren lyrischen Frühe handelt es sich offenbar schon um späte Zeiten, denn alles Raffinierte kommt spät.
Raoul Schrott, der jetzt alles neu machen will, hat sich die Kenntnisnahme der Literaturgeschichte nicht erspart, wie man an den Kommentaren zu den einzelnen Dichtern leicht erkennt. Und doch findet man Ungenauigkeiten in seinen Übersetzungen, Fehler sogar und sehr viele Übertreibungen. Guilhem IX, der Herzog von Aquitanien und erste Trobador, spricht in seinem zehnten Lied gewiß nicht davon, daß es sein "Schicksal" sei, nur vergeblich lieben zu können. Nur geht es ihm dauernd so, daß er, weil er nicht lieben kann, immer heftiger begehren muß. Sein Lied ist also noch mehr im Sinne des Übersetzers, als dieser es selbst glaubt. Aber es ist müßig, nach solchen Mängeln zu suchen - selbstverständlich muß Raoul Schrott hin und wieder den Preis für einen Anachronismus zahlen, und gegenüber den "Pomadenhengsten", die er bei Catull auftreten läßt, ist das Wort "Schnösel" wohl eher angebracht als bei Properz, wo er es unterbringt. Man könnte darüber staunen, wie selten ihm so schiefe Töne unterlaufen.
Und so entstehen aus alten Texten Gedichte, die gar keiner Zeit mehr angehören sollen. Raoul Schrott poetisiert, um zu aktualisieren, und dabei greift er auf, was man verstehen kann und was sich einem modernen Interesse fügt. Es bleiben Lücken, und man nimmt sie hin: Archilochos, der Dichter und Söldner aus dem siebten Jahrhundert vor Christus, macht immer wieder den Eindruck, hier spreche ein früher Rimbaud: "Die götter haben das letzte wort / sie heben dich in die höhe wenn / du auf der dunklen erde liegst / sie werfen dich auf den rücken / hast du erst einmal fuß gefaßt . . ." Die Lieder von Abu Nuwas - tausend Jahre alt ist dieser Mann und angeblich ein hübscher, wenn auch etwas dicker Kerl - erinnern sehr an den Stürmer und Dränger Carl Michael Bellmann: "Ganz dunkel ist er in seinem krug / der sonne ihr tiefroter atemzug / als sie vor mir ihr auge aufschlug / ein wein wie aus dem paradies." Und die Geschichte von Guilhem IX, dem Trobador aus dem frühen zwölften Jahrhundert, klingt schon fast nach Robin Hood. Ob das alles so richtig ist, weiß man nicht, aber es spricht auch wenig dagegen, daß Raoul Schrott die Lebendigkeit des Ausdrucks der Genauigkeit der Übertragung vorzieht. Wo ein Philologe den Rhythmus und den Reim dem Wortsinn opfert, wird es hier umgekehrt gemacht.
Raoul Schrott hat irgendwann das Singen zur Gitarre aufgegeben, obwohl er jenen "sehr lokalen Bandwettbewerb gewonnen" hatte. Ihm fehlte, so sagt er, die Stimme, die er für seine "chromatischen Akkorde" gebraucht hätte. So mag es sich zugetragen haben, auch wenn es keine solchen Akkorde gibt, weil sie wie eine Faust auf den Tasten klingen würden. Aber die Geschichte enthält auch ein Zitat: Als Friedrich Nietzsche den Lyriker definierte, erklärte er ihn zu einem Menschen, der "immer ,ich' sagt und die ganze chromatische Tonleiter seiner Leidenschaften und Begehrungen vor uns absingt".
Man findet diese Definition genau dort, wo Nietzsche in der "Geburt der Tragödie" Homer mit Archilochos vergleicht, den greisen Träumer mit dem "leidenschaftlichen Kopf des wild durchs Dasein getriebenen kriegerischen Musendieners". Auf wessen Seite Nietzsches Sympathien liegen, ist dabei ganz ohne Zweifel: beim Lyriker, dessen Ich "aus dem Abgrunde des Seins tönt" und "Bilderfunken" sprüht. Nur "subjektiv" - das sei der wahre Dichter nicht, dazu gehe es doch zu sehr um existentielle Fragen. Nietzsche erklärt hier das lyrische Ich für bedeutungslos, für unzuständig, um es mit dem Leben aufzunehmen. Diese Passage in der "Geburt der Tragödie" ist ein Manifest, und offenbar hat sich Raoul Schrott in die Idee hineingebohrt - mit großer Beharrlichkeit: Bereits der Roman "Finis Terrae" erzählt von einer Welt, in der es keine weißen Flecken und dunklen Stellen mehr gibt, und davon, wie es einem Archäologen gelingt, dennoch in einer Wüste zu verschwinden.
Man stößt bei Raoul Schrott auf viele verborgene Zitate aus dem Werk Friedrich Nietzsches. Dafür gibt es einen weiteren Grund: Auch Raoul Schrott ist ein entlaufener Philologe, einer, der einer fröhlichen Wissenschaft huldigen möchte. Manchmal blufft der Dichter wie ein Dandy im Salon, zum Beispiel, wenn er sich für seine abenteuerlichen Ahnenreihen darauf verläßt, daß niemand das alles gelesen haben kann: die Minnesänger zum Beispiel, die "wie der Archipoeta, Villon, Cecco Angiolieri, Hofmannswaldau, Carl Michael Bellmann, um nur einige zu nennen, eine verschüttete Literaturtradition verkörpern, die zuallererst das Leben betonen und dabei aus einem vollen Faß schöpfen". Die entlaufenen Philologen kennen sich an den Rändern besser aus als in der Mitte, dramatisieren gerne ihre Kenntnisse, und oft werden sie Hochstapler.
So hat Raoul Schrott den einzelnen Dichtern enzyklopädische Lebensbeschreibungen vorangestellt, obwohl er weiß, daß er poetische Aussagen nicht als Auskünfte über Dichter nehmen kann: Er hat seine Gestalten aus Gedichten herausgelöst und lebensähnlich gemacht, also weitgehend erfunden. Der Autor liebt die Übertreibung: "Der Graf von Poitiers war einer der nobelsten Edelleute und einer der größten Verführer." Die Geschichte der Lyrik wird hier zu einem Epos, für das die einzelnen Gedichte kaum mehr als Anhaltspunkte geben. Auch das ist die "Erfindung der Poesie" nach Raoul Schrott: In seiner poetischen Archäologie wird die Poesie in der Manier Erich von Dänikens als große webende Unbekannte suggeriert.
Woher kommt diese Leidenschaft für das Dunkle, Abgelegene, weit Entfernte? Wieso soll sich das Vorzeitliche und Periphere so weit über bekannte Traditionen und zentrale Überlieferungen erheben? Weil es im Unterschied zur Mitte noch frisch ist, weil es neu klingt, weil es einen gewaltigen Unterschied macht zur Geschichte der großen Werke, über die sich Deutung über Deutung schichtet. Raoul Schrott inszeniert eine Tiefe der Zeit und eine Weite des Raums, und dadurch wird das Universum sehr groß und sehr klein zugleich. In dieser fremden Welt kehrt der lyrische Dichter als Held zurück. Er ist vielleicht ein Schlawiner, und doch steht hier wieder einer für sich selbst. Und das geht so weit, daß Raoul Schrott mit seinen eigenen Figuren Mimikry treibt. Das sieht man am Lebenslauf des Überfliegers und auch an der seltsamen Eitelkeit, unter jeden biographischen Text den Namen des Ortes zu setzen, wo er geschrieben wurde - und wieder ist da die geheimnisvolle Geschichte von der Erfindung der Poesie:
Fortsetzung auf der folgenden Seite
Lissabon, Innsbruck, Stuttgart, Cape Clear, Berlin, Camoglie, Neapel, Santiago do Cacém . . . Ich war da, ich war in der freien Luft, ich war überall, sagt der Lyriker, der die Jahrtausende auf einen Punkt bringen will.
Der Atlas der alten Poesie zeigt hauptsächlich Wüsten. Zwischen einer Grabung und der nächsten liegen zuweilen Jahrhunderte und Tausende von Kilometern, und nur eine dünn gestrichelte Linie führt von einem Ort zum andern. Natürlich könnte man einwenden, man vermisse die mittelalterliche Mystik - aber was könnte man hier nicht alles noch vermissen? Daß Homer, Ovid und Vergil, Petrarca und Dante fehlen, daß die arabische Lyrik gegen die griechisch-römische Tradition aufgewertet wird, ist Programm: Es richtet sich gegen die Epik und nimmt Partei für das krude Leben. Es lehnt die Metropole ab und will die Provinz. Deswegen fehlt auch Horaz: Er war den Gärten Roms schon viel zu nahe gewesen, von der Stadt erscheinen nur die Hinterhöfe und dunklen Gassen, und dort sucht man das Eigentliche am ehesten. "Darin besteht für mich dichterisches Vermögen", erklärt Raoul Schrott und zitiert Niccolò Machiavelli, ohne ihn zu nennen: "der Göttin der Gelegenheit in die Haare zu greifen, in einem Moment - einem Blick, hier und jetzt, warum nicht - das Signifikante zu erkennen und daraus ein Gedicht werden zu lassen, den Augenblick festzuhalten, ohne ihn zu verändern." Natürlich ist das Willkür. Aber sie weiß, wo sie steht.
Friedrich Nietzsche ist der eine Geistesverwandte Raoul Schrotts. Der andere ist Johann Gottfried Herder, der Ethnologe der Dichtung, aber mit ihm verträgt sich der Erfinder der Poesie wesentlich schlechter - einer formalen Ähnlichkeit zum Trotz. Auch die "Stimmen der Völker in Liedern", Herders berühmtestes Buch, sind eine Anthologie. Dort steht das spanische Lied von "Zaidas trauriger Hochzeit" neben dem litauischen "Abschied eines Mädchens", der morlackische Gesang neben dem skaldischen "Hagelwetter". Poesie, behauptet Herder, lebe "im Ohr des Volkes, auf den Lippen und Harfen lebendiger Sänger: sie singt Geschichte, Begebenheit, Geheimnis, Wunder und Zeichen". Das hätte Raoul Schrott, freilich weniger pathetisch, auch sagen können. Aber er ist, obwohl die Sammlung einen solchen Eindruck machen kann, kein Ethnologe der Lyrik. Er begibt sich nicht auf die Suche nach Völkergedanken, er will keine Ursprachen erraten. Nicht umsonst ist Herders Impuls, der seinerzeit das Verständnis von Poesie so erschütterte wie Winckelmanns Umdeutung der Antike, eingefangen worden von Philologen und nationalen Hütern der Tradition. Poesie wurde als säkulare Offenbarung an die Wiege der Nationen gelegt. Raoul Schrott würde sagen, das habe sie um ihr lyrisches Potential gebracht. Sein globales Vagabundieren aber kommt im Augenblick der Erosion von Nationalliteraturen. Er hält sich an die Oberfläche, er paktiert mit der Verwirrung, und am Anfang war allenfalls Dada. Alles ist ihm gleich nahe zur Gegenwart, seine Trobadors sprechen unsere Sprache. Der Vagabund sucht die Gesellschaft seiner dionysischen Vorfahren. Denn er weiß ja nicht, wohin die Reise geht.
Es gibt eine Archäologie des Luftbilds. Denn manchmal erkennt man erst in einigem Abstand von der Erde die Mauern, die vor Jahrhunderten gezogen worden und heute von Schutt und Erde überdeckt sind. Der Überflieger ist ein solcher Archäologe. Er hat unter dem Müll der Zivilisationen etwas gesehen: eine "uralte Maschine, die zwar manchmal den Eindruck macht, als hätte ein Tinguely sie gebaut; ihre einzelnen Zahnräder und Teile unterscheiden sich indes kaum von modernen Uhrwerken". Es ist die Maschine der Poesie. Man weiß nicht, ob man das, was man von oben gesehen hat, in der Nahsicht wiedererkennt. Aber eines wird das, was man am Ende ausgräbt, nicht sein: ein lyrisches Ich.
Raoul Schrott: "Die Erfindung der Poesie". Gedichte aus den ersten viertausend Jahren. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1997. 536 S., geb., 58,- DM.
Raoul Schrott: "Fragmente einer der Sprache der Dichtung". Grazer Poetikvorlesung. Literaturverlag Droschl, Graz und Wien 1997. 176 S., br., 44,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main