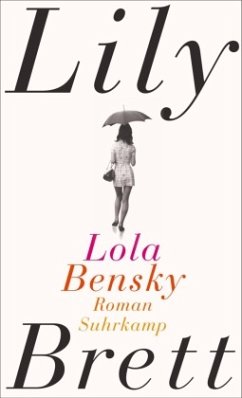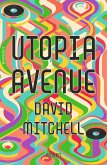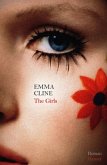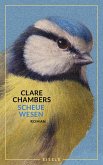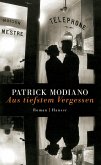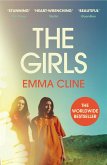Lola Bensky ist neunzehn, als Keith Moon von The Who vor ihren Augen die Hosen runterlässt und Cher sich ihre falschen Wimpern borgt. Es sind die Sixties, und Lola ist als Reporterin in London und New York unterwegs, um Interviews mit Musikern zu führen. Sie unterhält sich mit Mick Jagger über Sex und Diäten, mit Jimi Hendrix über Mütter, Gott und Lockenwickler. Ihre Leser sind vermutlich eher an Tratsch interessiert, aber Lola war schon immer etwas unkonventionell. Zum Glück ahnen ihre Eltern nichts davon, dass sie mit Menschen zu tun hat, die mit freier Liebe und Drogen experimentieren. Sie haben das Konzentrationslager überlebt, aber das würde sie ins Grab bringen. Und Lola fühlt sich schon schuldig genug, dass sie Übergewicht hat und keine Anwältin geworden ist. Doch sie ist fest entschlossen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
"Lola Bensky" ist ein hinreißend komischer und herzzerreißend menschlicher Roman über Neurosen und die Last der Vergangenheit. Und eine fulminante Hommage an die großen, verrückten Heldinnen und Helden der Sixties.
"Lola Bensky" ist ein hinreißend komischer und herzzerreißend menschlicher Roman über Neurosen und die Last der Vergangenheit. Und eine fulminante Hommage an die großen, verrückten Heldinnen und Helden der Sixties.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Gar nicht schlecht, wem die Erzählerin so alles begegnet. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Mick Jagger, Brian Jones und, und, und. Als junge Pop-Journalistin in Monterey. Die Holocaust-Vergangenheit der jüdischen Familie ist natürlich auch ein Thema, Rose-Maria Gropp kennt das aus anderen autobiografisch gefärbten Romanen Lily Bretts. Und genau da liegt das Problem für die Rezensentin: in der ununterscheidbaren Verschränkung von Fakten und Fiktion. Wer spricht?, fragt sich Gropp des öfterenen während der Lektüre. Und dann fragt sie sich auch, wieso Brett sich eigentlich versteckt hinter ihrer Figur und nicht ein paar Reportagen in die Maschine tippt. Schließlich seien all die anderen Figuren im Buch auch Personen der Zeitgeschichte, wie die Autorin selbst.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Dieser Roman ist ein feingesponnenes Gewebe, dem Achtung gebührt.«