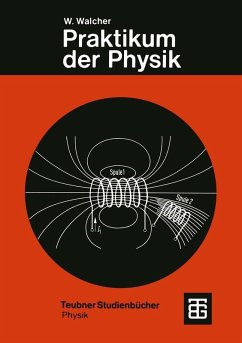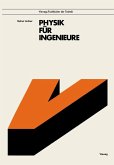Für Studierende der Physik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und der Medizin bietet dieses Buch eine ideale Einführung in das physikalische Praktikum.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.