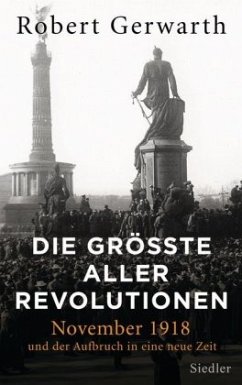Ein neuer Blick auf ein epochales Ereignis deutscher Geschichte
Die deutsche Revolution von 1918 - sie gilt noch heute als gescheitert. Eine verpasste Chance, die den Weg zum Aufstieg der Nazis und zur Katastrophe ermöglichte. Ein Fehlurteil, wie der renommierte Zeithistoriker Robert Gerwarth zeigt. Nicht nur zerschlug die Revolution die autoritäre Monarchie der Hohenzollern, sie schuf auf erstaunlich unblutige Weise den ersten deutschen demokratischen Nationalstaat. Gerwarth schildert die dramatischen Ereignisse zwischen den letzten Kriegsmonaten 1918 und dem Hitlerputsch 1923 und beschreibt dabei, wie grundlegend und nachhaltig die Novemberrevolution Deutschland veränderte. Denn wer das Geschehen nur vom Ende her betrachtet, ignoriert, wie sehr die Zukunft damals offen war.
Die deutsche Revolution von 1918 - sie gilt noch heute als gescheitert. Eine verpasste Chance, die den Weg zum Aufstieg der Nazis und zur Katastrophe ermöglichte. Ein Fehlurteil, wie der renommierte Zeithistoriker Robert Gerwarth zeigt. Nicht nur zerschlug die Revolution die autoritäre Monarchie der Hohenzollern, sie schuf auf erstaunlich unblutige Weise den ersten deutschen demokratischen Nationalstaat. Gerwarth schildert die dramatischen Ereignisse zwischen den letzten Kriegsmonaten 1918 und dem Hitlerputsch 1923 und beschreibt dabei, wie grundlegend und nachhaltig die Novemberrevolution Deutschland veränderte. Denn wer das Geschehen nur vom Ende her betrachtet, ignoriert, wie sehr die Zukunft damals offen war.

Die Republik von Weimar war gar nicht so schlecht, sagt Robert Gerwarth. US-Präsident Wilson war gar nicht so gut, sagt Eckart Conze.
Zwei Bücher über das Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren – und über Rassismus bei den Friedensverhandlungen in Versailles
VON FRANZISKA AUGSTEIN
Am 6. November 1918 reiste der spätere Reichskanzler Hermann Müller, ein Sozialdemokrat, mit der Eisenbahn in die Hafenstadt Kiel, wo Matrosen und Arbeiter seit einigen Tagen revoltierten. Im Zug wurde er von einem Seemann mit roter Armbinde, die ihn als Revoluzzer kenntlich machte, kontrolliert. Der Matrose ermahnte Müller: Sein Pass sei schon seit Monaten abgelaufen. Aha, machte Müller und wunderte sich im Stillen: „Wäre es in einem anderen Land denkbar gewesen, dass in der Nacht nach Beginn einer Revolution ein Revolutionär sich Sorgen um die Verlängerung eines Passes gemacht hätte?“. Wie der in Dublin lehrende Historiker Robert Gerwarth klarmacht, ist diese Episode bloß eine Schnurre während der brutalen Ereignisse von 1918 und 1919.
Am 9. November 1918 weckte die Berliner Gewerkschafterin Cläre Caspar-Derfert einen Genossen frühmorgens mit dem Ruf: „Steh auf, Arthur, es ist Revolution.“ Auch das nimmt sich im Nachhinein skurril aus. Wirklich bemerkenswert daran ist das Datum: Zunächst wurde in Wilhelmshaven und Kiel revoltiert; in München wurde König Ludwig III. gestürzt. Dann erst ging es in Berlin zur Sache. Für gewöhnlich beginnen Revolutionen in der Hauptstadt eines Landes. Auch in anderer Hinsicht findet Gerwarth die deutsche Revolution von 1918/19 ziemlich einzigartig – damit angefangen, dass sie viel erfolgreicher gewesen sei, als ihr nachgesagt wird. Gerwarth untermauert seine Meinung nicht mit neuen Erkenntnissen; er setzt darauf, eine schon früher vorgetragene Sichtweise zu akzentuieren. Das macht er auf eindrückliche, farbige Weise.
Weil die Revolution sich aus dem Ersten Weltkrieg ergab, beschreibt Gerwarth ausführlich und mit glücklichem Händchen für saftige Zitate die Haltung des Kaisers und seiner Generäle. Die Strategie des Deutschen Reiches ließ zu wünschen übrig: Permanent bemühte man sich, Aufrührer zu stärken: so etwa – vergeblich – die irischen Republikaner im Osteraufstand 1916 gegen die britische Regierung. Dschihadisten sollten im Nahen Osten gegen die Alliierten und ihre einheimischen Gewährsleute angehen. Man wähnte sich clever und sandte 3000 muslimische Kriegsgefangene aus Wünsdorf bei Berlin in ihre Heimat zurück, die aber – o Wunder – dort keine nennenswerte Zahl von Kämpfern mobilisieren konnten. Irrwitzig war die Annahme der Obersten Heeresleitung 1916, es sei egal, wann die USA sich an dem Krieg auf Seiten der Alliierten gegen die Mittelmächte beteiligen würden: Bis dahin habe man England längst besiegt.
Als die Niederlage Anfang Oktober 1918 unabwendbar war, hatten die arroganten deutschen Befehlshaber immerhin die Einsicht, dass Frankreich und Britannien gar nicht gut auf sie zu sprechen waren. Also wandten sie sich nur an den US-Präsidenten Woodrow Wilson, der – streng christlich erzogen – von einem „Verhandlungsfrieden“ ohne Sieger gesprochen hatte. Kurz bevor eine deutsche Note an Wilson abgeschickt wurde, versenkte ein deutsches U-Boot ein britisches Passagierschiff: 500 Zivilisten ertranken. Sie wurden – entgegen dem Seerecht und der Genfer Konvention – nicht gerettet. Der U-Boot-Krieg der Deutschen machte es Wilson nicht eben leichter, beim US-Kongress, bei den amerikanischen Wählern sowie den rachsüchtigen Franzosen und den nicht zuletzt um ihre Kriegsschulden besorgten Briten für Milde zu werben. Entsprechend hart sollten die Pariser Verträge für das Deutsche Reich und seine Verbündeten denn auch ausfallen.
Bis Ende 1918 hatte Frankreich, so Gerwarth, „ein Viertel seiner männlichen Bevölkerung zwischen 18 und 27 Jahren verloren“. Zwei Millionen deutsche Soldaten waren zu Tode gekommen. Ein Oberst berichtete kurz vor Kriegsende: „Allgemein kam zum Ausdruck, dass die Truppe nichts gegen ihren Kaiser habe, dass er ihr eigentlich ganz gleichgültig sei (. . .) Die Truppe ist total müde und abgekämpft.“ Die Heereskommandeure begriffen endlich, dass der Krieg verloren war. Die deutsche Admiralität indes wogte in überheblichem Stolz: Ende Oktober 1918 wollte sie die Flotte, die bis dahin militärisch unnütz und deshalb in den Häfen verblieben war, in einem letzten Aufgebot gen England schicken, um sie „ehrenvoll“ untergehen zu lassen. Die Matrosen, deren Untergang eingeschlossen war, machten nun nicht mehr mit. So begann die deutsche Revolution.
Was daraus wurde, zeichnet Gerwarth zu Recht in gutem Licht: Der Kaiser dankte ab; das Deutsche Reich wurde eine demokratische Republik mit dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert als ihrem ersten Präsidenten. Die Regierung von Weimar verabschiedete etliche fortschrittliche Gesetze: Frauen erhielten das Wahlrecht; nun gab es Tarifabschlüsse, die mit den Gewerkschaften ausgehandelt wurden; der Acht-Stunden-Tag wurde eingeführt. Kein anderes Land, so Gerwarth, habe aus dem Weltkrieg so viel gelernt und so bedeutsame Reformen auf den Weg gebracht. Zur Stabilisierung der Verhältnisse erhielten sechs Millionen demobilisierte Soldaten Anspruch darauf, ihren früheren Arbeitsplatz wieder einzunehmen. Den Beamten wurden ihre Einkommen garantiert, damit sie die Bürokratie am Laufen hielten.
Gerwarths Fazit: Die Weimarer Republik hätte Bestand haben können. Die Erzählung von der „todgeweihten“ Republik komme bloß zustande, wenn man in der Rückschau von der Machtübernahme der Nazis her denke. So gern man ihm da zustimmen würde, ganz plausibel ist das nicht. Sicher, die Weimarer Republik war seit 1923 recht stabil. Aber im Untergrund wirkten Fliehkräfte, gegen die keine gute Gesetzgebung und kein demokratischer Polizeichef ankommen konnten.
Die Weimarer Republik war innerlich zerrissen: Hier diese, die (wahlweise oder alles zusammen) dem Militarismus huldigten, dem Kaiserreich nachtrauerten, die geschwundene Macht Deutschlands beklagten, den Versailler Vertrag für ein Verbrechen an der deutschen Ehre hielten, Frauen als minderwertig betrachteten und sich Politik auch als Ausübung von physischer Gewalt vorstellten. Auf der anderen Seite standen jene, die für die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien votierten, denen die Reformen nicht weit genug gingen, die keinen Parlamentarismus wollten, sondern die Herrschaft von Arbeiter- und Soldatenräten, und die sich – ebenso wie ihre Gegner – Politik auch als Ausübung von physischer Gewalt vorstellten. Angesichts dieser Gemengelage und weil die Weimarer Verfassung fatalerweise vorsah, dass jede Partei, die mindestens 60 000 Stimmen erhielt, im Reichstag vertreten sein solle, war das Scheitern des Parlamentarismus abzusehen. Der Reichspräsident war als stabilisierende Kraft gedacht und mit übergroßer Machtfülle ausgestattet, was der Demokratie aber auch nicht gut tat. Hinzu kamen die drückenden Auflagen des Friedensvertrags von Versailles, von dem Zeitgenossen schon sagten: Unter diesen Bedingungen könne die deutsche Demokratie nicht dauern.
Mit den Ergebnissen aller Friedensverträge, die grosso modo als Versailler Vertrag bekannt sind, beschäftigt sich der Marburger Historiker Eckart Conze ausführlich in seinem anregenden Buch „Die große Illusion“, das von der „Neuordnung der Welt“ nach dem Ersten Weltkrieg handelt. Weil die USA als die einzig wahren Gewinner aus dem Krieg hervorgingen, gilt Conzes besonderes Interesse dem Präsidenten Woodrow Wilson. Der hatte in seinen „Vierzehn Punkten“ am 8. Januar 1918 das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ proklamiert. Das war es, was den marxistischen Historiker Eric Hobsbawm bewog, Wilson als den schlechtesten aller US-Präsidenten zu bezeichnen. Den Präsidenten Trump konnte Hobsbawm, der 2012 verstarb, nicht mehr erleben (und ob jener dem Üblen, das George W. Bush mit dem Irak-Krieg 2003 anrichtete, eins draufzusetzen vermag, bleibt – trotz aller Anzeichen – noch abzuwarten). Conze sind marxistische Allüren fremd, aber auch er hält Wilsons Vision für verfehlt. Conze schreibt: „Dass Demokratisierung und Nationalisierung den Frieden in Europa und der Welt sicherer machen würden, war eine der großen Illusionen von 1919.“
Der christliche Wilson war verliebt in die Vorstellung, die Völker sollten über ihr Schicksal selbst bestimmen. Allerdings galt das nur für die weiße – zivilisierte – „Rasse“. In seiner Jugend war der Südstaatler von Sklaven umgeben. Daraus schloss der gläubige Woodrow: Gott habe diesen Leuten die Position gegeben, die ihnen fromme. Rassismus sollte, wie Conze lapidar anmerkt, bei den Friedensverhandlungen in Paris „durchaus eine Rolle spielen“. Da war etwa die Delegation von Nguyen Ai Quoc, der später als Hô Chí Minh berühmt wurde. Der studierte junge Mann war – ungebeten – nach Paris gekommen, um Wilson eine Bittschrift zu übergeben: Vietnam sei von Kolonialmächten besetzt. Alles Vertrauen setze man in den Präsidenten der Vereinigten Staaten, seinem Volk die Freiheit zu geben. Conze merkt an: Nicht bekannt sei, ob Wilson diese Schrift überhaupt gelesen hat. In seinen Erinnerungen schrieb Hôồ Chí Minh: „Es war Patriotismus und nicht der Kommunismus, der mich veranlasste, an Lenin zu glauben.“
Niederschmetternd nimmt sich auch aus, was Conze von den Bemühungen der Delegation aus Afrika erzählt. Afrikaner waren nicht nach Paris eingeladen, aber da der amerikanische Präsident doch „Selbstbestimmung“ ganz groß schrieb, reisten sie auf eigene Faust und stellten am 21. Februar 1919 einen Kongress auf die Beine. Neun afrikanische Länder waren vertreten. „Weit entfernt von radikalen Forderungen, trat dieser Kongress für moderate Reformen“ ein, schreibt Conze: Es ging bloß um „kleine Schritte in Richtung Selbstverwaltung“. Die Delegierten erklärten, dass viele Afrikaner es gutheißen würden, „sich einer durch den Völkerbund ausgeübten Zivilisierungsmission zu unterziehen“. War diesem bescheidenen Ansinnen ein Echo beschert? Ja, der afrikanische Organisator des Kongresses wurde während seines Aufenthalts in Paris von amerikanischen Geheimdienstleuten „auf Schritt und Tritt“ überwacht.
Demütigungen waren auch den Vertretern von Korea und China beschieden. Japan war damals eine starke Militärmacht; also schenkte man als unwichtig betrachteten Ländern wie China und Korea, die mit Japan im Konflikt standen, kein Gehör. Conze und mit ihm seine Leser denken: Weitsichtig haben die Großmächte damals in Paris nicht agiert.
Es drehte sich alles um nationale Interessen der führenden Mächte. Völlig selbstlos war Wilsons Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker übrigens nicht: Der damit verbundene weltweite, liberale Internationalismus sollte sich, so Conze, selbstverständlich unter der Vorherrschaft der USA abspielen. Wilsons Vorstellung vom Selbstbestimmungsrecht blieb hingegen allzu vage. Der damalige Außenminister Robert Lansing fragte hilflos: „Was für eine Einheit“ habe Wilson denn „im Kopf? Meint er eine Ethnie, meint er ein territoriales Gebiet oder meint er eine Gemeinschaft?“ Auf jeden Fall werden seither Gewalt und Krieg gern mit der Idee vom Selbstbestimmungsrecht legitimiert. Mit Wilsons Erklärung, so Conze, „war der Geist aus der Flasche“. Und heutige nationalistische Bestrebungen in europäischen Ländern werden mit dazu passenden „verharmlosenden Tarnvokabeln wie ,Selbstbewusstsein‘ und ,nationales Interesse‘“ vorangetrieben – auf Kosten Europas.
Kein anderer Staat habe
aus dem Weltkrieg so viel
gelernt wie Deutschland
Afrikaner, Vietnamesen, Japaner,
Koreaner – alle fanden bei den
USA kein Gehör
Robert Gerwarth:
Die größte aller
Revolutionen. November 1918 und der Aufbruch
in eine neue Zeit. Aus dem Englischen von Alexander Weber. Siedler-Verlag,
München 2018. 384 Seiten, 28 Euro.
Eckart Conze:
Die große Illusion.
Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt.
Siedler-Verlag, München 2018. 560 Seiten, 30 Euro.
Schleifmaschine,
die eine asymmetrische
Politur kleiner
Objekte ermöglicht, 1998.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Wie Friedrich Ebert die revolutionäre Energie kanalisierte: Robert Gerwarth deutet den Umsturz im November 1918
Zehn Jahre nach Revolution und Republikgründung klagte Kurt Tucholsky in der "Weltbühne" über das Auseinanderklaffen von "Ideal und Wirklichkeit". In dem so betitelten Spottgedicht hieß es: "Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Republik . . . und nun ists die! Man möchte immer eine große Lange, und dann bekommt man eine kleine Dicke - Ssälawih!" Bei aller Kritik, die Tucholsky an der Weimarer Republik übte, hätte er als prinzipieller Anhänger der Demokratie wohl kaum bestreiten mögen, dass die "kleine Dicke" einen großen Fortschritt gegenüber den politischen Zuständen des Kaiserreichs bedeutete. Robert Gerwarth jedenfalls kann der "kleinen Dicken" einiges abgewinnen. Dies fällt ihm umso leichter, als er schon dem "großen Dicken" Anerkennung zollt.
So mag man in Anlehnung an Tucholskys satirische Zeilen, ohne Gewähr für genaue Werte zum Body-Mass-Index, die Leitfigur des revolutionären Übergangs von 1918/19 nennen: Friedrich Ebert. Rund um seine Person entflammten von Anfang an Kämpfe zur Deutung der Novemberrevolution. Früh galt er seinen Feinden zur Rechten als Vaterlandsverräter, der durch illoyales Handeln an der "Heimatfront" mitverantwortlich für das deutsche Kriegsdebakel sei. Seine Gegner zur Linken schmähten ihn als Arbeiterverräter, der Rätemodelle abgelehnt, mit den alten Eliten paktiert habe und vor dem Einsatz militärischer Gewalt gegen Teile der Arbeiterbewegung nicht zurückgeschreckt sei.
Gerwarth dagegen lobt Ebert, der an der Spitze einer unerfahrenen Regierung und unter ungünstigen Ausgangsbedingungen Beachtliches geleistet habe. Ihm sei das "Kunststück" geglückt, die "revolutionäre Energie zu kanalisieren" und Deutschland in eine parlamentarisch-demokratische Ordnung mit einer liberalen Verfassung zu überführen. Er bevorzugte den Weg der Reform gegenüber einer grundstürzenden Revolution, die ihn Unordnung und Chaos, gar "russische Verhältnisse" befürchten ließen.
Diese waren seit 1917, als die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten und eine Avantgarde von Berufsrevolutionären in Russland den Bolschewismus an die Macht beförderte, kein Hirngespinst, sondern eine reale Gefahr. Vor diesem Hintergrund interpretiert Gerwarth das oft zitierte Diktum Eberts von der Revolution, die er wie die Sünde hasse, nicht als konservative Beharrlichkeit, sondern als Ablehnung einer "kommunistischen Revolution", die auf Gewalt und die Herrschaft einer Minderheit setzte.
Eine verzerrende Sichtweise erkennt der Dubliner Historiker auch in der These, Ebert habe mit seiner Begrüßung der Frontsoldaten vor dem Brandenburger Tor am 10. Dezember 1918 mit den Worten "kein Feind hat Euch überwunden" die "Dolchstoßlegende" befördert. Nach seiner Ansicht zielte Ebert vielmehr darauf, die Kriegsheimkehrer "für das neue Regime" einzunehmen. Schließlich hält Gerwarth es für abwegig, in Absprachen zwischen der Übergangsregierung und der Obersten Heeresleitung - in einem Telefonat zwischen Ebert und dem Ersten Generalquartiermeister Wilhelm Groener am 10. November 1918 - einen "faustischen Pakt" auszumachen. Nüchtern nennt er diesen Vorgang stattdessen eine "pragmatische Übereinkunft" aus beiderseitig nachvollziehbaren Gründen.
Wer darin eine unkritische Darstellung gegenüber dem Rückgriff auf militärische Kräfte seitens der Regierung ab der Jahreswende 1918/19 erkennen möchte, täuscht sich allerdings. Hart geht Gerwarth mit Gustav Noske, der sich selbst als "Bluthund" bezeichnete, und mit den von ihm eingesetzten Freikorps ins Gericht. Wie sehr deren Sitten verrohten und sie zu blutigen Exzessen neigten, die der Bezeichnung eines "weißen Terrors" durchaus entsprachen, verdeutlicht Gerwarth am Beispiel marodierender Freischärler im Baltikum.
Eine andere Frage ist, ob die Erkenntnisse über Gewalthandlungen in den Bruchzonen des alten Imperiums sich ohne weiteres auf die Verhältnisse in den Zentren des Deutschen Reichs übertragen lassen. Neuere Studien zur frühen republikanischen Wehrpolitik fordern eine differenziertere Betrachtung und warnen davor, die Selbstheroisierungen von während der NS-Zeit verfasster autobiographischer Freikorpsliteratur als Tatsachenberichte zu übernehmen. Als einer der besten Kenner gewaltgeschichtlicher Prozesse in den Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs ist Gerwarth vor solchen Kurzschlüssen gefeit. Diese neue Dimension politischer Gewalt hat der Autor vor wenigen Jahren in seinem viel beachteten Werk "Die Besiegten" genau dargelegt.
Immer wieder leuchten seine früheren Ausführungen in das neue Buch hinein und erhellen so die deutschen Ereignisse mit international vergleichenden Überlegungen. Die deutsche Entwicklung gerät zugleich in ein milderes Licht, in dem die Auswüchse einer brutalen physischen Gewalt vergleichsweise gering ausgeprägt erscheinen. Auch widerstand die Weimarer Demokratie trotz des Versailles-Traumas einer autoritären Kehre besonders lange. Wer über die Binnenperspektive der gemäßigten deutschen Revolution hinausblickt, das ist eine zentrale These Gerwarths, wird ihre Errungenschaften deutlicher sehen und ihre Versäumnisse weniger stark ins Gewicht fallen lassen.
Auf die alte Streitfrage nach versäumten Möglichkeiten und besseren Alternativen einer ungeschehenen Geschichte lässt er sich nicht ein. Das ist wohltuend: eine schnörkellose Darstellung ohne ständiges Hätte, Wenn und Aber. Von einer retrospektiven Geschichte im Wunschmodus, wie er gerade Revolutionsdeutungen prägt, hält Gerwarth wenig. Die Erwartungen, Hoffnungen und Enttäuschungen der Zeitgenossen dagegen kommen bei ihm deutlich zur Geltung. Nicht zuletzt intellektuelle Zeitdiagnostiker, die er ausgiebig zitiert, lassen ein lebendiges Zeitkolorit entstehen - ob Harry Graf Kessler, Victor Klemperer, Alfred Döblin oder Thomas Mann, vor allem aber Käthe Kollwitz, deren feinfühligen, skrupulösen Tagebuch-Notizen eine Quelle von hervorragendem Wert sind. So sehr die Künstlerin ihre Argumente mit Bedacht hin- und herwendete, begrüßte sie doch den Wandel, war froh über das Ende des Krieges, freute sich über das neue Frauenwahlrecht und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Dass sie Zeugin einer Revolution geworden war, daran bestand für sie kein Zweifel.
Aber war es die "größte aller Revolutionen", wie der einem berühmten Zitat des liberalen Journalisten Theodor Wolff entlehnte Buchtitel suggeriert? Gerwarth weicht einer direkten Antwort aus, liefert jedoch in der ausführlichen Einleitung eine Reihe von Anhaltspunkten dafür, in dem Umbruch 1918/19 eine bedeutende Revolution zu erkennen. Er nennt das hohe politische wie auch ein beachtliches - von ihm nur angedeutetes - soziales und kulturelles Veränderungspotential, schließlich das im grenzüberschreitenden Vergleich geringe Gewaltniveau. Zugleich sensibilisiert diese Studie dafür, Revolution in modernen Gesellschaften nicht vorrangig über bewaffnete Aufstände und Barrikadenkämpfe zu definieren. Eigentlich revolutionär erscheint vielmehr die Einführung und Durchsetzung neuer politischer Prinzipien, erweiterter Partizipations- und Bürgerrechte.
Die Weimarer Verfassung fixierte sie und gab so der "wohl fortschrittlichsten Republik der Zeit" in einem Dokument Ausdruck: einer Republik, die als "Triumph des Liberalismus" doch ein zu überschwängliches Lob erfährt. Entgegen manch späterer Behauptung war sie aber keineswegs wehrlos, wie Gerwarth zu Recht in seinem Ausblick bis 1923 betont. Am Ende dieses Krisenjahres habe Deutschland in eine unvorhersehbare Zukunft geblickt.
Weimar als entwicklungsoffene Angelegenheit, das ist so etwas wie der neue historiographische Deutungskonsens zur Novemberrevolution - einer Revolution, um die weniger hitzig als in früheren Jahren gestritten wird. Die Offenheitsthese ist dabei so offen, dass sie nicht für eine neue Meistererzählung taugt. Gerwarth strebt sie erst gar nicht an, beschränkt sich stattdessen auf einen "synthetisierenden Debattenbeitrag". Der allerdings bietet gut lesbare Orientierung, vermittelt zeitgenössische Stimmungsbilder und gewichtet die deutschen Vorgänge im internationalen Kontext.
ALEXANDER GALLUS
Robert Gerwarth: "Die größte aller Revolutionen". November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit.
Siedler Verlag, München 2018. 384 S., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Alexander Gallus schätzt Robert Gerwarths Darstellung der Revolution von November 1918 als lesbare Orientierung mit lebendigen Stimmungsbildern, etwa durch die O-Töne von Döblin bis Kollwitz, und die Gewichtung der deutschen Lage im internationalen Zusammenhang. Dass der Autor Weimar als ergebnisoffene Sache betrachtet, ohne daraus ein neues Narrativ zu formulieren, gefällt Gallus. Dass Deutschland bei Gerwarth in milderem Licht erscheint und er nicht nach versäumten Chancen fahndet, findet der Rezensent in Ordnung. Dafür bekommt er auch ein schärferes Bild der zeitgenössischen Erwartungen und Enttäuschungen und kann Revolution künftig anders definieren denn als bewaffneten Aufstand, als politische Bürgersache nämlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein sehr lesenswertes und leicht zu lesendes Buch... Das Einweben von Zeitzeugenberichten wie den Tagebüchern von Käthe Kollwitz oder Victor Klemperer ist ein großer Gewinn.« WDR 3 Mosaik
»Gerwarth bietet gut lesbare Orientierung, vermittelt zeitgenössische Stimmungsbilder und gewichtet die deutschen Vorgänge im internationalen Kontext.« Frankfurter Allgemeine Zeitung