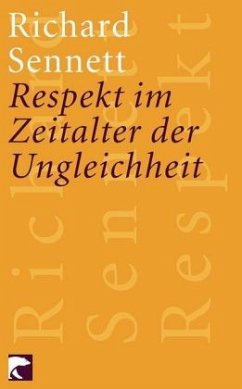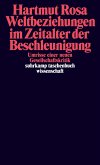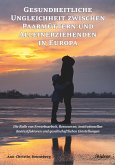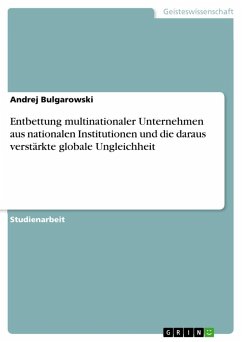Macht’s Buh: Richard Sennett ruft nach Respekt
Schön war die Kindheit, als wir noch Königen gleich im Schilfe saßen und Welten erfanden. Wir wussten, dass der Phantasie keine Grenze gesetzt ist. War das Leben auch karg, wir ließen uns rühren von der „lust an fremder pracht und ferner tat”: Sehr gerne denken Erwachsene an das zurück, was war und alles hätte werden können. Sind die Erwachsenen Lyriker, gedeihen mitunter aus den Sentimentalitäten unsterbliche Gedichte; Stefan George hat es bewiesen. Sind die Erwachsenen Soziologen, bringt der Garten der Nostalgie unreife Früchte hervor; Richard Sennett beweist es mit seiner verschämten Autobiographie „Respekt”.
Ein Melodram ist dieser Stoff: Ein Junge aus der Armensiedlung schafft den Absprung, weil er meisterhaft Cello spielt. Mit elf Jahren komponiert er, gibt Konzerte, übt fünf Stunden täglich. Er beherrscht das Vibrato und empfindet „eine tiefe Freude, die ganz in sich ruht”. Die große Karriere ist nur eine Frage der Zeit. Dann schlägt das Schicksal zu: Eine Operation soll die zunehmende Starre der linken Hand beseitigen. Operation misslingt, Karriere fällt aus. Abspann.
Euer Nacktbad, Herr Nachbar
Wenn Richard Sennett sich heute über sein Leben beugt, hat er dennoch wenig Grund zur Klage. Nicht musikalischen Fähigkeiten, wohl aber analytischen Fertigkeiten machten aus dem Ghettokind eine Berühmtheit. Die Einsichten zur Zeit liefert seit den siebziger Jahren zuverlässig Mister Sennett aus Chicago. Mit dem „Flexiblen Menschen” gelang ihm der Sprung aus der kapitalismuskritischen Wissenschaftsprosa in das Pantheon der geflügelten Worte. Das unerreichte Hauptwerk „Die Tyrannei der Intimität” verband 1974 breiten historisches Wissen mit quicklebendiger Alltagsschläue. Beide Bücher fragen nach dem Status der Person im Kontext ihrer Vergesellschaftung. Der Neoliberalismus, der die allzeit flexiblen, immer mobilen Arbeitnehmer ihrer Lebensgeschichte beraubt, besiegelt demnach den Tod einer ehemals zivilisierten Welt. Deren Untergang begann mit der „Besessenheit von der Intimität” und mit der „Verdrängung der res publica durch die Annahme, gesellschaftlicher Sinn erwachse aus dem Gefühlsleben der Individuen”.
Wer mag es dem linken Kulturkritiker verdenken, dass er im Herbst eines ertragreichen Intellektuellenlebens die „eigene Erfahrung zum Ausgangspunkt für die Erforschung eines umfassenden sozialen Problems” machen will? Wer mag es ihm verwehren, sich zu fragen, wie man „die Grenzen der Ungleichheit in wechselseitigem Respekt überschreiten” kann? Natürlich niemand, und darum erfährt nun die Welt, dass Richard Sennett vier Jahre lang in einer Chicagoer Armensiedlung lebte, dass seine Mutter ihn alleine erzog, dass sein kommunistischer Onkel im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte, dass der kleine Richard knöcheltief im „Gefühlssumpf” watete, vor allem aber, dass die Hippies der sechziger Jahre selbstbezügliche Narren waren, weil „sozialer Jazz keine Bindung schafft”.
Auch der junge Mister Sennett genoss die „Gegenkultur”, war „Nacktbaden, LSD-Erfahrungen und Freizeitprotesten” nicht abgeneigt. Heute weiß er, dass die „persönliche Befreiung” gefährlich war, da sie die Privilegien ausblendete, die solch eine wohlfeile Revolte erst ermöglichten. Von marxistischer Warte aus geißelt Sennett den Hedonismus der Apolitischen und gelangt zu konservativen Schlussfolgerungen: „Niemand kann ein wirklich neues Leben anfangen, wenn er die Vergangenheit hasst.” So dreht sich letztlich eben alles im Kreis, das Rechte und Linke, das Gedachte und Gefühlte, und nur ein Kretin könnte den Kopf, der solches denkt, für den Urheber des Ringverkehrs halten.
Die Hippies mag Sennett also nicht, ebenso wenig eine liberale Elite, die mit dem Loser wenig anzufangen weiß, und schon gar nicht die vermeintlichen Reformer des Sozialstaats. Was er mag, ist das Auf und Ab der Begriffsketten. Zwar wird ihm dabei manchmal fast so dumm, als ginge ein Mühlrad in seinem Kopf herum, doch auch dem Kinde, erinnert er sich, wird alles zum Rätsel, und es empfindet Glück dabei, so will also auch Sennett glücklich spekulieren.
Ungleich an Talent, Einkunft oder Herkunft waren die Menschen schon immer. Da zwischen Mitgefühl und Ungleichheit einerseits, zwischen Fürsorge und Bevormundung andererseits ein prekärer Zusammenhang besteht, ist Solidarität unter Ungleichen kaum möglich. Schnell „verursacht Ungleichheit Unbehagen” bei denen, die der Ungleichheit abhelfen wollen und deren Tun herablassend wirken kann; der Sozialhilfe haftet der Makel des widerwillig gegebenen Almosens an. Sennett empfiehlt, in jeder menschlichen Beziehung Respekt walten zu lassen, den anderen auch da zu akzeptieren, wo man ihn nicht begreift. „Die hartnäckige Tatsache der sozialen Trennung”, lautet der letzte Satz, „bleibt gleichwohl ein Problem der Gesellschaft”.
Nach Dutzenden zählen die Probleme, die Sennett benennt, um sie als unerledigt in dem großen Zettelkasten abzulegen, den dieses Buch darstellt. Immer wieder singt der Autor das hohe Lied der „Achtung vor den Bedürfnissen anderer”. Ein hehres Ziel, gewiss. Doch wenn es stets aufs neue von dem Eingeständnis begleitet wird, das Rätsel namens Wirklichkeit sei zu groß für jede Erkenntnis, zu komplex für praktische Handlungsanweisungen, dann reduzieren sich 350 Seiten auf eine fatale These: Wie man’s macht, man macht’s verkehrt. Mit sauertöpfischer Miene schließt Mister Sennett seine Selbstbefragung ab. Das Wunderkind lässt sich entschuldigen, die Welt erfindung wurde abgesagt. Im Schilf ist es zu feucht für Soziologen, und nur Dichter tragen reuelos die Krone ihrer Sendung.
ALEXANDER KISSLER
RICHARD SENNETT: Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff. Berlin Verlag, Berlin 2002. 344 Seiten, 19,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Der Sozialstaat ist nicht nur für Wirtschaftsliberale anstößig. Auch liberale Linke, die für Umverteilung Sympathien hegen, können sich nur schwer damit abfinden, daß staatliche Fürsorge Abhängigkeiten schafft, die der Autonomie des Individuums zuwiderlaufen.
"Sozialhilfe ist ein Synonym für Demütigung", schreibt der amerikanische Soziologe Richard Sennett in seinem jüngsten Buch. Schlimmer noch: Sozialhilfe macht die Menschen zu bloßen Zuschauern ihrer eignenen Bedürfnisse, über welche die anderen besser Bescheid zu wissen vorgeben. Liberale und Linke kaprizieren sich deshalb zuweilen gemeinsam auf ein garantiertes Bürgergeld als Antwort auf die Falle demütigender Abhängigkeit. Doch ein Ausweg kann das nicht sein: Das Bürgergeld setzt falsche Anreize und hält die Menschen in der Bedürftigkeit. Deshalb, sagen andere, wäre es besser, ihnen den Weg zurück in die Arbeitswelt mit diskretem Zwang anzuempfehlen.
Sennetts Antwort ist das nicht. Er argumentiert weder systemtheoretisch noch ökonomisch, sondern sozialpsychologisch: Selbst wenn Ungerechtigkeiten verschwinden, Ungleichheiten wird es immer geben - man denke nur an die angeborenen Ungleichheiten unterschiedlicher Begabungen. Doch Ungleichheiten werden in den humanen Rahmen gerückt, wenn die Menschen einander mit Respekt anerkennen und dadurch Selbstachtung gewinnen.
Sennett entwickelt seine sozialpsychologische These aus der Erzählung autobiographischer Erfahrung: Der Geschichte seines eigenen sozialen Aufstiegs aus Cabrini Green, einer Sozialsiedlung in Chicago. "Ich hatte zwar nicht den Respekt vor den Zurückgelassenen verloren, doch mein eigenes Selbstwertgefühl basierte auf der Tatsache, daß ich sie hinter mir zurückgelassen hatte." Solche biographische Ehrlichkeit ist die Stärke von Sennetts Buch.
Der theoretische Ertrag bleibt freilich vergleichsweise mager. Eine Sozialpsychologie der Anständigkeit haben die Vorläufer - von Hannah Arendt bis Avishai Margalit - besser formuliert. Und eine Theorie der Ungleichheit - unter amerikanischen Ökonomen derzeit breit diskutiert - vermißt man bei Sennett komplett. Das Buch enttäuscht deshalb, trotzt aller anschaulicher Narrativität.
ank.
Richard Sennett: Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Berlin Verlag, 19,19 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Er streicht die Praxis des Respekts als zentralen Ausgangspunkt für sozialen Frieden heraus - eine wichtige Anregung für den Umgang mit Flucht und Migration.", Die Presse, Astrid Kury, 12.12.2015