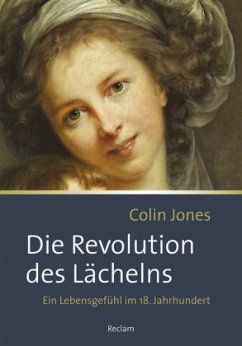Kurz vor der großen, die Weltgeschichte prägenden Französischen Revolution vollzieht sich im 18. Jahrhundert eine kleine, unauffällige und kurzlebige Revolution, die gleichwohl tiefe Einblicke in Mentalität und Denken der Zeit erlaubt: Allenthalben in der zivilisierten Welt, in den besseren Kreisen und vornehmen Gesellschaften wird plötzlich gelächelt, und zwar freundlich und empfindsam. Uns kommt das heute natürlich vor, es war aber nichts weniger als das.
Warum das ehemals nur sardonische, ironische oder überhebliche Lächeln des Absolutismus im Zeitalter von Vernunft und Aufklärung seine Bedeutung änderte, was genau das mit der Verbreitung des Zuckers und den Fortschritten der Zahnheilkunde zu tun hatte, wie es damit traurig endete im grimmen Ernst der politischen Revolution und was uns dieses Detail über den Wandel im Körper- und Lebensgefühl der Zeit offenbart, das erzählt der britische Historiker Colin Jones in diesem überraschenden Buch.
Warum das ehemals nur sardonische, ironische oder überhebliche Lächeln des Absolutismus im Zeitalter von Vernunft und Aufklärung seine Bedeutung änderte, was genau das mit der Verbreitung des Zuckers und den Fortschritten der Zahnheilkunde zu tun hatte, wie es damit traurig endete im grimmen Ernst der politischen Revolution und was uns dieses Detail über den Wandel im Körper- und Lebensgefühl der Zeit offenbart, das erzählt der britische Historiker Colin Jones in diesem überraschenden Buch.

Paris als Geburtsort der modernen Zahnmedizin: Colin Jones zeigt, wie das Jahrhundert der Aufklärung an der Seine zu lächeln lernte. Und wie es ihm wieder verging.
Der Londoner Historiker Colin Jones, Verfasser von Abhandlungen mit so verlockenden Titeln wie "Pulling Teeth in Eighteenth-century Paris" und "The King's Two Teeth", hat ein besonderes wissenschaftliches Interesse für die Geschichte der Zahnmedizin im Paris des achtzehnten Jahrhunderts. Als ihn ein Freund auf Élisabeth-Louise Vigée-Le Bruns berühmtes Selbstporträt mit ihrer Tochter (1786) aufmerksam machte, war er sofort elektrisiert, denn ein derart gewinnendes Lächeln, das zwischen den geöffneten Lippen herrlich weiße Zähne sehen lässt, hatte er auf einem französischen Porträt des achtzehnten Jahrhunderts noch nicht gesehen. Als er erfuhr, dass Vigée-Le Bruns Gemälde gerade deshalb, weil sie auf ihm dem Publikum lächelnd die Zähne zeigte, bei seiner Ausstellung im Pariser Salon 1787 von der Kritik ein eklatanter Verstoß gegen den guten Geschmack vorgeworfen wurde, war die Idee zum vorliegenden Buch geboren.
In ihr verbindet sich das Interesse des Kulturhistorikers an der Geburt des "weißen Lächelns" in der Malerei des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts mit demjenigen des Medizinhistorikers an dem prächtigen Gebiss der Malerin, das sich offensichtlich in derart gutem Zustand befand, dass es dem Bild als besonderer Glanzeffekt eingesetzt werden konnte. Der Medizinhistoriker weiß aber aus den Befunden der Friedhofsarchäologie, dass aufgrund des rapide gestiegenen Zucker- und Tabakkonsums "in der gesamten Geschichte der Menschheit die Zähne noch nie in einem so schlechten Zustand gewesen waren" wie im Jahrhundert der Aufklärung. Das waren keine guten Voraussetzungen, um ein Lächeln aufzusetzen, denn es hätte in der Regel doch nur dentale Trümmerstätten oder leere Mundhöhlen enthüllt.
Wie das achtzehnte Jahrhundert dennoch zu lächeln lernte, zeigt Colin Jones in so amüsanter wie überraschungsvoller Verschränkung geschmacks- und kunstgeschichtlicher, medizin- und kulturhistorischer Perspektiven. Dabei konzentriert er sich, worüber der Untertitel der deutschen Ausgabe ärgerlicherweise hinwegtäuscht (die Originalausgabe hat den Titel "The Smile Revolution in Eighteenth Century Paris"), ganz auf Paris. Das gibt ihm die Möglichkeit, den Gegensatz von Hof und Stadt in der Geschichte des Lächelns voll zur Geltung zu bringen.
Am absolutistischen Hof Ludwigs XIV. herrschte in der Tradition der höfischen Verhaltenslehren der Renaissance unbedingte Affektkontrolle; hier wurde nicht gelacht und kaum gelächelt. Das laute Lachen war eine Angelegenheit von Bauern und Idioten; der Aristokrat dagegen lächelte allenfalls mit geschlossenem Mund, und er nutzte dies Lächeln als Mittel der sozialen Hierarchisierung: als spöttisches Lächeln von oben herab, das als sardonisches Lächeln - so benannt nach einer sardischen Giftpflanze, die den Mund vor dem Eintreten des Todes zu einem bitteren Grinsen verzieht - in die Literatur einging. Weil sich am Hof nie die Münder zu einem Lächeln öffneten, konnte dort auch bis zum Ende des Ancien Régime nie ein zahnmedizinisches Interesse aufkommen - mit drastischen Konsequenzen, von deren noch drastischerer Behebung Jones so kenntnisreich zu berichten weiß, dass dem Leser das Lächeln gefriert.
Während am Hof die Lippen verschlossen blieben, vollzog sich in der Stadt seit der Jahrhundertmitte jene "Revolution des Lächelns", die Jones' Buch seinen Titel verliehen hat: die Entwicklung einer bürgerlichen Gefühlskultur im Zeichen der Empfindsamkeit und des Vernunftoptimismus der Aufklärung, die den Menschen nach dem Muster der Helden und vor allem Heldinnen der Romane Marivaux', Richardsons und Rousseaus ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Es war dies ein sozial egalisierendes Lächeln, freundlich und tugendhaft ausgetauscht in einer "klassenlosen Konjunktur des Fühlens". Und es war, wie Voltaire es genannt hat, ein "Lächeln der Seele", das das Innere eines Menschen, sein wahres Selbst, unverstellt zum Ausdruck brachte.
Wer aber so seelenvoll und so schön lächeln wollte wie Richardsons Pamela oder Rousseaus Julie, der brauchte gute Zähne. Und hier nun kommt der Medizinhistoriker ins Spiel: In Paris entstand, beginnend mit Pierre Fauchard, dem Schöpfer des Wortes "Dentist", die moderne Zahnmedizin, deren Ziel nicht mehr die Entfernung, sondern die Erhaltung der Zähne bildet. Paris wurde die Hauptstadt der Zahnheilkunde; die Nachfrage nach einem lächelnden Mund brachte, wie Jones materialreich zeigt, die Entwicklung einer "neuen Technologie des Gesichts" mit sich: "Paris wurde zur Heimstätte einer Art Proto-Industrie des Lächelns", deren Protagonisten die modernen Zahnärzte waren. Mit der Revolution des Lächelns vollzog sich der unaufhaltsame Aufstieg der Zahnbürste, und während Vigée-Le Brun das Porträt ihres lächelnden Selbst malte, erfand der Zahnarzt Dubois de Chémant das künstliche Gebiss aus Porzellan. Colin Jones' Pointe: "Aus heutiger Sicht könnte man Madame Vigée-Le Brun fast für das Aushängeschild der Pariser Zahnheilkunde halten."
Seine Geschichte hat aber auch eine tragische Pointe. Als 1789 die Revolution ausbrach, fand die Revolution des Lächelns trotz ihres sozial egalisierenden Prinzips für immer ihr Ende. Das empfindsame Lächeln war auf Mäßigung und Ausgleich zwischen den Menschen gerichtet, und das war dem republikanisch-tugendstolzen Stoizismus der Revolutionäre verdächtig. Auch Robespierre benutzte eine Zahnbürste, aber gelächelt hat er, der auf den reinigenden Ernst der Guillotine vertraute, nie. Gelächelt haben hingegen, wie Jones, gestützt auf viele Augenzeugenberichte, in einer bewegenden Sequenz zeigt, viele Aristokratinnen auf dem Weg zur Guillotine - um so zu sterben wie Rousseaus Julie: "ein Lächeln auf den Lippen und die Augen voller Tränen". Das Lächeln, so Jones in einer letzten affektgeschichtlichen Pointe, "hatte die politische Seite gewechselt".
Natürlich ist die Geschichte des Lächelns im Europa des achtzehnten Jahrhunderts in ihren ideen- und affektgeschichtlichen Voraussetzungen viel komplexer und voraussetzungsreicher, als Jones sie in seinem erhellend und quellennah erzählten Buch nachzeichnet. Seine Verbindung von Medizin- und Affektgeschichte funktioniert dennoch erstaunlich überzeugend, gerade weil er sich auf das Beispiel von Paris konzentriert und damit die Stadt wie ein Laboratorium der Gefühle rekonstruieren kann, in dem sich komplizierte Prozesse modellhaft beobachten lassen.
Für eine Geschichte des Lächelns im Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts stünde ebenfalls viel Material bereit; immerhin hat Anton Graff, der große Porträtist der Aufklärung, jedem ihrer Protagonisten nicht nur einen Tränenstrich ins Auge, sondern auch ein Lächeln auf die Lippen gemalt. Aber die Geschichte des Lächelns, das den Affekt der Freude mit der Vernunft physiognomisch zum Ausgleich bringt, lässt sich im Falle der deutschen Aufklärung nicht ohne den Anteil der Theologie erzählen, die bei Jones keine Rolle spielt. Man kann das im Werk Friedrich Gottlieb Klopstocks erkennen, in dessen Poesie das Lächeln schon deshalb eine Konjunktur erlebte, weil es den Einklang der Seele mit der göttlichen Schöpfungsordnung zum Ausdruck bringt: "da du aus Gottes Hand / Mit deinem Lächeln heiter gebildet kamst".
ERNST OSTERKAMP
Colin Jones: "Die Revolution des Lächelns". Ein Lebensgefühl im 18. Jahrhundert. Aus dem Englischen von Ursula Blank-Sangmeister unter Mitarbeit von Anna Raupach. Reclam Verlag, Stuttgart 2017. 325 S., geb., 34,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der britische Historiker Colin Jones erzählt, wie Dentisten und Künstler dem „weißen Lächeln“
im Paris des 18. Jahrhunderts zum Triumph verhalfen
VON STEFFEN MARTUS
Noch bevor der Mensch ein einziges Wort artikuliert, kommuniziert er in der ansteckenden Sprache des Lächelns. Die Muskulatur für diesen Gesichtsausdruck bildet sich bereits im Mutterleib heraus und ist von Geburt an funktionsfähig, Kinder sind auf Kooperation angewiesen. Im Verlauf des Lebens werden Syntax und Vokabular des Lächelns dann immer reichhaltiger. Dass wir biologisch über das Vermögen verfügen, ist daher nur die eine Seite, die andere, wie es in einer Kultur der feinen Unterschiede eingesetzt wird: Ob wir herablassend oder schüchtern lächeln, wohlwollend oder heimtückisch, ob die Lippen dabei geschlossen bleiben oder die Zähne aufblitzen. Von dieser besonderen Form des „weißen Lächelns“ erzählt der englische Historiker Colin Jones mit großer Eleganz und deutet es als Zeichen der Aufklärung im Paris des 18. Jahrhunderts.
Der Ansatzpunkt ist denkbar einfach: Wer ein weißes Lächeln zeigen möchte, muss überhaupt noch Zähne haben. „In Europas traditioneller Zahnkultur war Zahnlosigkeit im Erwachsenenleben“ jedoch „ein Faktum, das galt für die mächtigsten Könige ebenso wie für die geringsten ihrer Untertanen“. Ein weißes Lächeln lässt daher auf einen gewissen Lebenswandel schließen, auf Sorgfalt für den eigenen Körper und die Pflege seiner Bestandteile, auf Trink- und Essgewohnheiten, und nicht zuletzt auf die Vermögensverhältnisse, denn gute Zahnmedizin kostet Geld. Zudem war das Lächeln in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sozial noch fest in ein zeremonielles Verhältnis zur Gesellschaft eingepasst; die gravitätischen Mienen bei Hof gaben den guten Ton an. Im Verlauf der Aufklärung verwandelte sich dann aber das Lächeln – vermittelt über die Empfindsamkeit – zu einem Ausdruck authentischer, unverstellter Individualität sowie natürlicher Sozialneigung. Eine Pointe der großen Erzählung von Jones liegt darin, dass die Etablierung des weißen Lächelns für einen kurzen historischen Moment mit der französischen Revolution koinzidierte, bevor ernsthafte Sittenwächter diese „neue Technologie des Gesichts“ sehr schnell wieder geächtet haben und zum „Gesichtskodex“ des Hofs zurückgekehrt sind. Dennoch: Muss es gleich eine „Revolution des Lächelns“ sein, wie der Titel der Studie verkündet?
Jones fasst literarische Texte oder Verhaltensvorschriften oft als direkte Hinweise auf Verhaltenspraktiken auf und rechnet einzelne Quellen zu allgemeinen Diagnosen hoch. Er folgt dabei einer eher konventionellen Epochendramaturgie: Die Aufklärung kulminiert in Frankreich gewohnheitsmäßig in der Revolution des Jahres 1789. Und so muss auch das Lächeln einen Aufstand gegen das Ancien Régime, die verknöcherten Sitten des Hoflebens in Versailles und der Kirche, bedeuten. Der zeremonielle Ernst beider Institutionen sei durch das Lächeln im Kern bedroht worden. Am Ende des Jahrhunderts habe sich das urbane Leben in Paris dann von diesen Bevormundungen emanzipiert. Die bürgerliche säkulare Kultur demonstrierte so lächelnd ihren Eigensinn. Jones’ differenzierte Darstellung der Quellen lässt jedoch eher auf Konstellationen schließen, in denen das Lächeln stets eine Option war. Die Materialien fügen sich nicht glatt in die lineare Erzählung vom anfangs verpönten und allmählich rehabilitierten Lächeln, das auf dem Höhepunkt der Geschichte Zähne zeigte.
Zum einen beschreibt Jones einen internationalen Trend. Vergnügen, Glückseligkeit oder Freude sind Leitparolen der europäischen Aufklärung. Das Spannungsfeld von Versailles und Paris verweist mithin auf allgemeinere Veränderungen der Sozialstruktur und taugt nur bedingt zur Erklärung der historischen Entwicklungslogik. Zum anderen sind die Belege für das „weiße Lächeln“ relativ spärlich und zum Teil uneindeutig. Zeigt die Mutter auf Jean-Baptiste Greuzes berühmter Darstellung einer Geburtsszene ein Lächeln oder nicht doch eher Zeichen erschöpfter Entspannung? Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, die Lieblingsmalerin von Marie Antoinette, machte das weiße Lächeln kurz vor der französischen Revolution tatsächlich zu einem provokativen Markenzeichen. Warum aber zauberte dann Jacques-Louis David 1795 ein weißes Lächeln auf das Antlitz der von ihm porträtierten Madame de Sériziat? Zu einem Zeitpunkt, als der Revolutionsterror diesen Gesichtsausdruck wieder verdächtig gemacht und gerade David, der Lieblingsmaler Robespierres, den „würdevollen Gesten“ zu neuem Ansehen verholfen haben soll.
Selbst wenn die große Erzählung nicht so ganz funktioniert, rekonstruiert Jones ein überaus erhellendes Kapitel der Kulturgeschichte. Er verzahnt im wahrsten Sinn des Wortes diverse Entwicklungen, die in ihrer Wechselwirkung auf einen tief greifenden Wandel verweisen. Das „weiße Lächeln“ war eine „Gemeinschaftsproduktion“, in der die enthusiastische Kultur der Empfindsamkeit sich mit der nüchternen Zahnmedizin verbündete. Lange Zeit über war die Behandlung von Zahnschmerzen eine Domäne von Scharlatanen oder Marktschreiern gewesen, die ihr Geschäft mit schauspielerischem Talent inszenierten. Das privilegierte Mittel war nicht der Zahnerhalt, sondern die Extraktion auf offener Straße mit reger Anteilnahme des Publikums. Der neue Zahntechniker zeichnete sich hingegen nicht durch körperliche Kraft, sondern durch technisches Geschick aus, das er in einem Behandlungsraum hinter geschlossenen Türen zur Geltung brachte.
Der „Dentist“ arbeitete effizient und legte Wert auf seine wissenschaftliche Qualifikation, die er auch in Publikationen unter Beweis stellte. Er baute den Markt für Prophylaxe und Zahnpflege auf und verbesserte die operativen Techniken, vom Ersatz einzelner Zähne bis hin zur Verfertigung kompletter Prothesen, für die seit 1788 das von Dubois de Chémant entwickelte Porzellangebiss zu Verfügung stand. Dieses Ensemble von institutionellen, habituellen und technologischen Innovationen verhinderte künftig ein Schicksal wie das Ludwigs XIV., dem aus Versehen bei der Extraktion schmerzender Zähne zugleich ein großer Teil des Kiefers entfernt wurde – dem König sprudelte nach diesem Eingriff beim Trinken die Flüssigkeit „wie eine Fontäne aus seiner Nase hervor“.
Auch der neue Typus des Zahntechnikers kann jedoch nichts daran ändern, dass die französische Aufklärung das Lächeln nur für kurze Zeit zum Ausweis sensibler Menschlichkeit machte. Am Schluss berichtet Jones vom Niedergang der Kultur des Lächelns im Zuge der französischen Revolution, der neuen Ernsthaftigkeit des 19. Jahrhunderts und vom Comeback des weißen Lächelns im 20. Jahrhundert. Hier aber stand es nicht mehr im Zeichen der Aufklärung, sondern des Konsums, der Massenmedien und eines Starkults, der seinen Glanz nicht zuletzt der amerikanischen Zahnindustrie verdankt.
Colin Jones: Die Revolution des Lächelns. Ein Lebensgefühl im 18. Jahrhundert. Übersetzt von Ursula Blank-Sangmeister und Anna Raupach. Reclam Verlag, Stuttgart 2017. 325 Seiten, 34 Euro.
Der Scharlatan brauchte
körperliche Kraft, der
Zahntechniker vor allem Geschick
Sind so weiße Zähne: Stiche nach Jean-Baptiste Greuzes Gemälde „Épiphanie“ konnten in zahnärztlichen Vorzimmern die Kunden ermutigen.
Foto: mauritius images/Alamy
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de