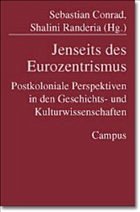
Jenseits des Eurozentrismus
Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
In Europa bleibt das Reden über die eigene Gesellschaft nach wie vor einem methodologischen Nationalismus verhaftet. Die vielfachen Verflechtungen und Austauschprozesse zwischen europäischen und außereuropäischen Ländern geraten selten in den Blick. Der vorliegende Band lädt dazu ein, die europäische Geschichte im Kontext von Kolonialismus und Imperialismus neu zu denken, und öffnet den Blick auf transnationale und postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften.Rezension:Verflechtungsgeschichten statt NationalgeschichteIn Europa bleibt das Reden über die eigene...
In Europa bleibt das Reden über die eigene Gesellschaft nach wie vor einem methodologischen Nationalismus verhaftet. Die vielfachen Verflechtungen und Austauschprozesse zwischen europäischen und außereuropäischen Ländern geraten selten in den Blick. Der vorliegende Band lädt dazu ein, die europäische Geschichte im Kontext von Kolonialismus und Imperialismus neu zu denken, und öffnet den Blick auf transnationale und postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften.
Rezension:
Verflechtungsgeschichten statt Nationalgeschichte
In Europa bleibt das Reden über die eigene Gesellschaft nach wie vor einem methodologischen Nationalismus verhaftet. Der Band bietet Ansätze, die europäische Geschichte im Kontext von Kolonialismus und Imperialismus neu - transnational - zu denken.
Der Wandel der Herrschaftsverhältnisse im Zuge der Globalisierung wird von Michael Hardt Hardt und Toni Negri als "Empire" gekennzeichnet, um mit diesem Begriff den Unterschied zum Imperialismus alter Prägung zu markieren. Auf der anderen Seite wird, insbesondere von weiten Teilen der nichtwestlichen Welt, das "global governance" gerade als Fortsetzung des Imperialismus, als Re-Kolonialisierung begriffen. So unterschiedlich die Deutungen auch ausfallen - die aktuelle Globalisierungsdebatte kann doch dazu beitragen, neue Perspektiven auf eine imperiale Vergangenheit zu eröffnen, die nach wie vor ihre Schatten auf die Gegenwart wirft.
Die Autoren des Bandes diskutieren Ansätze, die aus postkolonialer Sicht den Blick auf die Verwobenheit der europäischen Welt lenken. Es wird eine Kritik an der Vorstellung formuliert, dass die europäische/westliche Entwicklung abgekoppelt vom 'Rest' der Welt verlaufen sei und daher aus abendländischen Besonderheiten heraus verstanden werden könne. Stattdessen wird in den Beiträgen die spätestens seit dem 19. Jahrhundert unauflösbare Verflechtung der europäischen und außereuropäischen Welt zum Ausgangspunkt einer Geschichtsschreibung gemacht, die sich nicht mehr in nationalen Teleologien verdichtet. Denn transnationale Beziehungen kennzeichneten nicht nur das Verhältnis Europas zu den außereuropäischen Kulturen, sondern waren gleichermaßen typisch für die innereuropäische Konstellation bzw. die Interaktion nichtwestlicher Gesellschaften untereinander.
Aus der Sicht von Historikern, Soziologen, Politologen, Ethnologen, Indologen und Kulturwissenschaftlern wird der Versuch unternommen, die Geschichts- und Kulturwissenschaften transnational zu erweitern, um die häufig unterrepräsentierten Aspekte innereuropäischer Vergangenheit wieder stärker zu berücksichtigen.
Rezension:
Verflechtungsgeschichten statt Nationalgeschichte
In Europa bleibt das Reden über die eigene Gesellschaft nach wie vor einem methodologischen Nationalismus verhaftet. Der Band bietet Ansätze, die europäische Geschichte im Kontext von Kolonialismus und Imperialismus neu - transnational - zu denken.
Der Wandel der Herrschaftsverhältnisse im Zuge der Globalisierung wird von Michael Hardt Hardt und Toni Negri als "Empire" gekennzeichnet, um mit diesem Begriff den Unterschied zum Imperialismus alter Prägung zu markieren. Auf der anderen Seite wird, insbesondere von weiten Teilen der nichtwestlichen Welt, das "global governance" gerade als Fortsetzung des Imperialismus, als Re-Kolonialisierung begriffen. So unterschiedlich die Deutungen auch ausfallen - die aktuelle Globalisierungsdebatte kann doch dazu beitragen, neue Perspektiven auf eine imperiale Vergangenheit zu eröffnen, die nach wie vor ihre Schatten auf die Gegenwart wirft.
Die Autoren des Bandes diskutieren Ansätze, die aus postkolonialer Sicht den Blick auf die Verwobenheit der europäischen Welt lenken. Es wird eine Kritik an der Vorstellung formuliert, dass die europäische/westliche Entwicklung abgekoppelt vom 'Rest' der Welt verlaufen sei und daher aus abendländischen Besonderheiten heraus verstanden werden könne. Stattdessen wird in den Beiträgen die spätestens seit dem 19. Jahrhundert unauflösbare Verflechtung der europäischen und außereuropäischen Welt zum Ausgangspunkt einer Geschichtsschreibung gemacht, die sich nicht mehr in nationalen Teleologien verdichtet. Denn transnationale Beziehungen kennzeichneten nicht nur das Verhältnis Europas zu den außereuropäischen Kulturen, sondern waren gleichermaßen typisch für die innereuropäische Konstellation bzw. die Interaktion nichtwestlicher Gesellschaften untereinander.
Aus der Sicht von Historikern, Soziologen, Politologen, Ethnologen, Indologen und Kulturwissenschaftlern wird der Versuch unternommen, die Geschichts- und Kulturwissenschaften transnational zu erweitern, um die häufig unterrepräsentierten Aspekte innereuropäischer Vergangenheit wieder stärker zu berücksichtigen.




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.01.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.01.2003