Satz gibt die Tonart vor. Erstens klingt das so, als würde hier nicht Text produziert, sondern in beinahe mündlichem Gestus der geneigten Zuhörerschaft eine Geschichte zum Besten gegeben. Zweitens wird mittels des besitzanzeigenden Fürworts gleich ein Sympathieverhältnis begründet; Kälte als gefühlte Temperatur zeitgemäßer Prosa bleibt außen vor. Drittens hat dieser Harry, der uns nahegehen soll, nicht gerade einen Trendberuf. Da er ein Junior ist, muß es auch einen Senior geben: Familientradition scheint eine Rolle zu spielen. Alles Dinge, die im durchschnittlichen Poproman nicht vorkommen. Und viertens wird dann sogar noch eine Moralkurve hin zum "ziemlich" Guten gezogen - als wär's eine Moritat, an der wir uns ein Beispiel nehmen sollen.
Kurzum: Capus schreibt selbstbewußt an allen Trends vorbei. Während die moderne Literatur das monadische Individuum zur Grundfigur gemacht hat, ist der Horizont seines Erzählens das Gemeinwesen - die Kleinstadt, wo es noch eine allgemeinverbindliche Rollenzuweisung gibt. Sein Seldwyla, sein Winesburg/Ohio heißt Olten; die Zwanzigtausend-Seelen-Gemeinde, in der er heute lebt, ist das reale Vorbild für die Kleinstädte seiner Bücher.
Harry Widmer spielt den Part des Wichtigtuers und Provinzcasanovas. Am Stammtisch im "Rathskeller" treffen sich alle, die sich im Städtchen als Entscheidungsträger fühlen, die Bau- und Gewerbemafia, ein paar Lehrer und Redakteure. Mitten unter ihnen, Runden schmeißend, der Besitzer von "Harrys crazy bike corner". Den zugkräftigen Namen hat er dem alten Fahrradladen und Schraubenfriedhof seines Vaters verpaßt; auch sonst fühlt er sich zu Höherem berufen. Doch dann überzieht Harry den Kredit, verprellt die Lieferanten, und die fortan nur noch als "Sauhunde" bezeichneten Freunde aus dem "Rathskeller" wenden sich von ihm ab. Als dann auch noch seine neue Liebe, die Thai-Schönheit Nancy, unmißverständliche Zeichen der Schwangerschaft zu erkennen gibt, brennt der Boden. Harry setzt sich ab nach Mexiko. Dort, am Pazifischen Ozean, macht er zunächst genauso weiter wie bisher - nur daß sein Laden jetzt "Haroldos crazy surf corner" heißt. Erst allmählich sprengt der "ziemlich gute", fürsorgliche Kern die egoistische Schale und beginnt zu treiben.
In der Fremde lernt Harry, daß eigentlich die ganze Welt eine Kleinstadt ist: Überall gibt es einen "Rathskeller", auch wenn er nicht so heißt, und darin den entsprechenden Stammtisch mit den ortsansässigen Wichtigtuern. Vor allem wird in Harry zur eigenen Überraschung die Heimatverbundenheit wach. Er abonniert unter fremdem Namen das Blättchen seines Kaffs und liest es jeweils mit einer Woche Verspätung, dann aber um so neugieriger - um über das Treiben der "Sauhunde" auf dem laufenden zu bleiben, deren Machenschaften er sich aus den Andeutungen der Meldungen gut zusammenreimen kann. Er versteht sich nun mal auf seinesgleichen.
Nach sechs Jahren wagt er die Rückkehr zu Frau und Kind. Und darf feststellen, daß die Kleinstädter auch ihn nicht vergessen haben. Obwohl er doch meinte, seine Spuren gut verwischt zu haben, wird er gleich vom ersten Passanten gefragt: Na, wie war's in Mexiko? Man weiß von seinem Surfbrettverleih und sogar von dem beleuchteten Haifisch auf dem Dach. Daß da jemand in Mexiko das Blättchen abonnierte, war eben doch sehr verdächtig. Bald war Harry Stadtgespräch - und Mexiko einmal sogar das Karnevalsmotto. Schließlich kommen sich auch Harry und seine Thailänderin wieder nahe. Aber dann gibt Capus der Geschichte noch eine kleine, unerwartete Wendung, um der Falle Happy-End zu entkommen.
Die kleine und die weite Welt, der einzelne und die Gemeinschaft - das sind Motive dieser humoristischen Läuterungsgeschichte, einfach und gradlinig erzählt, mit dem berechtigten Vertrauen auf genaue Beobachtung, Menschenkenntnis und Situationskomik. Man mag einwenden, daß das anekdotisch portionierte Erzählen von Capus eine Neigung zu absehbaren Pointen hat. Wie er jedoch das Leben in dem mexikanischen Küstenort schildert, der halbjährlich vom amerikanischen Dollarsegen heimgesucht wird, wie er vor allem Harrys Rückkehr ins Städtchen in Szene setzt: das bietet mehr als Klischees und ist ein Lesevergnügen.
Wer das Negative schätzt, wird sich an der alles durchdringenden Liebenswürdigkeit dieses Erzählens stören. Zwar möchte man denken: Wenn Harry am Ende gut wird, muß er wohl mal schlecht gewesen sein. Aber so schlecht kann keiner sein, daß er beim Menschenfreund Capus nicht doch als im Grunde sympathischer Bursche daherkäme. Zwar gibt es auch in Harrys Geschichte dunkle Momente. Seine Mutter, eine allzu schweigsame Hausfrau, geht eines Tages in den Wald und hängt sich auf. Das ist hart. Aber wie es beschrieben wird, wirft es dann doch gleich wieder eine kleine Pointe ab.
Vor allem fehlen dem Buch die Leerstellen, das Unerklärte, auf das sich der Leser erst einen Reim machen müßte - wie in "Fast ein bißchen Frühling", diesem lakonischen und etwas unheimlichen kleinen Roman, der sich weniger den Oltener Alltagsbeobachtungen als der literarischen Rekonstruktion von Archivmaterial verschrieben hatte. Man wünscht sich, daß Capus öfter mal Urlaub von seinem Seldwyla nehmen würde, um mit solch abgründigen Geschichten zurückzukehren.
WOLFGANG SCHNEIDER.
Alex Capus: "Glaubst du, daß es Liebe war?" Roman. Residenz Verlag, Salzburg 2003. 189 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
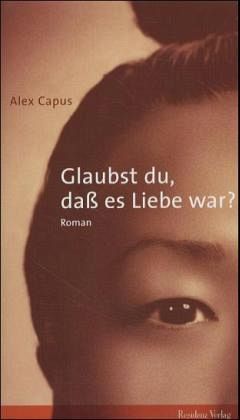




-ya.jpg)
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.10.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.10.2003