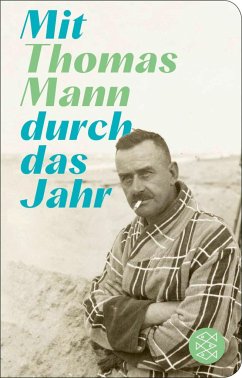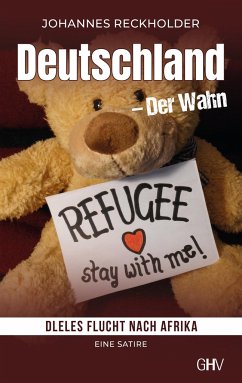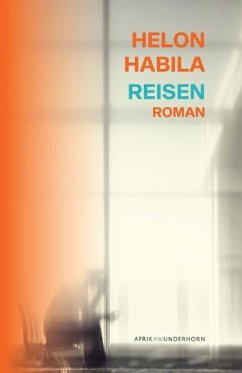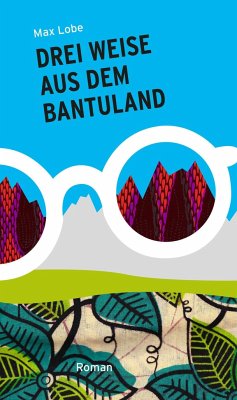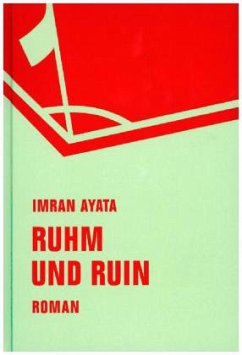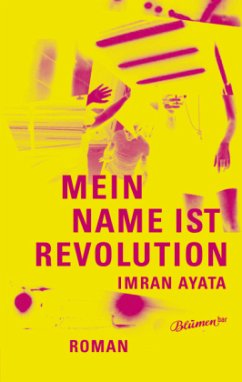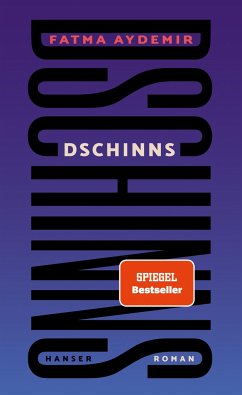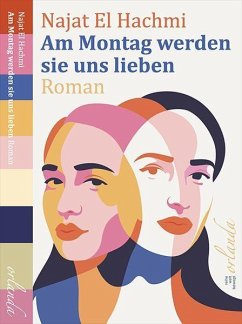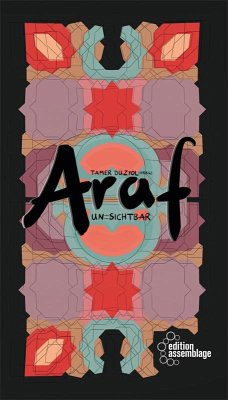Maxi Obexer reist in der Zeit der großen Flüchtlingsbewegungen, also dem »längsten Sommer«, wie diese Zeit vielfach genannt wurde, aus Südtirol in ihren Wohnort Berlin, um endlich ihren deutschen Pass zu erhalten. Sie merkt wieder:Auch sie ist eine Migrantin, innerhalb Europas, und sie war und sie wird immer eine Migrantin bleiben. Gleichzeitig beobachtet sie Flüchtlinge im Zug, die nicht so einfach die Grenzen passieren dürfen. Diese Beobachtung bietet ihr einen Anlass dazu, in ihrem eigenen Leben sowie in Geschichten, die sie recherchiert hat, über den Zusammenhang von Nationalität...
Maxi Obexer reist in der Zeit der großen Flüchtlingsbewegungen, also dem »längsten Sommer«, wie diese Zeit vielfach genannt wurde, aus Südtirol in ihren Wohnort Berlin, um endlich ihren deutschen Pass zu erhalten. Sie merkt wieder:Auch sie ist eine Migrantin, innerhalb Europas, und sie war und sie wird immer eine Migrantin bleiben. Gleichzeitig beobachtet sie Flüchtlinge im Zug, die nicht so einfach die Grenzen passieren dürfen. Diese Beobachtung bietet ihr einen Anlass dazu, in ihrem eigenen Leben sowie in Geschichten, die sie recherchiert hat, über den Zusammenhang von Nationalität und »Daseindürfen« zu reflektieren.
Maxi Obexer wurde 1970 in Brixen, Südtirol, Italien, geboren und studierte Literaturwissenschaft, Philosophie und Theaterwissenschaft in Wien und Berlin. Bereits während ihres Studiums wurde sie für ihre ersten Theaterstücke ausgezeichnet. Heute ist sie freischaffende Autorin von Theaterstücken, Hörspielen, Essays, Erzählungen und Reportagen.Ihr Stück »Die Liebenden« (1999) produzierte sie als Hörspiel im WDR, viele Hörspiele folgten. Für ihr Stück »Illegale Helfer«, das im Sommer 2016 uraufgeführt wurde, erhielt sie den Robert Geisendörfer Preis und den Eurodram-Preis. Ihr Debütroman »Wenn gefährliche Hunde lachen« erschien 2011. Obexer war Max-Kade-Gastprofessorin in den USA und unterrichtet seit 2009 an der UDK Berlin das Fach Szenisches Schreiben. Die Süddeutsche Zeitung meinte: »Obexer schreibt auf unaufdringliche Weise packend.«
Produktdetails
- Verlag: Verbrecher Verlag
- Seitenzahl: 112
- Erscheinungstermin: 1. August 2017
- Deutsch
- Abmessung: 203mm x 136mm x 15mm
- Gewicht: 234g
- ISBN-13: 9783957322715
- ISBN-10: 3957322715
- Artikelnr.: 48267306
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Allgemeine ZeitungFremd bin ich ausgezogen
Maxi Obexer erzählt in einem Romanessay von ihrer Emigration aus Südtirol
Es ist Maxi Obexers Herzensthema: die Flucht. Immer wieder taucht es im Werk der in Brixen in Südtirol geborenen Autorin auf. In ihrem neuen Romanessay "Europas längster Sommer" widmet sie sich ebenfalls diesem Thema. Die größeren Zusammenhänge von Obexers Abhandlung sind Europa und - wie der Buchtitel schon vorwegnimmt - die Flüchtlingsbewegungen, die im Sommer 2015 die europäische Politik auf die Probe stellten. Der Sommer des "Wir schaffen das" und der schier unglaublichen Solidarität aus der Bevölkerung, aber auch der politischen Überforderung.
Die Flucht, die jedoch den Ausgangspunkt für den knapp
Maxi Obexer erzählt in einem Romanessay von ihrer Emigration aus Südtirol
Es ist Maxi Obexers Herzensthema: die Flucht. Immer wieder taucht es im Werk der in Brixen in Südtirol geborenen Autorin auf. In ihrem neuen Romanessay "Europas längster Sommer" widmet sie sich ebenfalls diesem Thema. Die größeren Zusammenhänge von Obexers Abhandlung sind Europa und - wie der Buchtitel schon vorwegnimmt - die Flüchtlingsbewegungen, die im Sommer 2015 die europäische Politik auf die Probe stellten. Der Sommer des "Wir schaffen das" und der schier unglaublichen Solidarität aus der Bevölkerung, aber auch der politischen Überforderung.
Die Flucht, die jedoch den Ausgangspunkt für den knapp
Mehr anzeigen
hundert Seiten langen Romanessay bildet, geschah früher. Maxi Obexer zog zwecks Studium aus ihrer Südtiroler Heimat nach Berlin. Der Grund: Sie wollte endlich ein normales Verhältnis zu ihrer Muttersprache aufbauen. In ihrer offiziell italienischsprachigen Heimat ist Deutsch nur ein regionaler Dialekt, die Bindung zum Deutschen wurde von ihr nie in Gänze ausgelebt. In Berlin konnte sie nun also eine intimere Bindung zu ebenjener Sprache und deren Wörtern aufbauen: "Ich wanderte aus, um eine Sprache zu finden, und mit ihr wanderte ich zu mir", sagt sie an einer Stelle im Buch. Doch ohne Hindernisse ging das nicht. Obexer fühlte sich ausgeschlossen aufgrund ihres markanten Südtiroler Akzents: Von einer Berliner Beamtin wurde sie gefragt, ob es Deutsch sei, was sie da spreche. Sie traute sich kaum, sich in Universitätsseminaren zu melden, auch ihre Verlegerin bemerkte den Dialekt in Gesprächen.
Diese sprachliche Ausgangssituation nutzt Obexer vor allem im starken ersten Teil des Buches gekonnt, um eine Art deutsch-deutsche Einwanderungsgeschichte entstehen zu lassen, deren Symbolik tiefgreifenden Wert hat. Die 1970 geborene Obexer beleuchtet anhand ihrer eigenen - wohl gemerkt innereuropäischen - Wanderung das bürokratische Wirrwarr bei Staatenwechsel wie auch die Bedeutung von Nationalstaaten in Zeiten offener Grenzen. Es werden grundlegende Fragen zur Krise der europäischen Identität aufgeworfen, die Obexer auch durch ihre eigene Vita kennt und in bemerkenswerter Manier daran zu erläutern versucht. Die Deutsch-Italienerin hinterfragt in ihrem Essay mehrfach das Konzept einer Landeszugehörigkeit, erzählt davon, dass sie im Gespräch in einem Berliner Café weder als "Wessi" noch als "Ossi", aber als "Südin" bezeichnet wurde. Essentielle Fragen der kulturellen Zugehörigkeit werden hier hinterfragt, das grundlegende Staatendenken scheint in diesem Zusammenhang obsolet - ein Resultat des offenen Europas?
Doch woran macht sich Zugehörigkeit fest? An einem dialektfreien Hochdeutsch etwa? Oder am richtigen Personalausweis? Hier werden Fragen der Heimat, der modernen Identität aufgeworfen. Und diese müssen - so Obexer - nach dem schicksalhaften Sommer 2015 neu gedacht werden: Für die Schriftstellerin war es der Sommer, an dem man "über die Grenzen hinaus" und in ein "Europa hinein" dachte. Die "Festung Europa" und der latente Nationalismus schienen in diesen Tagen überwunden. Doch wie viel ist davon heute noch übrig - im Europa von Kurz, Orbán und Kaczyinski?
Besonders im späteren Teil des Buches tendiert Obexer leider dazu, in einen belehrenden Duktus zu wechseln: Sie beschreibt, was Europa ihrer Meinung nach sein soll und was nicht, fragt zwar nach den Ursachen, benennt aber nur spärliche Eckpunkte und bedient sich bereits bekannter Bilder, die aber in ihrer größeren Argumentation ins Nichts führen. Bei diesen Passagen werden Themen eher angeschnitten, komplexe Sachverhalte vereinfacht und wertend dargestellt - somit bleibt nicht mehr als ein schnödes Kratzen an der Oberfläche. Das ist besonders schade, da doch am Anfang das Thema so besonders angegangen wurde: Vom Biographischen und Ungewöhnlichen wechselt Maxi Obexer später zu oft ins Verallgemeinernde.
Beim diesjährigen Bachmannpreis las Maxi Obexer ebenfalls aus "Europas längster Sommer" und löste damit bei der Jury gespaltene Reaktionen aus, bei denen nur wenige Mitglieder auf einen gemeinsamen Nenner kamen. Am Ende blieb ihre Arbeit unprämiert.
In seiner Art und Weise ist der Romanessay von Maxi Obexer sicherlich etwas Besonderes und auch - speziell in den Passagen, in denen Obexer ihr eigenes Leben in Südtirol und Berlin erzählt - ein gelungener, relevanter Text, dessen Alleinstellungsmerkmal aber durch die stark verallgemeinernde und übermäßig-moralisierende Stellung Obexers zur europäischen Flüchtlingspolitik getrübt wird.
FLORIAN KÖLSCH
Maxi Obexer: "Europas längster Sommer". Roman.
Verbrecher Verlag, Berlin 2017. 112 S., geb., 19,-[Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Diese sprachliche Ausgangssituation nutzt Obexer vor allem im starken ersten Teil des Buches gekonnt, um eine Art deutsch-deutsche Einwanderungsgeschichte entstehen zu lassen, deren Symbolik tiefgreifenden Wert hat. Die 1970 geborene Obexer beleuchtet anhand ihrer eigenen - wohl gemerkt innereuropäischen - Wanderung das bürokratische Wirrwarr bei Staatenwechsel wie auch die Bedeutung von Nationalstaaten in Zeiten offener Grenzen. Es werden grundlegende Fragen zur Krise der europäischen Identität aufgeworfen, die Obexer auch durch ihre eigene Vita kennt und in bemerkenswerter Manier daran zu erläutern versucht. Die Deutsch-Italienerin hinterfragt in ihrem Essay mehrfach das Konzept einer Landeszugehörigkeit, erzählt davon, dass sie im Gespräch in einem Berliner Café weder als "Wessi" noch als "Ossi", aber als "Südin" bezeichnet wurde. Essentielle Fragen der kulturellen Zugehörigkeit werden hier hinterfragt, das grundlegende Staatendenken scheint in diesem Zusammenhang obsolet - ein Resultat des offenen Europas?
Doch woran macht sich Zugehörigkeit fest? An einem dialektfreien Hochdeutsch etwa? Oder am richtigen Personalausweis? Hier werden Fragen der Heimat, der modernen Identität aufgeworfen. Und diese müssen - so Obexer - nach dem schicksalhaften Sommer 2015 neu gedacht werden: Für die Schriftstellerin war es der Sommer, an dem man "über die Grenzen hinaus" und in ein "Europa hinein" dachte. Die "Festung Europa" und der latente Nationalismus schienen in diesen Tagen überwunden. Doch wie viel ist davon heute noch übrig - im Europa von Kurz, Orbán und Kaczyinski?
Besonders im späteren Teil des Buches tendiert Obexer leider dazu, in einen belehrenden Duktus zu wechseln: Sie beschreibt, was Europa ihrer Meinung nach sein soll und was nicht, fragt zwar nach den Ursachen, benennt aber nur spärliche Eckpunkte und bedient sich bereits bekannter Bilder, die aber in ihrer größeren Argumentation ins Nichts führen. Bei diesen Passagen werden Themen eher angeschnitten, komplexe Sachverhalte vereinfacht und wertend dargestellt - somit bleibt nicht mehr als ein schnödes Kratzen an der Oberfläche. Das ist besonders schade, da doch am Anfang das Thema so besonders angegangen wurde: Vom Biographischen und Ungewöhnlichen wechselt Maxi Obexer später zu oft ins Verallgemeinernde.
Beim diesjährigen Bachmannpreis las Maxi Obexer ebenfalls aus "Europas längster Sommer" und löste damit bei der Jury gespaltene Reaktionen aus, bei denen nur wenige Mitglieder auf einen gemeinsamen Nenner kamen. Am Ende blieb ihre Arbeit unprämiert.
In seiner Art und Weise ist der Romanessay von Maxi Obexer sicherlich etwas Besonderes und auch - speziell in den Passagen, in denen Obexer ihr eigenes Leben in Südtirol und Berlin erzählt - ein gelungener, relevanter Text, dessen Alleinstellungsmerkmal aber durch die stark verallgemeinernde und übermäßig-moralisierende Stellung Obexers zur europäischen Flüchtlingspolitik getrübt wird.
FLORIAN KÖLSCH
Maxi Obexer: "Europas längster Sommer". Roman.
Verbrecher Verlag, Berlin 2017. 112 S., geb., 19,-[Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Wann ist ein Ausländer ein „echter“ Ausländer? Und wann darf ein „Migrant“ sich als solchen bezeichnen? Die Essayistin und Autorin von Theaterstücken Maxi Obexer schickt in ihrem als Roman eingeordneten Text eine Italienerin auf eine Reise aus der ehemaligen …
Mehr
Wann ist ein Ausländer ein „echter“ Ausländer? Und wann darf ein „Migrant“ sich als solchen bezeichnen? Die Essayistin und Autorin von Theaterstücken Maxi Obexer schickt in ihrem als Roman eingeordneten Text eine Italienerin auf eine Reise aus der ehemaligen Südtiroler Heimat in die neue Heimat Berlin, wo sie ihren deutschen Pass in Empfang wird nehmen dürfen. Auf dem Weg zwischen Vergangenheit und Zukunft sinniert sie über ihre Erfahrungen als Italienerin, Südtirolerin, Ausländerin, Migrantin, Europäerin und auch Deutsche nach, die widersprüchlich, widersinnig, bisweilen grenzwertig nationalistisch und manchmal einfach absurd sind. In „Europas längster Sommer“ werden die durch die EU abgeschafften Grenzen plötzlich wieder präsent, doch sie sind neu gezogen worden und verlaufen anders als früher. Vieles, was eindeutig und klar zu sein scheint, muss nochmals hinterfragt werden.
Der kurze Roman, der auf mich eher wie ein langer Essay denn wie eine fiktionale Geschichte wirkt, reißt viele aktuelle Fragen auf und nimmt in der Vielzahl der seit zwei Jahren recht populären Flucht- und Migrationsromane eine ganz neue Perspektive ein, die bislang zu Unrecht vernachlässigt wurde. Als Südtirolerin hat die Autorin die Erfahrung gemacht, dass sie zwar einen italienischen Pass hat, aber nicht als Italienerin wahrgenommen wird. Für die Italiener ist sie Deutsche. Doch richtige Deutsche ist sie auch nicht, trotz aller Bemühungen um Hochdeutsch bleibt ihre Sprache immer ein wenig anders. Besonders eklatant wird das Thema der europäischen Minderheiten im Kunst- und Literaturbetrieb, wo sie zwischen den großen Nationen untergehen und vernachlässigt werden.
Als EU-Ausländerin in Deutschland befindet sie sich in einer besonders abstrusen Situation: die Freizügigkeit zwischen den Staaten erlaubt die unproblematische Migration, gleichzeitig erhält sie aber kein Wahlrecht in dem Land, in dem sie lebt und arbeitet. Sie darf anders sein, soll sich aber integrieren, wie kann dieser Widerspruch aufgelöst werden? Auch im wiedervereinten Berlin, wo die Grenze zwischen Ossi und Wessi messerscharf verläuft, gehört sie weder zu den einen noch zu den anderen.
Sie als freiwillige Migrantin hat sich dieses Los selbst ausgesucht, doch was ist mit der zweiten und dritten Generation der Italiener und Türken, die auf den Papier Deutsche sind, jedoch aufgrund ihres Namens und/oder Aussehens nie als solche anerkannt werden?
„Der Hintergrund ist ewig vordergründig, er verfolgt sie wie ein vorauseilender Schatten. Für sie alle ist der Migrationshintergrund unüberwindbare Realität, eine Ohnmacht, ein Schmerz, ein ungehörter Schrei.”
Kann man überhaupt „Deutsche“ werden? Oder „Italienerin“? Oder „Französin“? Europa wächst zusammen, vermischt sich und trennt zugleich doch immer noch. Das wohl absurdeste Beispiel hierzu lieferte das Vereinigte Königreich:
„Als im Sommer 2016 in Großbritannien über den Verbleib oder den Austritt aus der Europäischen Union abgestimmt wurde, haben EU-Ausländer nicht mitgewählt. Über eine Entscheidung, die sie zuerst betrifft, hatten sie selbst kein Stimmrecht.”
Maxi Obexer stellt die richtigen und wichtigen Fragen. 2015 hat eine Wende im Verständnis von Europa markiert, man hat Menschen hereingelassen, zugelassen, dass sich die EU im Inneren verändert. Doch dazu erfordert es noch vieles von den Bewohnern dieser politischen Einheit, die viel eher die Unterschiede wahrnehmen als das, was sie eint.
Ein wichtiger Beitrag für die Diskussion um nationale Leitkulturen und europäische Werte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für