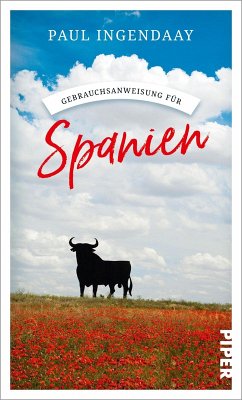Die Katalanen, die Basken oder die Kastillier - sie alle sind das wahre Spanien. Es spricht vier Sprachen und besitzt mehr als nur eine Mentalität. Und deshalb blickt dieses Buch ganz genau hin, von den fernen Kanaren bis ins unruhige Katalonien. Es erzählt von Aberglauben und Improvisation, von der kuriosen Notwendigkeit zu heiraten ebenso wie vom tief verwurzelten Wunsch eines jeden Spaniers, Hausbesitzer zu werden. Natürlich muss vom Stierkampf die Rede sein, aber auch von den großartigen Nationalparks, von Bikini und Ballermann und dem kulinarischen Reichtum dieses facettenreichen Landes.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.