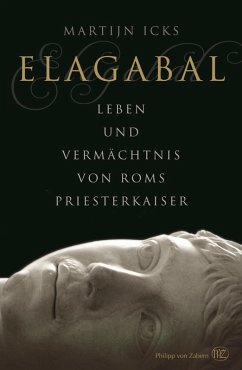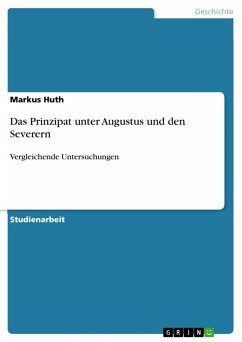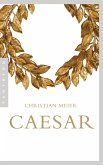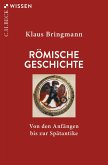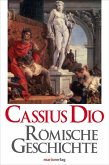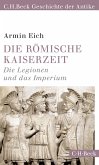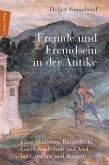Trotz seines frühen Todes mit gerade einmal achtzehn Jahren ging Elagabal als einer der berüchtigtsten Kaiser Roms in die Geschichte ein. Mit nur vierzehn Jahren kam der orientalische Knabenpriester aus Syrien im Jahr 218 an die Macht. Er stellte den gleichnamigen Sonnengott Elagabal an die Spitze des etablierten römischen Pantheons, beschäftigte sich mit orgienhaften Ritualen, nahm sich männliche und weibliche Geliebte und soll sich in Kneipen und sogar im Kaiserpalast prostituiert haben. Sein Verhalten zog Kritik und Verdammung seitens des Senats und des Volkes gleichermaßen auf sich. Seit seiner Ermordung durch die Prätorianergarde faszinierte Elagabal Historiker und inspirierte Künstler und Schriftsteller. Äußerst lebendig schildert Martijn Icks das Leben Elagabals. Er geht mit seiner Studie weit über die klassische Kaiserbiografie hinaus, indem er das Wesen religiöser Anschauungen, Kultur und Ethnizität, die Präsentation des kaiserlichen Bildes und die Reaktion darauf einbezieht.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.