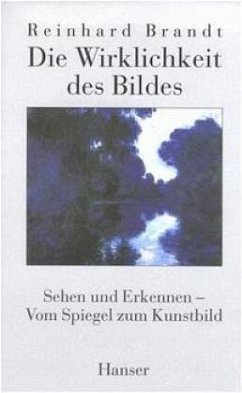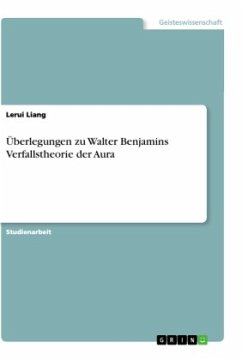Bilder: Spiegelbilder, Bilder in Wolken, ein magisches Zeichen, ein Hologramm, eine TV-Reportage, ein Piktogramm auf einem Verkehrsschild. Was ist es, was diese "Bilder" zu Bildern macht? Wie verläuft der sensitive und kognitive Prozess unserer Wahrnehmung? Reinhardt Brandt hat eine wunderbare Einführung in die Wahrnehmung und in das Verständnis von Bildern geschrieben.

Was man so alles erkennen will: Reinhard Brandt ist ein harter Denker, dem die moderne Kunst nichts anhaben kann
Der Marburger Philosoph Reinhard Brandt ist vielen als feinsinniger Ausleger der großen Denker von der Antike bis zur Neuzeit ein Begriff. Daß er seine Interpretationskünste mit derselben Hingabe an Gemälden, Kupferstichen und Zeichnungen geübt hat, ist weniger bekannt. Vornehmlich interessierten ihn Bilder, welche die philosophische Reflexion in Anspruch nehmen, sei es, daß sie Philosophen und ihre Lehren zum Thema machen, sei es, daß sie durch das Raffinement der von ihnen aufgespannten Beziehungsgefüge philosophische Fragen aufwerfen. Das Nachdenken über exemplarische Bildwerke führte auf systematische Fragen: Was macht Gemälde oder auch Vorstellungsbilder zu Bildern? Was ist ein Bild? Den damit berührten Rätseln ist Brandt in seinem Buch "Die Wirklichkeit des Bildes" nachgegangen.
Absicht der Untersuchung ist eine Explikation des Bildbegriffs; in der Einleitung heißt es: "Ein Bild läßt uns etwas anschauen (und im Anschauen erkennen oder identifizieren), was der natürliche oder künstlich geschaffene physische Gegenstand, den der Betrachter vor sich hat oder den er sich vorstellt, selbst nicht ist." Dies will Brandt als Versuch verstanden wissen, "das Prädikat ,Bild' auf eine plausible und praktikable Weise festzulegen und zu begründen". Er hält sich nicht bei Adäquatheitsbedingungen für solche "Sprachregelungen" auf; zumindest sollten praktikable Explikationen aber wohl klarer sein als der Begriff, der zu erhellen ist. Daß diese Minimalanforderung hier erfüllt ist, darf man bezweifeln. Ich verstehe schon nicht, was es heißen soll, ein Prädikat zu "begründen". Schwerer wiegen die Unklarheiten, die der Formulierung "etwas anschauen, was der natürliche oder künstlich geschaffene physische Gegenstand selbst nicht ist" anhaften und die leider auch in den weiteren Kapiteln nicht beseitigt werden.
Die Ratlosigkeit wächst, wenn auf ein wichtiges Korollar hingewiesen wird: "Bestimmt man den Bildbegriff in dieser Weise, dann ,gibt es' keine Bilder." Noch verblüffender als dieses Resultat ist der triumphierende Ton, in dem es vorgetragen wird. Sollte die Leserin versucht sein, einzuwerfen, die Begriffsbestimmung sei angesichts des mißlichen Ergebnisses zu überdenken, muß sie auf scharfe Zurechtweisung gefaßt sein. Brandt sieht in solchen Bedenklichkeiten einen "an positiven Sicherheiten orientierten Alltagsverstand" am Werke, dem er den Fehdehandschuh hinwirft. Er ist entschlossen, das Bildphänomen als einen, wie es immer wieder heißt, "paradoxen Sachverhalt" anzusehen. Dafür findet er klangvolle Formeln: Jedes Bild sei "ein Gebilde aus Sein und Nichtsein"; was es erscheinen lasse, habe "ein nur dagestelltes, nicht wirkliches Daoder Hiersein". Bilder seien "Zwiegebilde im ,est et non', am Saum der erfahrbaren Wirklichkeit".
Nicht jedes Paradox ist hilfreich.
Zwar kann in seltenen - und darum kostbaren - Fällen das Vorliegen eines Paradoxons ein Indiz für die Tiefe eines Problems sein. Häufiger deutet es aber darauf hin, daß etwas (noch) nicht verstanden wurde. So sind "paradoxe Sachverhalte" zumeist hausgemacht. Auch im vorliegenden Fall scheint es möglich, die Verhältnisse so zu beschreiben, daß der paradoxe Anstrich ganz vermieden wird. Ein Schritt zur Klärung bestünde darin, die vergegenständlichenden Redeweisen zu vermeiden und statt dessen von verschiedenen Arten von Beschreibungen und Eigenschaften zu sprechen. Wir schreiben Bildern sowohl physische Eigenschaften als auch Darstellungsund Ausdruckseigenschaften zu, welch letztere in ersteren fundiert sein können, ohne selbst von diesem Typ zu sein. Vor allem muß man bei den Beschreibungen davon, was wir in einem Gemälde sehen, behutsam vorgehen.
In die Irre führen kann hierbei, daß viele dieser Charakterisierungen bereits innerhalb der Sprache der Darstellung erfolgen. So reden wir zwanglos davon, daß wir in Raffaels "Die Schule von Athen" zahlreiche berühmte Philosophen sehen. Aber was unserer Anschauung hier vorliegt, sind natürlich keine Philosophen, sondern Philosophen-Bilder. Und eine Bildtheorie muß gerade klären, was es im einzelnen heißt, ein Bild von etwas zu sein, und worauf derlei Darstellung beruht. Schön wäre es, wenn die Theorie darüber etwas zu der Phänomenologie des Bildersehens sagen könnte. Einer bedenkenswerten Bildtheorie zufolge, die Brandt nicht erörtert, charakterisiert es die Bilderfahrung, daß wir beim Betrachten der Leinwand so tun, als sähen wir - um bei dem Beispiel zu bleiben - tatsächlich Platon, Aristoteles und all die anderen vor uns. Ich habe meine Zweifel, ob dieser Ansatz für alle Arten von Bildern angemessen wäre. Jedenfalls verdeutlicht er, wie man die Phänomene retten kann, um die es Brandt geht, ohne sich in "paradoxen Sachverhalten" zu verlieren.
Bilder sind gemäß seiner These Gegenstände einer spezifischen Anschauung. In der Folge ist dann zumeist von "Sehen" die Rede. Erneut muß der Alltagsverstand Federn lassen. Nach Brandt sehen wir nämlich wenig: "nur interagierende Farben und Formen, hell oder dunkel, bewegt oder ruhend"; alles andere, fährt er fort, können wir nicht sehen, sondern müssen es erschließen. Die Auffassung, daß wir Bäume und andere Dinge sehen, nennt er einen "grandiosen Irrtum". Armer Alltagsverstand. Mag er sich damit trösten, daß viele Philosophen auf seiner Seite stehen.
In einer bildgeschichtlichen tour d'horizon, die von den natürlichen Spiegelbildern zu den artifiziellen Bildern und schließlich zu den Kunstbildern führt, sucht Brandt seine Hauptthese zu bestätigen. Obgleich man - pace Brandt - im Spiegel keine Bilder, sondern die reflektierten Gegenstände selbst sieht, wird das "Spiegelbild" zum Paradefall gekürt. Die These vom paradigmatischen Charakter wird ergänzt um eine genealogische Behauptung: "Das eigene Spiegelbild ist der Ursprung der Bildwerdung." Eine spannende Hypothese. Freilich nicht ohne Alternativen; andere sahen Schatten oder auch innergeistige Bilder am Anfang.
An mehreren Stellen werden Ausschnitte aus der Geschichte der Bildtheorien eingeschoben. Brandt zieht dabei große Linien durch die abendländische Erkenntnistheorie und Bewußtseinsphilosophie. Die ältere und neuere philosophische Literatur, die sich spezifisch dem Bildbegriff zugewandt hat, wird demgegenüber vernachlässigt. Roland Barthes, Ernst H. Gombrich und Nelson Goodman schließt sich eine umfangreiche Diskussion zur Bildsemiotik sowie zur Phänomenologie und Psychologie des Bildersehens an, die Brandt teils einfach links liegenläßt, teils arg nonchalant abkanzelt. Breiten Raum nimmt eine auch im Ton aus dem Rahmen fallende Polemik gegen Nelson Goodman ein. Brandt attackiert Goodmans Erkenntnistheoretie und Metaphysik, verfehlt dadurch aber sein eigentliches Ziel, die Bildtheorie. Zwar gewinnt Goodman aus jenen Ressourcen zusätzliche Argumente gegen die traditionellen Nachahmungs- und Ähnlichkeitstheorien des Bildes; aber die von diesem Hintergrund unabhängigen Einwände reichen zur Widerlegung aus. Vor allem kann man Goodmans eigene Antwort auf die Frage nach den Unterschieden von Beschreibungen und Abbildungen, von Sprachen und Bildsystemen, für diskussionswürdig halten, gleichgültig, wie man zu seiner pluralistischen und relativistischen Metaphysik steht. Brandt weicht aus, indem er seinen ungerechten Spott auf die vermeintlichen Prämissen des Goodmanschen Vorschlags ausgießt.
Alles wird schlechter.
Engagierter und ambitionierter ist der lange Schlußteil über die Kunstbilder, der ein eigenes Buch im Buche darstellt. Brandt möchte hier in einem Verfahren, das an Hegels Ästhetik erinnert, "die interne Logik der Kunst-Bild-Geschichte" aufzeigen. In diesem Teil finden sich anregende Beobachtungen und Spekulationen; die eingestreuten Bewertungen sorgen aber auch für manches Ärgernis. Kunstbilder, so die Grundidee, "thematisieren, was sie darstellen". Brandts Hauptaugenmerk gilt den möglichen Formen einer Selbstaufhebung der Bild-Kunst: dem extremen Realismus, der Selbstreflexion und der reinen Material- und Formästhetik. Gerade in puncto Selbstreflexion und -thematisierung bringt er Unterscheidungen und Einzelbeobachtungen ins Spiel, die sich zur Beschreibung und Diagnose von Kunstentwicklungen als brauchbar erweisen könnten. Insgesamt folgt Brandts Erzählung freilich dem pejorativen Muster der Verfallsgeschichte. Gegen Arthur C. Danto gewandt, betont er früh, daß mit einem größeren Ausmaß von Selbstreflexion sich nicht zwangsläufig der Kunstcharakter erhöhen müsse.
Beim Weiterlesen macht sich zwischen - und auch in - den Zeilen immer stärker eine Distanz zur modernen Kunst bemerkbar, die sich bis zur offenen Verachtung steigert. Zunächst hatte Brandt noch in einer Parenthese versteckt, wofür sein Herz schlägt: "Die Ich-Kultur des Bildes findet eine erste (und vielleicht später künstlerisch nie mehr erreichte) Höhe in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts." Zur Befreiung der bildenden Kunst im neunzehnten Jahrhundert merkt Brandt düster an: "Am Ende dieser Entwicklung kann die leere Freiheit stehen, die sich selbst will und in ihre eigene Leere stürzt." Zur Moderne heißt es hämisch: "Bevor das ,Monochrome' als ernste Kunst erschien, wurde es auf dem Montmartre als Farce ausgestellt." Und mit subtilen Werken wie Cy Twomblys "School of Athens" möchte Brandt die These belegen: "Häufig wird bei reinem Antünchen ein Externbezug fingiert, der zu einem mystischen Tiefsinn geraten kann."
Zwischen den Attacken und Seitenhieben gerät das offizielle Hauptanliegen - die Seinsweise der Bilder zu bestimmen - mehr und mehr aus dem Blickfeld. Brandt führt seine Scharmützel an so vielen Fronten (gegen den Alltagsverstand, gegen zeitgenössische Bildtheorien, gegen vermeintliche Verfallsformen des Kunstbildes), daß der Leser, der ihm - immer geschundener - folgt, die Sache, für die gestritten wird, zu vergessen droht. Offenbar lag es dem Autor am Herzen, zu allen diesen Fragen sein ceterum censeo abzugeben. Aber den Leser beschleicht, von den Zweifeln in der Sache abgesehen, die Frage, ob es eine gute Idee war, dies alles - Begriffsbestimmung, Genealogie und Streitschrift - in dasselbe Buch zu packen.
OLIVER R. SCHOLZ.
Reinhard Brandt: "Die Wirklichkeit des Bildes". Sehen und Erkennen - Vom Spiegel zum Kunstbild. Carl Hanser Verlag, München 1999. 308 S., 8 Abb., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main