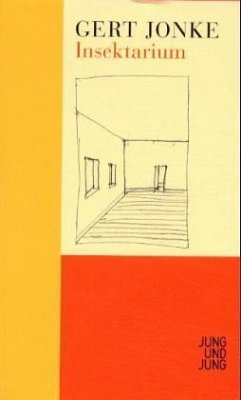Produktdetails
- Verlag: Jung und Jung
- Seitenzahl: 111
- Deutsch
- Abmessung: 13mm x 120mm x 189mm
- Gewicht: 184g
- ISBN-13: 9783902144034
- ISBN-10: 3902144033
- Artikelnr.: 09636644

In Gert Jonkes Lese-Dramoletten
passiert alles nur Mögliche
„Irgendwie erschrocken, stößt SIE einen höheren Schrei aus, der fremdartig und irgendwie woanders her ihr aufgedrängt herausgelockt oder so anmutet und öffnet blitzartig das Fenster. Dann hört man vielleicht raumeinwärts
Fliegengesumm durch die Zimmerluft vertorkelnd, das vielleicht darauf irgendwie abstürzen sollte oder verschwinden.”
Der Besuch einer Fliege. Wir wissen aus der Literaturgeschichte, was daraus entstehen kann – zumeist Komik, von Wilhelm Busch über Loriot bis Robert Gernhardt. Bei Gert Jonke wird es ein Dramolett. Und was für eines! Irgendwo recht vage, diese Regieanweisung, bestehend aus „Vielleichts” und „Irgendwies”. Schwer zu realisieren obendrein. Welche Fliege ließe sich so abrichten, könnte so brummen, dass man sie sähe und hörte – noch auf den letzten Rängen?
Die Vielleichts und Irgendwies sind Programm. Jonkes Dramolette, obwohl teilweise aufgeführt, sind Lesedramen. Dramen, die sich wahrhaft dramatisch entwickeln. Die Stubenfliege bekommt die Küche zugewiesen, erhält einen Namen (Elvira, das ist zugleich auch IHR Name!), kriegt ungarische Salami satt und wächst in unheimlicher Stille allmählich zum Monstertier heran. Eine spätere Regieanweisung liest sich wie die Beschreibung von Edvard Munchs Bild „Der Schrei”: „Je länger ER zu ihr über die Stille gesprochen hat, während SIE in die Stille hinter der verschlossenen Küchentür horcht und immer weiter in die Küche hinein von ihm fortzukriechen versucht, geht SIE plötzlich dazu über, sich mit beiden Händen die Ohren zuzuhalten und scheint ihn mit einem aufgerissenen Mund mit einem Schweigebrüllen anzuschreien, aus dem nur angedeutet so etwas rauskommt wie ,hör’ auf oder so.”
Gert Jonkes Prosa-Dramolett „Elvira und die Stubenfliege” zitiert Bilder, ist selber im höchsten Maße bildhaft und weckt im Leser oder Zuseher Bilder. Auf der Bühne ist es wohl nur als Variante der Mauerschau inszenierbar. Natürlich denkt jeder Leser hier auch an Kafka, nicht nur des monströsen Insekts wegen, sondern auch, weil das Absurde, das sich hier ereignet, als Normalität gesetzt wird. So auch in den anderen Texten. „Das Zimmer” beispielsweise hält „es in diesem Haus hier nicht mehr aus.” Ständig wechseln die Mieter, die guten schneller, die schlechten lassen sich Zeit. Es ist schon ganz heruntergewohnt vor lauter Rücksichtslosigkeit. Im Dialog des Zimmers mit dem neuen Bewohner festigt sich sein Entschluss, abzuhauen. Es flieht zum Fenster hinaus, während das Haus „vor Wut zerbröckelt und sich selber vor die Füße schüttet”.
Jonkes Dramolette sind wie Texte für Kinder: voller Wunder, voller Staunen, voller Übertreibung (zwei Texte heißen „Hyperbel”), doch alles so klug und wie selbstverständlich eingesetzt, alles an seinem Platz und mit einer genau kalkulierten Ökonomie des Erzählens, kein Satz zu lang, kein Wort zu kurz: „Schiffstauverklumpungsaufhäufung”. Aber keine Angst vor solchen Ungetümen: Denn jeder Auftritt ist eine „Entfesselungsnummer”, ein Befreiungsschlag gegen das tradierte Sehen, ein Plädoyer fürs raffiniert Naive und seine schöpferische Kraft. Ein Déjà-vu zugleich mit der noch unverschütteten Fantasie von einst, als unser Geist noch fluide war, gläubig und voller Vertrauen in eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten.
LUTZ HAGESTEDT
GERT JONKE: Insektarium. Verlag Jung und Jung, Salzburg 2001. 112 Seiten, 34,90 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Gert Jonke verleiht dem Bühnenvorhang eine Stimme
Unfaßbar ist die Welt, schlüpfrig und so komplex, daß Wörter nur einen Teil davon bannen können. Diese Einsicht beschäftigt den österreichischen Schriftsteller Gert Jonke wie kaum einen zweiten, sie schärft seinen Blick und lehrt ihn staunen über all das, was ehedem noch Routine war. Deshalb widersetzt er sich der leerlaufenden Semantik, verbiegt und krümmt seine Sprache nach Kräften, schneidet sie zurecht, bis sie dem Gegenstand wie angegossen paßt: Literatur als Maßanzug.
Es sind Momentaufnahmen des Lebens, die seine Theaterpoesie "Insektarium" ausmachen, Splitter eines großen Ganzen, das irgendwo jenseits der Schrift lauert. Aber aus diesem Kleinod zaubert Jonke die schönsten Phantasien, die alle Logik und Erdenschwere überwunden haben. Zunächst hebt sich der "Eiserne Vorhang", eigentlich ein gewohnter Ablauf, den man nicht weiter beachtet, weil er so selbstverständlich ist wie Scheinwerferlicht auf der Bühne. Aber bei Jonke beginnt die Eisenwand auf einmal zu erzählen, als gehöre sie schon zum Drama, als stifte sie das erregende Moment des Abends: "Beinahe hätte ich dem Komponisten Anton Webern, als er sich nach einer Operettenvorstellung, die er dort dirigierte, um das Geld zur Ernährung seiner Familie zu verdienen, als er sich verbeugte, den Kopf vom Rumpf abgeschnitten, ihn beinahe unabsichtlich guillotiniert." Gleichwohl wolle er dem Leser mit seinen Abenteuern nicht "noch gezielter zur Last fallen". Ein bißchen bedrohlich darf er schon seine Zähne blecken, schließlich hat ihm noch niemand dafür gedankt, daß er einen ganzen Theaterabend lang in seinem dunklen Versteck ausharrte und nicht einmal den Schlußapplaus empfangen durfte.
Jonke reißt einen Kosmos auf, der alle Gewißheiten eingebüßt hat, und es ist, als müßten sich seine Figuren erst zurechtfinden in der Fremde: "Ich weiß wirklich nicht mehr ganz genau, wie mein echter Vorname lauten sollte, und ist mir dies auch völlig gleichgültig, und wenn ich mich an die Jahre der letzten Zeit zurückerinnere, glaube ich, daß die meisten mich Elvira nannten, das ist schon möglich. Ungefähr Elvira heiße ich, mehr kann ich dir nicht sagen." Das sagt Sie zu einem nicht näher benannten Er im Kapitel "Elvira und die Vögel", als lösten sich die beiden Figuren im Augenblick ihrer Rede vollends in Sprache auf, verbissen an den Dialog geklammert wie an den letzten Rest einer fliehenden Identität.
Im nächsten Kapitel schließlich, das genausogut das übernächste oder das danach sein könnte, weil jedes für sich ein eigenständiges Minidrama entwirft, nennt der Theaterintendant Comelli das Problem der verlorenen Physis beim Namen, wenn er über den verstorbenen Dichter Kalkbrenner sagt: "Ich weiß es nicht, aber Kalkbrenners Leben war immer irgendwie epigonal und katastrophal, sein Werk hingegen war und ist original. Für ihn wäre es am besten gewesen, er hätte gar nicht gelebt, sondern nur sein Werk geschrieben und hinterlassen." Als Tribut an die flüchtige Wirklichkeit richtet sich "Insektarium" in einer Sphäre des "Irgendwie" und "Ungefähr" ein, nach allen Seiten hin offen für das Neue. Kaum eine Regieanweisung legt sich fest, alles könnte ebensogut ganz anders sein, zwei Meter nach links oder nach rechts verschoben. Es können auch drei sein.
Man hat oft Mühe, die neue Zeile zu erfassen, sie entschlüpft dem Auge, spielt mit ihrer Bedeutung, verkehrt oder verfälscht sie, denn Jonkes Einfälle schießen in alle Himmelsrichtungen. Eigentlich ist sein Werk ein schlanker Sammelband des Grotesken und Absonderlichen, das sich auf Satzförderbändern oft zeilenlang bis zum nächsten Punkt schiebt. Jonke erzählt von einem fliegenden Zimmer, das aus dem Klammergriff der Mauern floh und das Haus dadurch zum Einsturz brachte, von Traumräumen im Schlaf und vom beträchtlichen Appetit einer wohlgenährten Riesenfliege hinter der Küchentür. Seine Ideen sind so elastisch, daß sie den kühnsten Gedankenausritt zulassen, ohne zu reißen. Mit gesundem Übermut reiht der Autor eine Kuriosität an die nächste, geht dabei meist vom Alltäglichen aus, das irgendwo durch eine entlegene Seitengasse in die Fiktion gelangt.
Seine Wortschöpfungen als Ungetüme zu bezeichnen wäre rabiat, sie zeugen vielmehr von stilistischer Präzisionsarbeit, wenn sie sich, Buchstabe für Buchstabe, herantasten an einen realen Eindruck für den das vorhandene Vokabular offenbar unzureichend gewappnet ist. Wer einen gefallenen Seiltänzer, der unter seinem Gerät begraben liegt, als "Schiffstauverklumpungsaufhäufung" bezeichnen kann, muß seinerseits ein Sprachartist sein, einer, den man jeden Moment stürzen sieht, ehe er sich an der nächsten Satzschlinge wieder zum Salto aufschwingt.
ALEXANDER BARTL
Gert Jonke: "Insektarium". Verlag Jung und Jung, Salzburg 2001. 120 S., geb., 34,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Lutz Hagestedt stellt Gert Jonkes "Insektarium" als auf vielerlei Weise anregende Lektüre vor. Einiges ist neu oder ungewöhnlich in diesen Texten, die zum Teil literarische Erwartungshaltungen evozieren oder zerstören, wie man Hagestedts Rezension entnehmen kann. Dies beginnt mit der Tatsache, dass Szenen wie der Besuch einer Fliege dem Leser aus der Literaturgeschichte meist als komische Szenen in Erinnerung seien. Im "Insektarium" seien es jedoch Dramolette, vage gehalten und mit vielen "Vielleichts" und "Irgendwies" behaftet, die der Rezensent als Programm entlarvt. Jonkes Dramolette sind Lesedramen, erklärt Hagestedt, auch wenn sie teilweise aufgeführt wurden. Am Beispiel von "Elvira und die Stubenfliege" erläutert er die bildhafte und Bilder weckende Sprache des Autors. Dieses Stück könne auf der Bühne nur als Variante der Mauerschau inszeniert werden, findet er. Gleichzeitig erinnere das Stück auch an Kafka, nicht allein wegen der monströsen Fliege, sondern auch, weil hier wie bei Kafka das Absurde zur Normalität werde. Jonkes Texte seien wie für Kinder gemacht, "voller Wunder, voller Staunen, voller Übertreibung". Abschließend lobt Hagestedt Jonkes sprachliche Gestaltung, die "genau kalkulierte Ökonomie des Erzählens", die, wie der Rezensent es beschreibt, zu kreativem Lesen anrege.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH