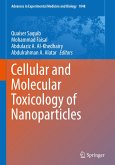Ein Beitrag zur Geschichte der Molekularbiologie in Deutschland: Christina Brandt untersucht anhand einer historischen Fallstudie die Rolle von Metaphern in den Biowissenschaften.Die heute so selbstverständliche Vorstellung, daß die »Erbinformation« eines Organismus in Form eines »genetischen Codes« in der Basen-Sequenz der DNA gespeichert ist, entwickelte sich Mitte des 20. Jahrhunderts. Neben Begriffen aus den Informationswissenschaften, wie »Code«, »Information« und »genetisches Programm«, waren es Vergleiche der DNA mit einem Alphabet und einer Schrift, die Eingang fanden in den biowissenschaftlichen Diskurs. Christina Brandt geht dem Weg dieser Metaphern in den Experimentalpraktiken der frühen Molekularbiologie nach. Ausgehend von der Virusforschung an den Kaiser-Wilhelm-Instituten für Biochemie und für Biologie in Berlin-Dahlem im »Dritten Reich« steht die Entwicklung an den beiden Max-Planck-Instituten für Virusforschung und für Biologie in Tübingen in den 1950er und 1960er Jahren im Zentrum ihrer Untersuchung. Beschrieben wird die Geschichte der Forschung am Tabakmosaikvirus - ein Virus, das entscheidend die Entwicklung molekularbiologischen Wissens geprägt hat und das 1960 auch im Mittelpunkt der Bemühungen stand, den »genetischen Code« im Labor zu »entziffern«. Die Autorin zeigt anhand dieser Fallstudie, wie sich metaphorische Sprache und Experimentalanordnungen gegenseitig katalysierten, wie sich die anfänglich zur Veranschaulichung eingesetzten Informations- und Schrift-Metaphern zur konstitutiven Ressource für ein neues Forschungsprogramm entfalteten und schließlich einen geradezu ontologischen Status erhielten. Das Buch ist ein Beitrag zu einer metaphorologischen Theorie von Wissenschaftssprachen. Als Studie zur bisher unbearbeiteten Geschichte der Molekularbiologie in Deutschland betritt die Arbeit zugleich wissenschaftshistorisches Neuland.Zur Reihe:Die Wissenschaftsgeschichte verstand sich lange Zeit als eine Art Gedächtnis der Wissenschaften. Heute sucht sie ihren Platz in der Kulturgeschichte und sieht ihre Aufgabe nicht zuletzt darin, Brücken zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften zu bauen. Die Formen, in denen dies geschieht, sind keineswegs ausgemacht. Sie sind Gegenstand eines großen, gegenwärtig im Gange befindlichen Experiments. Die historische Einbettung der wissenschaftlichen Erkenntnis, der Blick auf die materielle Kultur der Wissenschaften, auf ihre Objekte und auf die Räume ihrer Darstellung verlangt nach neuen Formen der Reflexion, des Erzählens und der Präsentation. Die von Michael Hagner und Hans-Jörg Rheinberger herausgegebene Reihe »Wissenschaftsgeschichte« versteht sich als ein Forum, auf dem solche Versuche vorgestellt werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Christina Brandt über Metaphern und ihren Wert in der Forschung
Ein winziges Stäbchen, nur 17 Nanometer dick - damit ist das „Tabakmosaikvirus” nicht bloß unsichtbar für Mikroskope, die mit Lichtstrahlen arbeiten. Es schlüpft auch mühelos durch alle Filter, die selbst kleinste Bakterien zuverlässig abfangen. Entsprechend rätselhaft blieb den Forschern zunächst, was sich auf den Tabakblättern durch mosaikartige Flecken bemerkbar macht und die Pflanzen verkümmern lässt. Dass der Erreger partout nicht auf künstlichen Nährmedien gedeihen wollte, sprach ebenfalls gegen eine unbekannte Mikrobe. Der niederländische Bakteriologe Martinus Beijerinck sah statt dessen einen flüssigen Ansteckungsstoff am Werk, durchaus fähig, sich lebhaft zu vermehren.
Bei den Fachkollegen stieß er damit auf wenig Gegenliebe. Fein säuberlich zwischen lebenden Organismen und toter Materie zu unterscheiden, gehörte schließlich zu den Grundlagen ihrer Wissenschaft. In den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts isolierte Wendell Stanley dann in Princeton infektiöse Kristalle aus dem Saft erkrankter Tabakpflanzen. Damit war die Vermutung passé, das Tabakmosaikvirus sei bloß ein besonders winziges und besonders widerspenstiges Bakterium. Vielmehr schien es sich um eine neue Gruppe von Makromolekülen zu handeln. Belebte und unbelebte Natur ließen sich wohl doch nicht so eindeutig voneinander abgrenzen wie bislang angenommen.
Mittlerweile werden Viren als eine Art minimalistischer Parasiten betrachtet, die ganz ohne eigenen Stoffwechsel auskommen und sich deshalb nur in lebenden Zellen vervielfachen. Dabei bringen sie - im Gegensatz zu Prionen - allerdings eigene Gene ins Spiel. In den Anfangsjahren der Virusforschung war zwar noch längst nicht klar, aus welchem Stoff die Gene sind. Dass Viren charakteristische Eigenschaften von Genen zeigen, war den Forschern jedoch aufgefallen: Auch diese eigenartigen Krankheitserreger vermehren sich und existieren in verschiedenen Varianten. Somit schienen sie als Modellsubstanz für das Studium der Genstruktur zu taugen.
Dank neuer Untersuchungsmethoden wie Ultrazentrifuge, Elektrophorese, Röntgenstrukturanalyse und Elektronenmikroskop verfügten die Wissenschaftler über das nötige Handwerkzeug für solche Studien. Als Virus par excellence galt das Tabakmosaikvirus, das entsprechend eifrig unter die Lupe genommen wurde. Mitte der Fünfzigerjahre war sein Bauplan geklärt: In regelmäßigen Spiralen angeordnet, umschließen mehr als zweitausend gleichartige Eiweißmoleküle einen ebenfalls spiralig gewundenen Nukleinsäurefaden. Fast gleichzeitig wurde nachgewiesen, dass das genetische Inventar des Virus in dieser Nukleinsäure steckt, das Eiweiß hingegen nur als Verpackung dient.
Dynamik der Vieldeutigkeit
Hundert- bis tausendfach kleiner als das Genom von Bakterien, schien der Nukleinsäurefaden des Tabakmosaikvirus besonders geeignet, um den „genetischen Code” zu entschlüsseln. Doch die Hoffnung wurde enttäuscht. Kein Wunder also, dass die Virusforschung wenig Beachtung findet, wenn die Pionierzeit der Molekularbiologie eine griffige Erfolgsstory abgeben soll. Dass sich die Virusforscher in dieser Hinsicht vergeblich mühten, macht ihre Forschungsansätze für Wissenschaftshistoriker jedoch nicht minder interessant.
Christina Brandt widmet sich in ihrer Dissertation vor allem der Frage, wie die Wissenschaftler ihre Gedanken in Worte fassten: Welche Metaphern wurden geprägt, wie prägten diese ihrerseits die Forschung? Wie in der übrigen Molekularbiologie konzentrierte sich das fachfremde Vokabular zunehmend auf den Bereich der Kommunikation, auf Alphabet und Schrift, Codierung und Informationstransfer. Zunächst ein probates Mittel, um die Erkenntnisse der Molekularbiologie einem größeren Publikum nahe zu bringen, waren solche Metaphern bald auch im täglichen Wissenschaftsbetrieb gang und gäbe.
Es konnte da nicht ausbleiben, dass diese Metaphern mitunter allzu wörtlich genommen wurden. Bisweilen wurde das Genom zum „Buch des Lebens” stilisiert und der lebende Organismus zum irrelevanten Anhängsel seiner Erbsubstanz erklärt. Diese Redeweise konnte aber auch neue wissenschaftliche Perspektiven aufzeigen. Dabei war es, so Brandt, gerade ein Vorteil der Metaphern, dass sie oft vieldeutig daherkommen und je nach Kontext ihre Bedeutung verändern. Die Wissenschaftsgeschichte zeige, dass die Unschärfe der Begriffe „ihre produktive Dynamik ausmacht”.
Auf germanistischem und biologischem Terrain gleichermaßen heimisch, könnte Christina Brandt mit diesem Thema eine breite Leserschaft ansprechen. Ob ihr das mit diesem Buch gelingen wird, scheint jedoch fraglich. Über einschlägige Fachkreise hinaus - derzeit arbeitet die Autorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin - werden sich wohl nicht viele mit dem spröden Charme der Abhandlung anfreunden. Stilistisch oft wenig elegante Formulierungen machen die Lektüre nicht leichter. Schade - wäre es doch durchaus anregend, die historischen Denkmuster eines Fachgebiets zu erkunden, das derzeit so viele Hoffnungen und Ängste weckt.
DIEMUT KLÄRNER
CHRISTINA BRANDT: Metapher und Experiment. Von der Virusforschung zum genetischen Code. Wallstein Verlag, Göttingen 2004. 304 S., 39 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ein interessantes Buch, leider wenig zugänglich verfasst. Schade, meint Diemut Klärner - denn hier kann man etwas über die "historischen Denkmuster" der Genforschung erfahren. Christina Brandts Interesse gelte nämlich der Sprache, die sich mit der Erforschung des Genoms entwickelte, den Metaphern, mit deren Hilfe die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse zunächst nur der Öffentlichkeit verständlich zu machen suchten, die aber bald zum Teil der "wissenschaftlichen Redeweise" selber wurden und damit auch das Denken der Forscher lenkten. Die Metaphern zur Beschreibung dessen, was man bei der Erforschung von Virenstrukturen herausfand, um sich der Enrtschlüsselung des genetischen Codes - auch das ist bereits eine Metapher - anzunähern, wirkten also nicht nur deskriptiv, sondern auch konstruktiv. Wie gesagt: ein interessant, aber mit seinem "spröden Charme" kaum geeignet, breitere Leserschichten anzusprechen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH