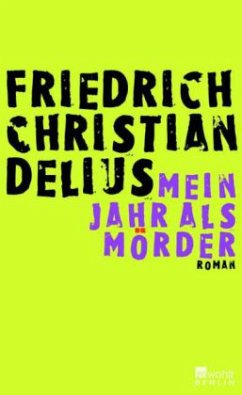Am Nikolaustag 1968 hört ein Berliner Student im Radio, dass der Nazi-Richter Rehse endgültig freigesprochen wurde. Noch während die Nachrichten Laufen, beschließt er, ein Zeichen zu setzen: Er will diesen Richter umbringen. Für den Studenten eine persönliche Angelegenheit, denn Rehse hat den Vater seines besten Freundes zum Tode verurteilt, Georg Groscurth - Leibarzt von Rudolf Heß und zugleich als Widerstandskämpfer aktiv, gemeinsam mit Robert Havemann.
Die Tatbereitschaft des jungen Mannes wächst, je mehr er sich mit der Familiengeschichte beschäftigt. Besonders empärt ihn das Schicksal von Groscurths Witwe Anneliese, die nach 1945 zwischen die Fronten des Kalten Krieges geriet. Dass ein Nazi ungeschoren davonkommt, während die Witwe des Opfers als kommunistische Hexe verschrien und in eine Kette von Justizskandalen verstrickt wird, ruft nach Vergeltung ...
Ein Generationenroman, der Fiktion und lebendige Zeitgeschichte verknüpft: Die 40er, 50er, 60er Jahre - wie man sie bisher noch nicht vernommen hat.
Die Tatbereitschaft des jungen Mannes wächst, je mehr er sich mit der Familiengeschichte beschäftigt. Besonders empärt ihn das Schicksal von Groscurths Witwe Anneliese, die nach 1945 zwischen die Fronten des Kalten Krieges geriet. Dass ein Nazi ungeschoren davonkommt, während die Witwe des Opfers als kommunistische Hexe verschrien und in eine Kette von Justizskandalen verstrickt wird, ruft nach Vergeltung ...
Ein Generationenroman, der Fiktion und lebendige Zeitgeschichte verknüpft: Die 40er, 50er, 60er Jahre - wie man sie bisher noch nicht vernommen hat.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Trotz seiner "dünnwandigen" Rahmenkonstruktion und einer gewissen Sprödigkeit im Erzählton hält Wolfgang Schneider viel von dem neuen Roman Friedrich Christian Delius'. Das liegt daran, dass Delius in "Mein Jahr als Mörder" eine wahre Geschichte rekonstruiert: die Leidensgeschichte des Ehepaares Groscurth: Er, Leibarzt von Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess wurde 1944 als Widerstandskämpfer hingerichtet, seiner Frau wird als angeblicher Kommunistin in der Bundesrepublik sogar die Witwenrente als Verfolgte des Naziregimes entzogen. Und wie alle wahren Geschichten, die das Leben schreibt, sind diese viel spannender als die erfundenen, meint Schneider. Die fiktive Rahmenhandlung - der geplante Sühnemord durch einen jungen Literaturstudenten - erscheint ihm vor allem als augenzwinkernde Anlehnung an Dostojewskis Raskolnikow. Doch die eigentliche Geschichte der Groscurths hat ihn sehr bewegt und so wünscht er dem Buch viele Leser. Im übrigen gelinge es Delius, bemerkt Schneider noch lobend, sich mit einem der Hauptmotive der Studentenbewegung auseinanderzusetzen, ohne in die Rhetorik jener Zeit zu verfallen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Chronik einer Nicht-Tat: Friedrich Christian Delius Roman „Mein Jahr als Mörder”
Eine „Beichte” nennt Friedrich Christian Delius seinen Tatsachenroman „Mein Jahr als Mörder”, aber gegen welches Gebot hat er sich - in Gedanken, Worten oder Werken - versündigt? Gegen das fünfte, wäre aus katholischer Sicht zu antworten; zur Sünde genügt es allemal, wenn man, wie der Erzähler dieses Romans, ein ganzes Jahr mit Vorsatz und gutem Gewissen auf einen Mord hinarbeitet, dessen Ausführung dann eher von höherer Gewalt als von tieferer Einsicht vereitelt wird. So gesehen, hätte Delius tatsächlich etwas zu beichten. Zu gestehen hätte er freilich nichts.
Juristisch kann man die kleine, fast ein bisschen pedantische Mordphantasie eines Berliner Germanistikstudenten aus dem Jahre 1969 als gegenstandslos betrachten. Damit hätte die Geschichte von jenem heimlichen Mordvorbereitungsjahr vor 35 Jahren wohl weiter geschlummert, wenn Delius sie nicht mit diesem autobiographischen Bericht ans Licht zurückgeholt hätte. „Mein Jahr als Mörder” ist keine Beichte; dazu fehlt die Zerknirschung, die Bereitschaft zu Buß und Reu. Auch oder gerade nach 35 Jahren steht Delius zu seiner Nicht-Tat und zu der radikalmoralischen Disposition, die sie ermöglicht hätte. Dies ist kein spätes Reuebekenntnis eines vom Zeitgeist verführten Achtundsechzigers, sondern die schlichte Beispielerzählung von einem stillen, normalen, aber überdurchschnittlichen erregbaren jungen Mann, der meinte, mit einem politischen Mord ein „Zeichen setzen” zu müssen.
„Es war an einem Nikolausabend, in der Dämmerstunde, als ich den Auftrag erhielt, ein Mörder zu werden”, so klassisch-novellistisch und sogleich ins Zentrum führend beginnt der Roman. Wer sind diese Auftraggeber, sind es innere Stimmen oder kriminelle Mächte? Der Auftrag kommt, wie es scheint, aus dem Äther: Die RIAS-Nachrichten melden zur Dämmerstunde, das Berliner Landgericht habe den NS-Richter Rehse vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. „Wie auf einer zweiten Tonspur” vernimmt der junge Mann in diesem Moment den Auftrag, den Richter Rehse selbst zu richten; den Richter, der den Vater seines besten Freundes, den Arzt und Widerstandskämpfer Georg Groscurth zum Tode verurteilt und am 8. Mai 1944 hat hinrichten lassen.
In der Figur des lebenslang selbstgerechten, niemals zur Rechenschaft gezogenen und von seinen Juristenkollegen in den Nachkriegsjahrzehnten geschützten Richters erscheint dem Studenten wie im Brennglas das gesamte Vergesslichkeits- und Verdrängungssyndrom der frühen Bundesrepublik vereint. Während den Rehses auch nach dem Krieg wieder Ämter und Würden winken, verliert Groscurths Witwe Anneliese wegen angeblicher DDR-Kontakte ihre Zulassung als Ärztin und wird auch sonst von den Behörden auf alle erdenkliche Weisen schikaniert. Wer angesichts solcher Ungerechtigkeiten nicht den Kopf verliert, der hat keinen, wird sich der junge Mann in diesem Augenblick gedacht haben.
Dabei neigt er keineswegs zur militanten Geste. Er ist kein Straßenkämpfer, kein Kulturrevolutionär, sondern ein werdender Literaturhistoriker und Autor, der den Mordplan genauso systematisch angeht wie sonst seine Seminare. Dass ihn keiner verstehen wird und muss, seine Freundin Catherine eingeschlossen, scheint ihm klar. Fürs Kino und andere Vergnügungen hat er bald schon keine Zeit mehr; er müsse „am Referat arbeiten”, belügt er seine Freundin. Nicht nur einen Mord hat er im Sinn, sondern auch ein Buch, das Buch zum Mord, den Mord zum Buch: „Das Buch”, so seine „Doppelstrategie”, „liefert das Motiv für den Mord, der Mord ist die Konsequenz aus dem Buch.” Die vier, fünf Jahre Haft für die Verwirklichung des genialen Plans will er bereitwillig absitzen.
In Gustav Heinemanns Kanzlei
Das „Referat”, als dessen endgültige Ausarbeitung man sich diesen Roman vorzustellen hat, führt den Studenten zu Anneliese Groscurth, der Witwe des Hingerichteten, es führt ihn nach Ostberlin zu Wolf Biermann, der wiederum wichtige Informationen über Robert Havemann beisteuert, den Freund Groscurths und Mitverschworenen in einer „Europäische Union” genannten Widerstandszelle, der nun abgeschirmt und unter ständiger Bewachung im Ostberliner Hausarrest sitzt. Sie führt ihn zurück in das oberhessische Dorf, in dem er in den fünfziger Jahren Axel Groscurth und seinen Bruder Rolf kennen lernte, die man aus Berlin in die Sommerferien zur Tante geschickt hatte. Allmählich fügt sich daraus das Bild Georg Groscurths, der als Leibarzt von Rudolf Heß zur medizinischen Elite des NS-Staates zählte und zugleich mit Robert Havemann und einer Handvoll Eingeweihter den Widerstand organisierte; das Bild eines Mannes, zu dessen Andenken zwar 1977 im Bezirk Pankow eine Straße benannt wurde, den zu ehren man sich im Westen dagegen nur zögernd bereit fand.
Auch die Rehabilitierung seiner Frau, über die man zeitweilig ein Berufsverbot verhängt hatte, erfolgt erst am Ende der sechziger Jahre (unter Beteiligung der Essener Anwaltskanzlei des wenig später zum Bundespräsidenten gewählten Gustav Heinemann). Man hat keine Mühe zu verstehen, was den Studenten Delius in seinen moralischen Ausnahmezustand getrieben hat. So wie Georg Groscurth einst allein den Kampf gegen Hitler aufnahm, will er nun ein Fanal gegen einen Staat setzen, der dem Richter die Rente sichert und sie der Witwe seines Opfers streicht. Widerstandskämpfer sein ist indes das eine, sich zum Widerstandskämpfer stilisieren das andere. In der Ermannung des Germanistikstudenten zur Selbstjustiz spiegelt sich der generationstypische Zug zur moralischen Selbstüberhebung und -erhöhung.
Delius Buch, ein Bericht eher als ein Roman, ist in einer nüchternen, manchmal geradezu hölzernen Sprache geschrieben, die jeden Überschwang und jede Verklärung meidet. Anders als seine Kommilitonen, die damals die blaue Blume rot malen wollten, ist Delius trotz seiner Mordgedanken mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen geblieben - was ihm den Rückweg in geordnete Verhältnisse erleichtert haben mag (1971 wird er mit der Arbeit „Der Held und sein Wetter” in Germanistik promoviert). Von ferne sieht sein Mörderprojekt den situationistisch-surrealistischen Strategien der „Kommune 1” ähnlich; doch finden sich weder in Delius damaligem Plan noch in seinem heutigen Bericht Indizien dafür, dass ihn die ästhetische, die theatralische oder performative Seite seines Vorhabens irgendwie interessiert hätte.
Eher gewinnt man aus seinem Buch den Eindruck, er habe mit den aktionistischen Umtrieben seiner Genossen schon damals nicht viel anfangen können. So erzählt Delius von einer Lesung mit Günter Bruno Fuchs im Haus am Waldsee in Zehlendorf. Es war, schreibt er, „während der Hochkonjunktur der Prinzipienreiterei, als die Simpelköpfe aus dem eben erschienenen Kursbuch 15 den Tod der Literatur herauslasen, in der Zeit, als das Schreiben zumindest nützlich zu sein hatte und in der fast keine Lesungen stattfanden, weil jeder Veranstalter Störungen fürchtete”.
Mit Störern will der junge, ernsthafte Mann nichts zu tun haben. Er hat ein anderes, ein ernsthafteres und riskanteres Projekt, an dem sich der Nutzen der Literatur ebenso ermessen wird wie der der Tat. Aus der Tat ist nichts geworden, aber das Buch haben wir, verspätet, bekommen. Es ist ein stocknüchternes Buch geworden, aber das tut seiner Wirkung keinen Abbruch oder steigert sie noch. „Mein Jahr als Mörder” ist gewiss eines der trockensten, aber auch der ernsthaftesten Bücher dieses Herbstes.
CHRISTOPH BARTMANN
FRIEDRICH CHRISTIAN DELIUS: Mein Jahr als Mörder. Roman. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2004. 304 Seiten, 19,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

"Mein Jahr als Mörder": F. C. Delius blickt auf seinen Zorn zurück / Von Jörg Magenau
In der Geographie der Erinnerung liegt Wehrda zwischen Prousts Combray und Günter Grass' Danzig. Benötigte man dort Gebäck beziehungsweise Brausepulver, um das literarische Gedächtnis zu vitalisieren, so braucht man fürs hessische Wehrda eine gut abgehangene Leberwurst. Das behauptet jedenfalls Friedrich Christian Delius, der es wissen muß, denn er ist in Wehrda aufgewachsen. Hierher führen die Erinnerungen zurück, die in seinem neuen Roman in mehreren Schichten übereinander abgelagert sind: 1968, fünfziger Jahre, NS-Zeit - und darüber die Gegenwart als Zeit des Erzählens und Erinnerns. Die Epochen sind nicht säuberlich zu trennen, sondern ineinander verwirkt. Delius geht deshalb nicht chronologisch vor. Er führt die einzelnen Abschnitte parallel und zeigt darin die Macht des Verdrängten, die unerlöste Gegenwart der Geschichte in jedem Augenblick.
"Mein Jahr als Mörder" ist ein Buch über Deutschland im zwanzigsten Jahrhundert. Es beginnt im Jahr 1968. Der Ich-Erzähler war damals Literaturstudent in West-Berlin. Aus den Nachrichten des Rias erfährt er, Hans-Joachim Rehse, einst Richter am nationalsozialistischen Volksgerichtshof unter Freisler, sei freigesprochen worden. Spontan beschließt er, diesen Mann zu ermorden. Denn Rehse hat den Vater seines besten Freundes Axel auf dem Gewissen, mit dem zusammen er die Nachkriegssommer der Kindheit in Wehrda verbrachte. Dieser unbekannte Vater, Georg Groscurth, war zusammen mit Robert Havemann führender Kopf der Widerstandsgruppe "Europäische Union". Ende 1943 wurde er verhaftet, von Rehse zum Tode verurteilt, im Mai 1944 in Brandenburg-Görden mit dem Fallbeil hingerichtet. "Kopf abgehackt" heißt das Kapitel, in dem der Junge davon erfährt und sich dieses Kopfabhacken so vorstellt, wie er es vom Schlachten von Hühnern kennt.
Sein Mord- und Racheplan führt mitten hinein ins Jahr 1968. Gewalt ist in dieser Zeit kein abwegiger Gedanke. Martin Luther King und Robert Kennedy wurden ermordet, Rudi Dutschke niedergeschossen, es gab Massaker in Vietnam und Mexiko, einen Aufstand in Paris und russische Panzer in Prag. Da wurde, mit einer Parole der Studenten, "Widerstand zur Pflicht". Konkrete politische Handlungen waren gefragt; alle Theorie mußte in Aktion münden, und auch die Literatur bewies ihren Wert erst in der Handlungskonsequenz. Delius' Erzähler beginnt nun mit Recherchen über den Richter R. und vor allem über Georg Groscurth. Er will gewissermaßen das Buch zur Tat schreiben. Es soll erscheinen, nachdem er seinen guten und gerechten Mord begangen haben wird. So stellt er sich das perfekte Marketing vor.
Mein Jahr als Mörder" ist eine spannende Dokumentation. Man sollte den Text weniger als Roman denn als Sachbuch lesen, damit der brisante Stoff nicht im Reich der Fiktionen neutralisiert wird. Delius, mit Groscurths Söhnen von klein auf befreundet, hat dafür zahlreiche Gespräche geführt, Aktenmaterial und Briefe gesichtet, die Autobiographie des Verlegers Hermann Kindler gelesen, der in der "Europäischen Union" mitarbeitete, und aus Ruth Andreas-Friedrichs Tagebuch "Der Schattenmann" den Bericht eines Augenzeugen über die Hinrichtung zitiert. Die Romanhandlung ist gegenüber dem Faktenmaterial fast nebensächlich.
Georg Groscurth arbeitete als Arzt im Berliner Robert-Koch-Krankenhaus. Weil jüdische Ärzte dort nach 1933 entlassen und durch SA- und SS-Ärzte ersetzt wurden, war er einer der wenigen kompetenten Mediziner. Führerstellvertreter Rudolf Heß vertraute ihm, machte ihn sogar zu seinem Leibarzt. Im Schutz dieses Verhältnisses konnte Groscurth zusammen mit dem Chemiker Robert Havemann, dem Dentisten Paul Rentsch und dem Architekten Herbert Richter und rund zwanzig anderen die "Europäische Union" aufbauen. Sie halfen Zwangsarbeitern und Menschen in der Illegalität, arbeiteten mit Tschechen, Slowaken, Polen, Russen zusammen, versteckten Juden, versorgten sie mit Lebensmitteln.
Groscurth wollte praktische Hilfe leisten. Delius zeichnet ihn als tätigen Humanisten ohne konkrete politische Ziele, der in der Zeit der Barbarei durchhalten wollte bis zum Ende des Krieges und der nationalsozialistischen Herrschaft. Anders Robert Havemann, der nicht gut wegkommt: Er suchte Kontakt zu den Sowjets, druckte mit großem Risiko Flugblätter, gefährdete aus "Ehrgeiz und Eitelkeit" die Gruppe und machte sich dadurch mitschuldig am Tod der Freunde. Havemann war der einzige, dessen Todesurteil nicht vollstreckt wurde, weil es ihm gelang, die kriegsentscheidende Bedeutung seiner Forschung glaubhaft zu machen. Der weitere Lebensweg Havemanns nach dem Krieg, vom überzeugten Stalinisten zum führenden Dissidenten der DDR, ist bekannt.
Vergessen dagegen ist das Schicksal von Anneliese Groscurth, der Witwe des hingerichteten Arztes, die selbst in der "Europäischen Union" mitarbeitete. Sie ist die eigentliche Heldin des Buches, ihr gilt alle Sympathie. Ein ums andere Mal schärft sie dem Ich-Erzähler ein: "Es gab keine Helden." Es gab bloß "ein paar anständige Leute". Mit wenigen Prinzipien kommt sie aus: Sie ist für den Frieden, gegen Remilitarisierung, gegen Nazis. Damit aber, und politisch eher naiv, gerät sie in Widerspruch zur bundesdeutschen Restauration unter Adenauer. In ihrer Wohnung findet 1951 die Pressekonferenz einer "Volksbefragung" gegen die Wiederbewaffnung statt. Der West-Berliner "Tagesspiegel" machte daraus eine "kommunistische Volksbefragung" und entschied mit der Hinzufügung des Wörtchens "kommunistisch" ihr Schicksal für Jahrzehnte. Anneliese Groscurth galt in West-Berlin daraufhin als Parteigängerin der DDR und wurde wie eine Hexe verfolgt. In dieser irrsinnigen Zeit galt der Satz: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Im Kalten Krieg gerieten ausgerechnet die Menschen in Verdacht, die schon den Nazis verdächtig waren.
Anneliese Groscurth wurde an den Pranger gestellt. Sie verlor ihren Rentenanspruch als Verfolgte des Naziregimes, während gleichzeitig alle ehemaligen NS-Beamten ihre Rente rückwirkend beanspruchen durften und eine Beschäftigungsgarantie erhielten. Sie verlor ihren Job als Bezirksärztin und fand eine Stelle nur noch beim "Berliner Rundfunk" in der Masurenallee - einer DDR-Institution im Westen. Nach dem Mauerbau zog der Sender nach Ost-Berlin um. Sie wohnte weiter im Westen und arbeitete nun im Osten: Ausdruck ihrer Stellung zwischen den Machtblöcken. Einen Reisepaß verweigerten ihr die Behörden mit der atemraubenden Begründung, sie agitiere gegen die freiheitliche Grundordnung. Ein unsinniger Vorwurf. Sie mußte prozessieren und verlor erneut. Zwanzig Jahre dauerte der zähe Kampf mit den Gerichten, die wie eine vielköpfige Hydra gegen sie agierten. Delius berichtet, unter welch fragwürdigen Bedingungen der bundesdeutsche Rechtsstaat seine Arbeit aufnahm. Wie gründlich die Grenze zur ideologischen Urteilsbegründung überschritten wurde. Wie eine Humanistin zur Staatsfeindin gemacht wurde. Erschreckend deutlich wird die Kontinuität zu Gerichten des Dritten Reiches. Ein Rechtsstaat fällt eben nicht vom Himmel.
Die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit hat nach 1989 in Vergessenheit geraten lassen, daß es auch im Westen politisch motivierte Rechtsbeugung gab. Hätte sich diese Geschichte in der DDR ereignet, würden wir Anneliese Groscurth heute als Dissidentin bezeichnen. Es ist das Verdienst von Delius, an die Ursprünge der Bundesrepublik zu erinnern und damit auch die Achtundsechziger-Generation in ihrem Gerechtigkeitsdrang und ihrer Wut gegen die Verdrängung des nationalsozialistischen Erbes ein wenig zu rehabilitieren. Er zeigt aber auch die absurde Ideologisierung der Studenten, ihre Kleingruppenfraktionierung und ihren Wahrheitswahn, ihre Militanz und ihren gnadenlosen Gruppenzwang.
Indem er den Bericht seines doch eher braven Ich-Erzählers - der natürlich auch den geplanten Mord niemals ausführt - als "Beichte" bezeichnet, gibt er dem gegenwärtig herrschenden, den Achtundsechzigern gegenüber kritischen Zeitgeist jedoch etwas zu stark nach. Bei aller Kritik an einstigen "Jugendsünden": Muß man auch die Ernsthaftigkeit, mit der damals gedacht und gehandelt wurde, diskreditieren? Ist der Ernst der Lebensführung und des politischen Wollens nicht vielmehr eine Qualität, die verlorenging und nach der man sich im postironischen Zeitalter des Pragmatismus schon wieder zu sehnen beginnt? Schließlich ist es doch gerade die ernste Entschlossenheit der Recherche, die "Mein Jahr als Mörder" auszeichnet.
Friedrich Christian Delius: "Mein Jahr als Mörder". Roman. Verlag Rowohlt Berlin, Berlin 2004. 304 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main