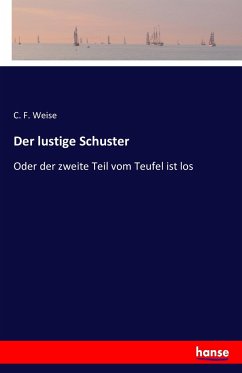Eine kleine Sensation darf man diesen Fund wohl nennen, denn das Erzählwerk Johann Peter Hebels ist schmal und kanonisch und neue Texte sind seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum bekannt geworden. In zwei Zeitschriften aus diesem Halbjahrhundert hat Heinz Härtl nun bisher unbekannte und unerkannte Geschichten des großen Erzählers gefunden, dazu Texte, die wenn nicht von ihm, so doch zweifellos aus seinem Umkreis stammen oder neue Versionen bereits bekannter bieten. Die rund zwanzig Geschichten werden in dieser Edition unter Beibehaltung der zeitgenössischen Orthographie und Zeichensetzung gedruckt. Das Nachwort des Herausgebers erläutert Kontexte und Besonderheiten der Geschichten, insbesondere ihren Zusammenhang mit den Publikationsorganen, in denen sie gefunden wurden. Daniel Kehlmann steuert eine Einführung in Leben und Werk Hebels bei.

Der immanente Einspruch: In zwei Dutzend bislang unbekannten, jetzt Johann Peter Hebel zugeschriebenen Anekdoten überkreuzen sich Moral und Interesse produktiv.
Stammt die Anekdote "Wahrheit, die man für Anekdote nehmen kann" von Johann Peter Hebel? Der Autor bedenkt im Titel die Eigenart der Gattung: Zwar sei die Wahrheit der Maßstab einer Anekdote, doch entscheide die Anekdote über den Sinn jener Wahrheit. Wie der Titel die Begriffe miteinander verschränkt, so folgt auch die Geschichte, die dann erzählt wird, einem strengen Formschema: Das Gesetz, das der König von Preußen für seine Offiziere eben verfügt hat, erlaubt diesen eine Heirat erst mit einem gewissen Vermögen. Einer der Offiziere, der sich lange vor dieser Verordnung seinem geliebten "braven Mädchen" versprochen hat, trägt dem König sein Dilemma vor und gibt ihm die Gestalt eines Chiasmus: Folgt - dem Gesetz nach - das Versprechen dem Vermögen, so ging bei ihm das Versprechen voraus. Da nun weder der König das Gesetz aufheben noch der Offizier sein Gelübde brechen kann, will dieser aus dem Dienst ausscheiden. Der König, dem die Verpflichtung, sei es eine gesetzliche oder eine private, über alles geht, öffnet seine Schatulle und stattet den Offizier mit dem nötigen Geld aus. Allein die Tat, die überrascht, weil sie vom einen Pol: dem Vermögen des Königs, über Gebühr zehrt, vermag die Regeln und Werte zu versöhnen, die über Kreuz liegen.
Die Anekdote gehört zu gut zwanzig Geschichten, die Heinz Härtl im Karlsruher "Provinzial-Blatt der Badischen Markgravschaft" von 1805 sowie im siebten Jahrgang 1842 des "Preussischen Volksfreundes" (Berlin) entdeckt hat. Die anonymen Veröffentlichungen im "Provinzial-Blatt" schreibt Härtl in einem Stilindizienbeweis Hebel zu, ohne allerdings editorische Gewissheit geben zu können. Die Funde, die insgesamt fünfzig Druckseiten ausmachen, sind daher nicht leicht zu bewerten. Vier der Anekdoten aus dem "Provinzial-Blatt" tragen den Nachweis "A.d.N.Z.d.T." und sind (worauf Adrian Braunbehrens inzwischen hingewiesen hat) tatsächlich wortgetreu der "National-Zeitung der Teutschen" (Gotha) entnommen. Der Schluss liegt nahe, dass auch die übrigen Anekdoten von anderen Gazetten abgeschrieben sind. Die Nähe zu Hebel ist daher, selbst wenn die Annahme des Herausgebers trügt, als Diskursphänomen bemerkenswert, als verbreitete Neigung, sich in der Gattung zu reflektieren, die Hebels poetischer Form der Aufmerksamkeit nicht entgehen konnte.
Der Diskurs schärfte die Verstandessinne. Meist sind die Pointen kaum erkennbar, die den Einspruch formulieren. In der Anekdote "Muthvolle Entschlossenheit" rettet die Frau den Reiter, einen "edlen Mann", der sich mit einer Belohnung erkenntlich zeigen will, doch die "noch edlere Jungfrau" sieht ihren Lohn in der eigenen guten Tat und weist das Geld zurück. In der Anekdote "Gelassenheit" siegt die Schlauheit eines Quäkers über die Gewalt des Bauern, der ihn überfällt und dem er gern auch sein Pferd im Tausch überlässt, weil das Pferd des andern ihn später stracks zum Räuber führen wird. Der Bericht "Drey Luftschiffer" endet - sympathetisch - mit dem Scheitern von drei Männern, nachdem lange der Erfolg eines vierten berichtet, indes durch die Angabe der von ihm erreichten Höhe, "die wenigstens um 1000 Fuß den Chimboraco übertraf": das wären über 6500 Meter, fast unmerklich in Mitleidenschaft gezogen wird. Mit feinem Witz erweitern diese Anekdoten die Welt, deren Menschlichkeit mit der Absurdität entsteht. Ein Abgrund, sei er kirchlich, industriell oder politisch, wird den Leser im Spiel nicht überwältigen. Mittel, das zu verhindern, stehen der Gattung, wie die Beispiele zeigen, reichlich zu Gebote: die Betonung in der Wiederholung eines Worts, die zu leise ist, um sie Übertreibung nennen zu dürfen; oder das Einsprengsel, das eher wie ein Schreib- oder Assoziationsversehen wirkt; die Listigkeit, die zu leicht gelingt; der Reichtum, der auffällig ohne Einspruch bleibt, ja banal endet; auch der Edelmut, der allzu selbstlos ist. List, Gier und Edelmut unterlaufen sich solcherart in den Geschichten des "Provinzial-Blatts" ständig.
1805 ist Hebel fünfundvierzig Jahre alt, er unterrichtet als Professor ohne Predigtverpflichtung an seiner ehemaligen Schule, dem Karlsruher Gymnasium illustre, hat zwei Jahre zuvor die "Allemannischen Gedichte" veröffentlicht und schreibt seit 1802 für den "Badischen Landkalender", der später in "Der Rheinländische Hausfreund" umbenannt wird. Aus seinen Beiträgen zwischen 1803 und 1811 stellte Hebel dann das Buch zusammen, das seinen Ruhm begründete: das "Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes". Anders als die Anekdoten, die der Karlsruher Verleger Christian Friedrich Müller, der für sein "Provinzial-Blatt" fortwährend gegen die Zensur des badischen Hofes zu kämpfen hatte, zum Druck brachte, erschienen die Geschichten von 1842 postum; von den drei längeren waren zwei ("Franziska" und "Herr Charles") bereits aus dem "Rheinländischen Hausfreund" beziehungsweise den "Rheinblüten" bekannt.
Als Vorabdrucke waren sie in Cottas "Morgenblatt für gebildete Stände" erschienen und wurden in Berlin zur Grundlage eines Redigats, darunter auch die Hebel hier erstmals und in Anbetracht des Stils mit Recht zugeschriebene Erzählung "Der Schuster Flink". Hebels Geschichten leben von der Zuspitzung. Insofern sie "wirklich" sein wollen, drängt sich die Gewissheit auf, dass Hebels Welt schon als erlebte fiktiv sein muss - seine Briefe zeugen von solch einer modernen, ästhetischen Haltung. Die Anekdote wird zum Muster einer Kunstlebensform. Die Pointe erwächst mitten aus den Texten - darin besteht deren Wahrheit - und macht Rettung möglich. Der Einspruch ist nicht kontrapunktisch gesetzt, sondern kommt von innen, entspringt - völlig diesseitig - einer Identität. Dabei macht sich der Dichter das theologische, erbauliche Perorieren dienstbar, um die dem chiastischen Prinzip nötigen Pole zu schaffen. Aufmerksamkeit und Remedur gelten den hinfälligen Menschen: "Wohl denen unter Hebels Geschöpfen", schrieb Walter Benjamin im Jahr 1933, "mögen es Spitzbuben oder Juden sein, die den Humor in ihm erwecken; wehe denen, vor welchen er ihm versagt."
Auch wenn die Anekdoten ans Ende eine Moral setzen, die dem Interesse widersprechen soll - um wie viel empfindlicher muss das Ohr sein, das Hebel hier verlangt, wo die laute Moral nur auf den ersten Blick die Moral der eben erzählten Geschichte bleibt. So führt im "Schuster Flink" die Hinnahme des übersteigerten Unglücks schließlich zur Rettung. Sieben Kinder haben er und seine Frau Eva zu ernähren; von den Zwillingen, die hinzukommen, wollen sie eines dem reichen Kaufmann auf die Schwelle legen. Doch der öffnet rasch die Tür und reicht dem Schuster ein Neugeborenes, das andere ihm schon hingelegt haben. In äußerster Not, denn nun sind es plötzlich zehn statt sieben Kinder, beweisen die armen Leute Großmut und entscheiden, alle zu behalten. Die Lösung bringt zuletzt das fremde Kind, in dessen Decke sich eine Mitgift findet, die für die gesamte Familie reicht. Als Moral wird ausgegeben: "So kommt Gott, eh' wir uns verseh'n, und lässet uns viel Gut's gescheh'n." Hintersinnig führt die Moral die Erzählung fort und hat sie doch von hinten her aufgerollt. Die Übertreibung macht die Rettung schrittweise unwahrscheinlicher und lässt Gottes Gegen-Aufwand riesig wachsen. Zuletzt erweist sich der Glaube, dass im Gottvertrauen das Interesse der Leidenden sich erfülle, selbst als interessiert. Alles, auch die Gedankenfiguren der orthodoxen protestantischen Seelsorge oder die Predigtsprache, die Hebel und seinen Lesern geläufig ist, nimmt der pointenwillige Menschendichter zu seinem Material.
CHRISTOPH KÖNIG
Johann Peter Hebel: "Der Schuster Flink".
Unbekannte Geschichten. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Heinz Härtl. Vorwort
von Daniel Kehlmann. Wallstein Verlag, Göttingen 2008. 92 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die Echtheit bleibt fraglich: 25 neu aufgetauchte Geschichten von Johann Peter Hebel
Sind die rund fünfundzwanzig Texte dieses schmalen Bandes wirklich die „unbekannten Geschichten” Johann Peter Hebels, als die sie angekündigt werden? Daran hat Daniel Kehlmann, der ein Vorwort beisteuert, keine Zweifel und der Herausgeber Heinz Härtl nur geringe. „Welcher Karlsruher”, fragt Härtl, „sollte 1805 ‚Der edelmüthige Landmann’ geschrieben haben, wenn nicht Johann Peter Hebel? Wenn sich seine Autorschaft auch nicht beweisen lässt, ist sie doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen (. . . ) Und wenn Hebel als Verfasser des ‚Edelmüthigen Landmanns’ wahrscheinlich ist, dann ist er auch verdächtig, die unmittelbar davor stehende Geschichte ‚Der kluge Bauer und der dumme Dieb’ geschrieben zu haben, und wenn das anzunehmen ist, dann fällt derselbe Verdacht auf die motivisch parallelen und kontrastiven, die vierzehn Tage zuvor im Provinzial-Blatt erschienen waren.”
Ein Zug von Ehrlichkeit
Diese Domino-Theorie der Zuschreibungen besitzt nicht so viel zwingende Kraft, wie sie vorgibt. Rhetorischen Fragen an zentraler argumentativer Stelle misstraue man. Hebels Werk ist eng an das Almanach- und Zeitschriftenwesen seiner Epoche gebunden, und periodi-sche Publikationen leben nun einmal davon, dass hier nicht nur Einer steht, sondern Viele am selben Strang ziehen. Um die Frage: Hebel – ja oder nein? beantworten zu können, hilft wohl nur, parallel zu diesem neuen Band einen zweiten mit Hebels gesicherten Werken zur Hand zu nehmen und beides auf sich wirken zu lassen.
Mit der sprachorientierten Stilkritik allein wird man nicht durchdringen. Stil gehört der Epoche an (hierin täuscht sich ein Nachgeborener sehr leicht), und Stil lässt sich lernen. Weit schwerer ist es, eine Haltung nachzuahmen. In der kurzen Anekdote „Ein schöner Zug von Ehrlichkeit” geht es darum, dass nach der Versteigerung eines Nachlasses unvermutet hundert Louisd’or in einem Tintenfass auftauchen. Sie schließt: „Der edelmüthige Finder eilt zu dem Notar; ‚die Kinder’, ruft er beym Eintritte in dessen Zimmer mit freudiger Stimme, ‚die Kinder von *** sind um 100 Louisd’or reicher geworden', und dabey hielt er ihm das Geld entgegen. Dieser Zug von Ehrlichkeit ist zu selten und zu schön, als daß er nicht eine Erwähnung verdienen sollte.”
Nicht, als ob Hebel diese Tat nicht von Herzen gebilligt hätte. Aber es wandelt hier der Edelmut auf einem allzu glatten und geraden Weg; der Vorfall gibt dem Leser nichts zu denken, als Anekdote ist der Text verfehlt. Insbesondere hätte sich Hebel wohl den letzten Satz verkniffen, der die Geschichte in eine Art moralischen Schlafrock hüllt, damit sie es sich darin so richtig gemütlich machen kann. Der Wunsch, sich dermaßen ausschließlich bloß rühren zu lassen, wie es hier geschieht, ist Hebel fremd, dafür besitzt er zu viel moralische Intelligenz.
An dieser seltenen Ressource fehlt es den hier versammelten Geschichten sämtlich. An deren Stelle setzen sie das Erbauliche, und an die Stelle von Hebels kalkulierter Einfalt das schlechthin Simple. Eine Überschrift wie „Deutsche Rechtlichkeit” würde Hebel nicht wäh-len, er hätte es sich vielmehr angelegen sein lassen, die Rechtlichkeit als eine übernationale Tugend zu erweisen und sie daher wohl eher beim französischen Feind aufgespürt, als so plump die Partei der Eigenen zu ergreifen.
Die titelgebende Geschichte vom Schuster Flink fängt nicht schlecht an: Der völlig verarmte Schuster kann mit genauer Not seine sieben Kinder ernähren, als seine Frau wieder schwanger wird, sie sehen bang dem achten entgegen – da kommen Zwillinge zur Welt. Das geht überhaupt nicht mehr, schweren Herzens entschließen sich die Eltern, einen der Zwillinge einem reichen Kaufmann als Findelkind auf die Schwelle zu legen. Als der Schuster es gerade tun will, packt ihn der Kaufmann aus dem Hinterhalt – „Hab ich Dich, du Spitzbub!” – und drängt ihm ein quäkendes Bündel auf, bei dem es sich, wie bald klar wird, um ein anderes Findelkind handelt, das gerade eben erst hier ausgesetzt worden ist. Der völlig verwirrte Schuster, der nicht zu Wort kommt, tritt den Heimweg statt mit null mit zwei Kindern im Arm an. Der Weg von den sieben über acht und neun zu zehn wird als einer der wachsenden Verzweiflung sehr eindrücklich gestaltet.
Dann aber zerhaut die Geschichte den Knoten auf, man kann es nicht anders sagen, dumme Weise, dumm im Erzählerischen wie im Moralischen, die man hier nicht trennen kann: Es stellt sich heraus, dass, in die Decken des fremden Kindes eingewickelt, hundert Taler stecken sowie die schriftliche Zusage, der getreue Findelvater dürfe auch künftig auf kräftige finanzielle Unterstützung rechnen. Wie kann so etwas sein? Im Horizont der Geschichte ist der Akt der Aussetzung an die krasse Not gebunden, ein Findelkind mit Geld ein textlogischer Fremdkörper. Es kann nicht von Hebel stammen.
Der gefräßige Familiensinn
Dass die vorliegenden Texte an Hebels Hauptwerk nicht heranreichen, geben sowohl Kehlmann wie Härtl zu. Aber sie scheinen das für ein eher graduelles Problem zu halten. Auf die Möglichkeit, dass er sie doch nicht geschrieben haben sollte, reagiert Härtl mit einer Art von vorauseilendem Trotz: „Sie gehören in jedem Fall, ob Hebel nun an ihnen Anteil hatte oder nicht, zum Kontext seiner Geschichten.” Das eben sei bestritten. Gleichgültig wie sehr sie sich in ihrem Stil und ganzen Habitus von ihm inspirieren lassen: Diese Texte widersprechen seinem Geist, jener Mischung aus dem bodenständig Konservativen mit dem Kosmopolitismus des wahren Aufklärers, und verraten ihn an den gefräßigen Familiensinn, an die kollektive Stilldemenz des heraufziehenden Biedermeier. BURKHARD MÜLLER
JOHANN PETER HEBEL: Der Schuster Flink. Unbekannte Geschichten. Mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Heinz Härtl. Wallstein Verlag, Göttingen 2008. 92 Seiten, 18 Euro.
Johann Peter Hebel (1760-1826), der Meister der kalkulierten Einfalt. Foto: Scherl
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Ist das überhaupt Hebel? Schön wär's, meint Manfred Koch, denn zu den Bewunderern des alemannischen Mundartdichters Johann Peter Hebel gehörten seinen Informationen zufolge Jean Paul, Goethe, Tolstoi und auch Walter Benjamin. Doch nur zwei der in "Schuster Flink" versammelten fünfundzwanzig Texte stammen sicher von Hebel, wie Koch den Herausgeber der kritischen Hebel-Ausgabe Adrian Braunbehrenes zitiert. Absolut unverständlich findet der Rezensent die Leichtigkeit, mit der Herausgeber Heinz Härtl zwanzig 1805 anonym publizierte Texte Hebel zuschreibt. Härtls Argument "Wer, wenn nicht Hebel?" findet der erboste Koch philologisch allzu unbedarft, und die meisten Texte darüber hinaus "schlicht belanglos". Über Daniel Kehlmanns Vorwort verliert der Rezensent dann gar kein Wort mehr.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
'Es handelt sich um hübsche kleine Texte in Hebels Manier, nicht um Glanzstücke wie 'Unverhofftes Wiedersehen', aber um charmante Petitessen, die jeden Kenner erfreuen werden.'(NZZ, 23.3.2008)'Hebels Geschichten leben von de