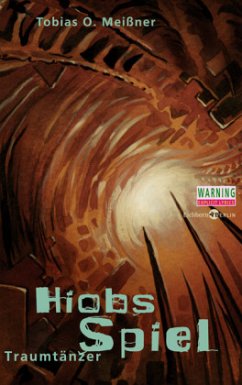Produktdetails
- Verlag: Eichborn
- Seitenzahl: 400
- Erscheinungstermin: August 2006
- Deutsch
- Abmessung: 221mm x 148mm x 39mm
- Gewicht: 675g
- ISBN-13: 9783821857893
- ISBN-10: 3821857897
- Artikelnr.: 20837898

Gefangene werden nicht gemacht: Tobias O. Meißners Splatter-Gnosis / Von Lorenz Jäger
Brutal ist gar kein Ausdruck. Tobias O. Meißner ist vielmehr der unbestrittene deutsche Meister in einer künstlerischen Manier, die man eher aus dem Film kennt als aus der Literatur: in der Welt der Grausamkeit, dessen, was man "Splatter" nennt, von dem uns Quentin Tarantino oder David Cronenberg eine erste Ahnung gegeben haben. "Meister" will hier zweierlei besagen: Zum ersten, er beherrscht so viele Variationen des Blutrünstigen und des Phantastischen, daß man gleichsam gegen das eigene Gewissen mit wachsendem Genuß der Geschichte des Hiob Montag folgt, bei der man mit dem Zählen der Niedergemachten kaum nachkommt. Zum zweiten, Meißner hat ein so deutliches Empfinden für literarische Qualität und Tradition, daß man selbst dem Geschmackswidrigsten nicht wenig abgewinnen kann.
Also Vorsicht: Dies ist kein "guter Roman" im Sinne der netten, gebildeten Buchhändlerin, die uns auch nie im Leben wird versichern können, es "selbst gelesen" zu haben. Die Warnung steht ja schon auf dem Umschlag: "Explicit Lyrics" - aber das ist eine höfliche Untertreibung des Autors. Im zunehmend weiblich dominierten Betrieb der anerkannten höheren Literatur wird sich Meißner wohl nicht durchsetzen können, aber das kümmert ihn mit Recht sehr wenig. Er hat eine verschworene Gruppe von Lesern, die dem Buch den Weg bereiten werden.
Anders als im "Paradies der Schwerter", Meißners vorletztem, vielbewundertem Roman, sind hier alle, die übereinander herfallen und sich metzeln, sich durch wüste Hundemeuten und wiedergeborene Samurai, durch Schnee und Feuer und Schlamm mit Panzerfaust oder Taschenmesser hindurchkämpfen, Dämonen in die Flucht schlagen und Gefangene grundsätzlich nicht machen - Gotteskrieger. Krieger eines guten Gottes also, des "monotheistischen", von dem wir derzeit so viel hören?
Nein, ganz so ist es doch nicht. Meißner ist Gnostiker. Die antike Gnosis hatte ja zwischen den Vater und den Sohn, den Schöpfer und den Erlöser eine unübersteigbare Barriere gelegt: Der Vater konnte danach der gute, der gnädige Gott nicht sein. Die Kirche hat diese Lehren verurteilt, aber in religiösen Krisen und den darin gärenden Grübeleien erheben sie stets aufs neue, wie nach einem Naturgesetz, ihr Haupt. Zweifel am "guten" Gott hat schon der Hiob des Alten Testaments. Nicht ganz zu Unrecht - wird er doch zum Gegenstand eines Abkommens zwischen Gott und dem Widersacher.
Die antike Gnosis war Sache einer Elite, die neue ist ein Glaube der Unterschicht. Hiob Montag, ein junger Mann im Berlin der neunziger Jahre, sieht die Welt nicht versöhnt und von oben, sondern meist von sehr weit unten, wo die Junkies und die jungen Türkenbosse den Ton angeben. Beherrscht wird dieses Berlin von einer zweideutigen, heilig-unheiligen Sphäre, die sich "Wiedenfließ" nennt, ein bißchen an schöne deutsche Ortsnamen erinnernd. Das höchste Wesen aber trägt einen Namen, der aus fernen Comic- oder Mangawelten zu stammen scheint: NuNdUuN. Hiob läßt sich mit ihm auf ein Spiel ein, bei dem er meist vernichtend, seinerseits in Lebensgefahr, durch die Metropole zieht, damit aber "Punkte" im Spiel macht und so die großen Schläge NuNdUuNs gegen die Menschheit einstweilen aufhält.
Das sind, zugegeben, ziemlich haarsträubende Voraussetzungen für einen Roman, und man würde sich kaum darauf einlassen, wenn nicht die Beobachtungen, die dabei abfallen, so überaus triftig wären. Schon seine eigene Rolle beschreibt der neue Hiob ja mit großer Einsicht, wenn er sich beklagt, wie privilegiert ein Dante sich dem Jenseits nähern konnte, mit Vergil als Führer, während er selbst wie ein Hartz-IV-Empfänger vor den Pforten der Einweihung steht: "Nach mir jedoch verlangte niemand dort drinnen. Ich war einer von denen, die ungebeten klopfen und auf Einlaß drängen und die rumpöbeln, wenn nicht gleich aufgemacht wird."
Der schiere Witz und Geist, den Meißner aufbietet, kann am Ende auch dem Leser einleuchten, der ansonsten den Sicherheitsabstand zur subkulturellen Ästhetik des Grausamen wahrt. Ist es nicht einfach gut beobachtet, wenn Hiob sich einmal fragt: "Und warum zum Jacob waren Transvestiten nur immer so einfallslos und bieder, so auf Konformität bedacht, so schleimig und beifallheischend? Warum imitierten sie nicht mal seine Louise" - gemeint ist Louise Brooks - "oder Clara Bow oder Pola Negri oder Ella Raines oder andere wirklich coole und interessante Frauen? Nein, sie scharwenzelten immer nur als Marlene herum oder Marilyn oder Madonna, und gaben dem ganzen vielschichtigen Frau-Sein damit einen schalen und oberflächlichen Namen."
Tobias O. Meißner hat in den vergangenen Jahren alles darangesetzt, die Splatter-Welt, wie sie uns vor allem aus den Vereinigten Staaten bekannt ist, ins Deutsche zu bringen - sie auf deutsche Schauplätze, Geschichten, Mentalitäten, Gesichter oder, wie Meißner vielleicht sagen würde, Fressen zu projizieren. Dabei fallen Sätze ab, in denen das Idiom des kürzlich verstorbenen Mickey Spillane eine kongeniale Entsprechung in der Muttersprache findet: "Der Inspektor lächelte wieder. Hiob wußte jetzt, an wen ihn dieses Lächeln erinnerte: an Volker Rühe. Hiob hatte plötzlich Lust, den Bullen zu töten."
Für den Sex sorgt naturgemäß ein Succubus, genannt "Widder" nach dem Tierkreiszeichen. Die eine Schöne kann Hiob für alle stehen, denn sie verwandelt sich in das jeweils gewünschte Traumbild (manchmal aber auch, wenn sie allein zu Hause ist, in schleimiges Viehzeug à la Lovecraft). Ihr Gebrauch ist Teil des Paktes, den Hiob mit dem Gottesteufel, dem "Architekten des Leidens", geschlossen hat.
Das Buch ist der zweite Band von "Hiobs Spiel", einem auf unbestimmt viele Bände angelegten Werk. Aber auch ein Leser, der den ersten nicht kennt, findet ohne große Mühe in die eigentümliche dichterische Welt hinein, die Meißner ihm eröffnet. Er wird reichlich belohnt, nicht nur mit dem größten denkbaren Erfindungsreichtum in puncto Schundkunst, sondern auch mit einer kaum endenden Kaskade von Bildern aus der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, die an die Gegenwart heranreichen. So lauten die Schlußsätze des Buches: "Der Kinderspielplatz steht verlassen. Denn dieses Land, so heißt es oft, stirbt aus."
Tobias O. Meißner: "Hiobs Spiel. Zweites Buch - Traumtänzer". Eichborn Berlin, Frankfurt am Main 2006. 412 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Voll Freude am Trivialen und ungebremstem Splatter-Spaß: Tobias O. Meißners Roman „Hiobs Spiel”
Dieses Buch ist Kult. So süß dieses Wort in den Ohren der Verlagsbuchhaltung klingen muss, so wenig kann es als ein kritisches Lob gelten. Mit dem Begriff des Kults hat man das Reich der Schönheit, über die sich urteilen lässt, verlassen, und das Reich der Liebe betreten, in der alles Urteil zu schweigen hat – nur dass eben der Liebende wünscht, auch in den Augen des unbeteiligten Rests der Menschheit möge das Geliebte schön erscheinen, und zwar gerade das scheinbar Mangelhafte an ihm, die Warze in ihrer Anbetungswürdigkeit. Daher die Grundfigur des Trotzes, die in alle kultige Liebe eingesenkt ist. „Ihr wisst nicht, was wahre Schönheit ist!”, ruft sie den Anderen zu (denn immer sind hier die Anderen mitgedacht), womit sie eigentlich meint: Ihr habt von der Liebe keine Ahnung.
Welcher Autor will nicht vor allem geliebt werden? Aber Tobias O. Meißner wäre damit wohl nur zur Hälfte zufrieden; denn außer dass „Hiobs Spiel” Kult sei, will er es auch als Literatur im engen und emphatischen Sinn gestaltet und begriffen wissen. Das ist der erklärte, auf jeder Seite spürbare Doppelwille in all seiner juvenilen Grandiosität. Mit Erstaunen erfährt man, dass der Autor in diesem Jahr sein vierzigstes Lebensjahr vollenden wird, sodann, dass das Manuskript zuvor zehn Jahre ungedruckt gelegen hat; aber noch eher hätte man auf einen Zwanzigjährigen getippt. Es handelt sich um den zweiten Band einer ins Unendliche projektierten Reihe, eines Lebenswerks, das beiläufig die nächsten fünfzig Lebensjahre seines Urhebers verschlingen soll: Hiob, der Name ist Programm, nicht nur der Held heißt so, auch der ihn erfunden oder vielmehr auf sich genommen hat, ist Hiob; der Autor setzt sich als der Schmerzensmann des Unentrinnbaren. Der Schmerz schließt in sich Wahrheit, Reinheit, und darum zuletzt auch Schönheit. Wer daran nicht glauben mag, für den ist das Buch verloren; er wird auf der Haut dieses gewaltigen Corpus nur die Warzen sehen, Geschwüre vielmehr, und nicht, dass es in Wahrheit die Juwelen des Duldens sind.
25 menschliche Hirnschalen
Wenn der Leser erst mit dem zweiten Band eingestiegen ist, so macht das nichts. Das Rückgrat, von dem die Rippen vieler Einzelvorgänge abzweigen, ist kräftig und schlicht, und dass die nächsten Staffeln schon in Arbeit sind, daran braucht man nicht zu zweifeln. Die Erzählästhetik gehorcht den Vorgaben des Quests in seiner zeitgenössischen Erscheinungsform des Computerspiels. Das heißt, alle Geschehnisse tragen ziemlich gleichförmig episodischen Charakter, bauen aber dennoch klimaktisch aufeinander auf, indem gewisse Punktzahlen addiert und gewisse Gerätschaften zusammengeklaubt und verdient werden müssen, damit sich das nächste Level auftut. Zum Beispiel liegt der tiefere Sinn in den Aktionen eines japanischen Samurai-Serienkillers darin, dass er erst vierundzwanzig menschliche Hirnschalen besitzt (im eigenen Blut des Opfers zu einem ansprechend tief braunroten Farbton gekocht), erst das Hinzutreten einer fünfundzwanzigsten aber dem aus ihnen gefertigten Panzer die Qualität der Unverletzlichkeit verleiht. Mit einem Wort, es gehen bunt und ausdrucksvoll gestaltete Details an einem robusten Leitseil einher, bei einer gewissen Monotonie auf der mittleren Strukturebene.
So weit also Hiobs Spiel. Dass es aber auch Hiobs Spiel wird, verdankt sich der Eigenart dieses Autors, der ein starkes theologisches Interesse nimmt. Für das Bemerkenswerte am Buch Hiob sieht er es an, dass es zuletzt die Trennung von Gott und Teufel aufhebt. Zurecht wird dieses Buch von ihm für das widerwärtigste der ganzen Bibel erklärt. Hiob Montag wächst im Berlin der Neunziger auf, entstammt jedoch einem alten Magiergeschlecht, von dem allein sein in ein Pflegeheim verbannter Großvater noch übrig ist. Es wartet auf ihn die größte aller Aufgaben: Er soll dereinst Spieler werden (was sich ihm erst nur in Leidenszuständen aller Art ankündigt). Natürlich heißt das mal wieder nichts anderes, als die Welt zu retten. Nach dem Abitur verbringt er zwei Jahre als Eremit in der Familiengruft auf dem Friedhof, so lange, bis der Herr der Finsternis, NuNdUuN, geruht, sich ihm zu zeigen. NuNdUuN, das klingt gesucht und ist doch bloß gefunden; mit dieser phonetisch-orthografischen Komplikation bekennt sich Meißner zum Einfluss von H.P. Lovecraft, bei dem die kosmische Bosheit seiner Wesen ja ebenfalls mit der Unaussprechlichkeit der Namen Hand in Hand geht. Das manichäische Weltbild, das dem Quest zugrundeliegt, wird spezifisch abgewandelt: Nicht etwa repräsentiert der Geist das Gute und die Materie das Schlechte; sondern aus der Neutralität des materiell Vorhandenen erwächst allmählich und parallel zur Menschwerdung die Hölle des Geistigen schlechthin, jenes Reich, das den täuschend idyllischen Namen Wiedenfließ trägt, ein überhistorisches, aber keineswegs zeitloses Imperium. Es gibt Binnenmachtkämpfe. Wie in allen Theologien vom Teufel bleibt es auch hier auf vertrackte Weise unausgemacht, was am Bösen der Welt auf Rechnung Luzifers geht und welcher Anteil den handelnden Menschen zukommt. Wiedenfließ soll zum Beispiel erst dadurch freie Hand erhalten haben, Auschwitz einzufädeln, als einer der letzten Spieler bei relativ hohem Punktestand doch aus dem Rennen gekickt wurde, während Tschernobyl dem Abschuss eines Stümpers in der Startphase korrelierte. . .
Hiob also erhält die Chance auf „Das Spiel”; wenn er von 78 möglichen Punkten die Mehrzahl erhalten haben sollte, darf er an die Stelle NuNdUuN’s treten – was immer das bedeuten wird. Einen naiven Eifer, sich für das Gute einzusetzen, wiegt die Einsicht in die düstere Ambivalenz allen Handelns auf. Gleich als ersten Test, ob Hiob würdig wäre, soll er den Arzt, der bei seiner Geburt geholfen hat, aufsuchen und töten – und tut es, ohne mit der Wimper zu zucken. Als viel schwieriger erweist sich gleich darauf die komplementäre gute Tat, ein verstiegenes Kätzchen vom Baum zu holen; Hiob verursacht eine Massenkarambolage und stürzt mit etlichen Knochenbrüchen in die Tiefe. Das gerettete Kätzchen aber nimmt NuNdUuN nur in Empfang, um ihm das zarte Köpfchen mit dem Stiefelabsatz in die Auslegware von Hiobs schmuddligem Appartement zu malmen, und lächelt dazu.
Ein Krampf der Lässigkeit
Schmerz ist Stil, und Stil ist Schmerz; und was beide vereint und identifiziert, ist die Kategorie der Anspannung. Von dieser trennt das Buch sich nie, so ungleichmäßig es sich sonst auch, nicht nur im typografischen Erscheinungsbild, darbietet. Ja gerade das Ungleichmäßige macht einen erheblichen Teil des Lesevergnügens aus; zuweilen auch der Lesequal, besonders bei den Sexszenen, die, ausschweifend und zugleich gehemmt-abstrakt, die Erotik des Nerds verraten. Manchmal, etwa wenn er eine spießige Kleinfamilie, die Weihnachten in der Skihütte feiert, in ein Handgemenge mit Wolfsdämonen verwickelt, liest sich Meißner wie Stephen King: spannend, breit, voll Freude am Trivialen und ungebremstem Splatter-Spaß. Dann wieder gibt er sich dem coolen jugendlichen Ironie-Slang seines Protagonisten hin, was so klingt: „Kamber trat das Gaspedal voll durch, so dass die Beschleunigungskräfte Hiobs Zahnfleisch entblößten. Die Neons und Verkehrslichter der Umstadt zerdehnten sich zu Hyperraum-FX. Die mitlaufenden Geschwindigkeitsübertretungsblitzlichter verwandelten die Fahrstrecken in einen Korso unvergänglichen Ruhms.” Ein Krampf der Lässigkeit, doch erfindungsreich im Ausdruck und nicht unsympathisch in seinem Streben nach Fasson. Ihm kann sogleich das unverdünnte Pathos auf den Hacken sitzen.
Das Buch besitzt eine emblematische Eingangsszene, die alles, was es will, zu einem peinigenden Ausbund in sich fasst. Eine Figur namens Arvec zieht durch eine verkohlte Trümmerlandschaft einen Käfig hinter sich her, in dem ein riesiger wolfsähnlicher Rüde gefangen sitzt. Arvec lässt sich von seinem widerstrebenden Kumpan Joran dessen Gewehr geben; aber er erschießt den Hund nicht, es kommt weit schlimmer: Er benutzt die Flinte als Hebel, um Käfig samt Hund in eins der vielen Feuer am Wegrand zu bugsieren. „Die Flammen griffen sofort mit vielfingrigen Händen in das ergiebige Hundefell und wühlten sich sengend hindurch. (. . .) Der Hund schnellte seinen gemarterten, unrettbaren Leib jetzt auf und nieder, presste, wo es nur ging, blutendes Fleisch durch den Käfigrost, um den heißen Teufeln zu entgehen. Er bellte oder jaulte nicht, nur hechelnde, pfeifende Atemzüge und ein tiefes grimmiges Rollen, das nicht aus der Kehle, sondern aus der Tiefe der Eingeweide zu kommen schien.” Joran bittet Arvec schluchzend, den Hund doch mit einer Kugel zu erlösen. Stattdessen jedoch tut Arvec das Folgende. „Er legte einen Arm um Jorans Hals und zog Jorans flennend verzerrtes Gesicht ganz nah an seins. ‚Kannst du das riechen, in dem Rauch, mein Junge? Der Gestank des Schmerzes, die ganzen Ausdünstungen der Todespein. Mein Mantel riecht auch danach, hier komm, riech, das hier ist von Weibern, und das hier ist für dich, ja, lass dich gehen, mein Junge, komm nur her, ja, so ist gut.‘”
In der Art, wie sie den Trost mit dem Entsetzlichen, über das er beruhigen soll, vermengt, hat diese Szene etwas tief Verstörendes. Sie macht irre an der Vorstellung, es sei die Aufgabe der Literatur, auf welchen dornenreichen Umwegen auch immer, das Geschäft des Humanen zu befördern. Ja, so ist gut? Nein, es ist hier offenbar, im Herzen der fürsorglichen Geste, die in den Mantel hüllt, etwas Schlimmes zugange. Diese Literatur konstituiert sich, nicht ausschließlich, aber an entscheidender Stelle, dort, wo sie schneidet, durch ihre Lust am Bösen. Sie speziell ist der Liebe bedürftig.
TOBIAS O. MEISSNER: Hiobs Spiel. Zweites Buch: Traumtänzer. Eichborn Berlin, Berlin 2006. 411 Seiten, 24,90 Euro.
Gewalt gehört auch zum Erzählgeschäft: Zwei Samurai-Krieger im Kampf Foto: Corbis
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Zarte Gemüter warnt der Rezensent vor diesem Buch, ihm selbst aber hat es prächtig gefallen. Zu raffiniert erscheint Lorenz Jäger das Blurünstige hier in Szene gesetzt, zu scharf der literarische Sachverstand des Autors Tobias Meißner. Wer einen Gnostiker der Unterschicht im Berlin der 90er zum Helden eines Splatter-Romans macht, gibt der Rezensent zu verstehen, der hat was auf dem Kasten. Nicht weniger als das Verdienst, das Splatter-Genre in der deutschen Literatur heimisch zu machen, spricht Lorenz dem Autor zu. Und "Witz und Geist" solcher Güte, dass selbst der weniger dem Dämonischen zugetane Leser neugierig werden muss.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH