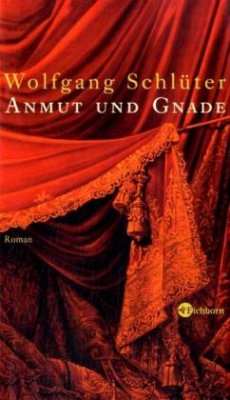Paris, 2003. Unruhen erschüttern die Banlieues. Während die Stadt vom Krieg der Bilderstürmer und Kaputtmacher erschüttert wird, probt ein österreichisches Kammerensemble die Aufführung einer Oper Jean-Philippe Rameaus, des großen Neuerers und ebenso gefeierten wie umstrittenen Erben Lullys. Walter Mardtner ist Pressereferent des Orchesters. Bei einem Antiquariatsbesuch fällt ihm ein Konvolut alter Schriften in die Hände, das von einem anderen Krieg erzählt: dem einstmals ebenso erbitterten wie geistvollen Kampf zwischen den Traditionalisten und Neuerern um die Vorherrschaft an der Pariser Oper. Kombattanten sind ein König, für den die Oper vor allem höchste Kunst der höfischen Repräsentation ist, Rameau und der Kreis der Enzyklopädisten, allen voran der empfindsame und aufrührerische Jean-Jacques Rousseau.

Wolfgang Schlüters Rameau-Roman „Anmut und Gnade”
Zu Beginn ein Flugzeugabsturz, der von einem Augenzeugen als „ein grauenvoller, aber doch eigentlich ein schöner, jedenfalls ein sublimer” Anblick beschrieben wird. Das ist ganz im Sinne dieses auf politisch unkorrekte Wirklichkeitserfassung angelegten, sich am vielleicht nur vermeintlichen Gegensatz von politischer Gewalt und musikalischer Schönheit abarbeitenden Buchs. Dann ein wildes zeitliches Hin- und Hergespringe zwischen der Mitte des 18. Jahrhunderts und dem Jahr 2003 in einem Paris, das von den widersprüchlichsten Gestalten bevölkert wird: Heroen der modernen Alte-Musik-Bewegung, die Enzyklopädisten um d’Alembert und Diderot, jugendliche Aufständische der Post-Postmoderne, ein scheiternder Königsattentäter, der Komponist Jean-Philippe Rameau, sein Rivale Jean-Jacques Rousseau und nicht zuletzt ein mehr als seltsames Schöngeistertrio.
Dass ein deutscher Roman sich mit Frankreich, Rameau und der Alte-Musik-Bewegung beschäftigt, ist ungewöhnlich und originell. Das allein verdient die Aufnahme in die Andere Bibliothek. Schlüter, Jahrgang 1948, hat sich gelegentlich schon mit Musikthemen befasst, Titel wie „John Field” und „Dufays Requiem” bezeugen dies. Nun aber ist der Autor mit seinem 330-Seiten-Roman „Anmut und Gnade” einem der betörendsten Komponisten verfallen: Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Da alles an Rameau außergewöhnlich ist, kann man ihm nur verfallen, bekommt ihn aber schwer in den Griff. Das mag erklären, warum keine Zeile in Schlüters nie um Worte, Bilder und Abstrusitäten verlegenen Buch Rameaus Klänge, Melodien, Rhythmen, Melancholie, Tanz- und Gesangsnummern zu evozieren versteht. Die Musik dient zwar als Vorlage für Räsonnement und Aufbau, aber es wird immer nur ihre Wirkung, nie sie selbst beschrieben.
Was ist an Rameau so besonders? Ein Mann, der mit fünfzig Jahren erstmals Musiktheater schreiben darf und damit bis zu seinem Tod dreißig Jahre später nicht aufhört. Musiktheater: Theaterfeste, in denen Soli, Tänze, Ensembles, Rezitative, Bühneneffekte, Albernheiten, Wunder und Wahnsinniges einander auf dem Fuß folgen. „Gesamtkunstwerk” reicht als Etikett dafür nicht aus. Also heißt es bei Schlüter, „dass keine Vokalmusik vom Gegensatz der Geschlechter so aufgeladen sei, gleichsam so vor Erotik und flirrender amouröser Spannung vibriere wie diejenige Rameaus, mit der verglichen die Opern Wagners geradezu nur wie schwüle Träume eines pubertierenden Viktorianers wirkten.”
Schlüter tut, als ahmte er den Aufbau der opéra-ballet „Les Indes galantes” (1735) nach, seinerzeit wohl Rameaus erfolgreichstes Stück. Entsprechend gliedert sich das Buch in einen Prolog mit Ouvertüre, vier von Divertissements durchsetzten „Entrées” und eine abschließende Chaconne. Doch die formale Übereinstimmung ist bloß behauptet. Denn eine opéra-ballet führt in den einzelnen „Entrées” selbständige Geschichten vor, die die im Prolog bezeichnete Grundthese verifizieren. Genau das tut Schlüter nicht, er verwebt vielmehr seine Geschichten, schneidet sie in Einzelszenen hinter- und gegeneinander, von der einen zur anderen hüpfend. Formal also ist der Bezug zu Rameau nur Makulatur. Und obwohl Schlüter die Zeiten und Ideen entfesselt durcheinander rührt, kommt es allenfalls im Kopf des Lesers zu einem Trubel, geformt aus Anregungen, Vermutungen, Fragen, Zweifeln. Der Roman aber und seine Personen bleiben statuarisch, halten Distanz. Weil der Autor seine Struktur bevorzugt mit Diskursen, Gewäsch, Debatten und Geschwätzigkeiten verputzt.
Zentralgestalt ist Walter Mardtner, 41 Jahre alt, Faktotum bei einem österreichischen (!) Alte-Musik-Ensemble, das die „Indes” in Paris (!) einspielt und für die Bühne einstudiert. Dass Rameau von Ausländern gerettet wurde, hat Tradition: Der Amerikaner William Christie und der Brite John Eliot Gardiner sind die Betreiber der Rameau-Renaissance, und Nikolaus Harnoncourt, der das Vorbild für Schlüters knarzigen Dirigenten Christoph Erlmayer abgibt, hat als erster überhaupt eine Rameau-Oper aufgenommen.
Held Mardtner, wohl Rousseau nachempfunden, ist unsympathisch, humorlos, altväterlich bildungsbeflissen, rechthaberisch, konservativ und mehr am verbohrten Diskurs als an der sinnlichen Erfahrung interessiert. Es gehört Mut dazu, jemanden wie ihn zum Angelpunkt eines Romans zu machen. Wobei sich jede Seite liest, als hätte Mardtner sie geschrieben. Die daraus resultierende rigide Einseitigkeit erklärt wohl das langsam im Leser sich aufbauende Gefühl von Redundanz und Überdruss. Denn Mardtners Denken und Räsonieren versucht alles miteinander abzugleichen. Das schleift Haltungen und Personen so lange ab, bis nur noch Fragezeichen übrig bleiben (was den Rätselcharakter des Buchs ausmacht), gepaart mit einem schweifend ruhelosen Erzählen, einem Insistieren auf moralischen Appellen.
Da ließen sich, so Mardtner, „draußen, auf der Straße, von einer Zeitschriftenillustration, einem Bild nur, Menschen kränken, die, statt sich selbst für Intoleranz und Gewalt zu entschuldigen, Entschuldigung fordern für eine Kränkung, die ihrem selbstgewählten Bilderverbot ohne Not entspringt.” Die Mardtner-Lösung, von Rameau abgeleitet: „...zu lachen – denn wer lacht, stellt sich selbst nicht minder bloß als den ridikülen Eiferer, der mit der Setzung seiner Absoluta dem Denken selber wehrt. Ein Lachender ist nie ohne Schadenfreude, und diese wiederum setzt ihn durch ihr Unrecht ins Recht, denn Kritik ist die Schadenfreude des Denkens, und Denken ohne kritisches Moment ist nicht denkbar.” Auf Dauer lässt solches Hardcore-Räsonieren unbefriedigt. Auch deshalb, weil Schlüter nie zur schärfsten Fassung eines Gedankens vordringt, sondern sich lieber verplappert.
Zu Beginn der Aufnahmen bohrt der Cellist den Stachel seines Instruments in den Boden. Cellostacheln aber gibt es erst seit der Mitte des 19.Jahrhunderts, und kein Barockensemble, das etwas auf sich hält, würde mit solch einem modernen Instrument arbeiten. Der Anachronismus, das störende Detail in der Flut der historischen Informationen ist symptomatisch: Dieser Stachel steckt tief im Fleisch der Erzählung.
REINHARD J.BREMBECK
Wolfgang Schlüter
Anmut und Gnade
Roman. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2007. 359 Seiten, 30 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Gelehrt, gewollt, gekünstelt: Wolfgang Schlüters Opernroman / Von Ernst Osterkamp
Wolfgang Schlüter verrät in "Anmut und Gnade" größte Kenntnis der französischen Opernwelt des 18. Jahrhunderts. Aber auf den Seiten des Romans gelten andere Gesetze als auf den Bühnen der Opernhäuser.
Dieser sonderbare Roman beginnt mit einem Flugzeugabsturz im wolkenlosen Firmament und endet mit dem Anblick der goldenen Himmelspforte. Katastrophaler Absturz und Apotheose: das ist ein Spannungsbogen, wie ihn die große Oper liebt und braucht, um ihre Wirkungen erzielen zu können. Wer als Erzähler seine Effekte in derart großem Stil im Geiste der Überwältigungsästhetik zu inszenieren sucht, gibt sich schon damit als ein Freund der Oper zu erkennen. Wir sind hier aber nicht in der Oper, sondern in einem Roman, und da herrschen andere Gattungsprinzipien.
Wolfgang Schlüter hat seinen Roman "Anmut und Gnade" in einen Prolog, pardon: "Prologue" und in vier Entrées gegliedert. Das ist die Form der Opéra-ballet, der in den dreißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts in Paris sich durchsetzenden Ballettoper, in der das Unterhaltungsbedürfnis der Zeit Entspannung suchte von den Anstrengungen der Tragédie lyrique in der Tradition Lullys. Die Opéra-ballet hatte keine durchgehende Handlung; im Prolog wurde in mythologischem Rahmen ein Thema vorgegeben, das dann in den Entrées in dramaturgisch unkomplizierten Einaktern durchgespielt wurde. Sie handelten an unterschiedlichen Orten und wiesen keine Überschneidungen im Personal auf: eine lockere Form, die reichlich Raum gewährte für die immer neue Entfaltung szenischer Effekte und die Einspielung zahlreicher Tanzeinlagen. Die schönsten Werke des Genres hat Jean-Philippe Rameau geschaffen: "Les Indes galantes" (1735) und "Les Fêtes d'Hébé" (1739).
Diese auf die Zerstreuungsbedürfnisse eines ohnehin schon zerstreuten Publikums dramaturgisch genau abgestimmten Werke waren außerordentlich erfolgreich; "Les Indes galantes" wurde von 1735 bis 1773 nicht weniger als dreihundertzwanzigmal in Paris gegeben. Aber mit dem Sieg der italienischen Oper auch in Frankreich nach Rameaus Tod (1764) und mit dem Untergang seines Publikums in der Französischen Revolution gelangten diese Werke für Jahrhunderte in Vergessenheit. Dem heutigen Opernpublikum sind sie trotz all ihrer musikalischen Herrlichkeiten aufgrund ihres dramaturgisch heiklen Revuecharakters nur schwer vermittelbar.
Schlüters Roman erzählt von den Proben und der Aufnahme von "Les Indes galantes" durch das Alte Musik-Ensemble "Les Encyclopédistes" unter der Leitung seines ebenso gelehrten wie wortmächtigen Dirigenten Christoph Erlmayr, den Schlüter so genau nach dem Leben zeichnet, dass jeder Leser in ihm Nikolaus Harnoncourt erkennen kann, nein: soll. Dann folgt die Premiere des sorgsam einstudierten Werks in der Bastille-Oper. Das Ganze spielt im Juli 2003, als die Unruhen in den Banlieues Paris erschüttern. Am Ende ist die CD im Kasten und die Premiere höchst erfolgreich, wenngleich begleitet von den üblichen Irritationen durch das moderne Regietheater, über die Bühne gegangen. Das ist die gesamte Handlung, und sie wird nicht interessanter dadurch, dass der Autor sie aus der Perspektive des für die Öffentlichkeitsarbeit des Ensembles zuständigen Walter Mardtner erzählt: "Ich hatte in Gießen Betriebswirtschaft studiert, mir autodidaktisch ein bisschen das Partiturlesen beigebracht - und das wars denn schon." Das war's tatsächlich; blasser als dieses kann kein Erzähler-Ich sein.
Dieses Nichts an Handlung, begleitet von einigen belanglosen erotischen Kabbeleien im Ensemble, füllt Schlüter dadurch auf, dass er seinen eminenten kulturhistorischen Bildungswillen voll zur Geltung kommen lässt, indem er seine Leser in einem großen historischen Bilderbogen über die Geschichte der französischen Oper seit den Tagen Lullys, über Rameaus Opernschaffen bis zu dessen Tode und den erbitterten Opernstreit zwischen Lullisten und Ramisten ausführlich in Kenntnis setzt. Und damit das nicht gar zu langweilig gerät, macht sich Schlüter erzählerisch das Strukturprinzip der Opéra-ballet zu eigen, das Erlmayr am Beispiel von "Les Indes galantes" so charakterisiert: "Und die Galanten Indien sind ja eher eine Nummernrevue als eine Oper. Ein tönender Bilderbogen, ein Spectacle, eine Montage von Attraktionen."
Schlüters "Anmut und Gnade" ist denn auch eher eine Nummernrevue und ein literarischer Bilderbogen als ein Roman. Er unterbricht die Handlung in für Abwechslung sorgender Rhythmisierung durch Bilder, Szenen und Salongespräche aus dem Paris Rameaus und durch sonstige Divertissements, und dabei ist viel zu lernen über die politische Bedeutung der Oper im Ancien Régime und über die Motive einer Luxusklasse, die, da sie über andere Fragen von öffentlichem Belang nicht räsonieren durfte oder konnte, eben über Probleme der Opernästhetik stritt: hier die Lullisten, die die edle Einfalt der Tragédie lyrique und damit den Vorrang des Worts gegen ein Übergewicht der Musik verteidigten, dort die Anhänger Rameaus, die die Kunst der Harmonien ihres neuen Orpheus verehrten.
Erzählerisch plausibilisiert Schlüter sein Verfahren durch die gute alte Manuskriptfiktion, die bis heute im historischen Erzählen von erschütternder Beliebtheit ist: Ein Antiquar, den Mardtner im Zug auf der Fahrt nach Paris kennengelernt hat, spielt ihm ein Manuskript-Konvolut aus dem achtzehnten Jahrhundert zu, in dem ein Kompilator Szenen aus dem häuslichen Leben Rameaus, Briefe, Dokumente, Aufzeichnungen von Gesprächen in Salons und Kaffeehäusern und dergleichen zusammengetragen hat. Der Leser hat sich also vorzustellen, dass die historischen Bilder, die den Gang der Erzählung rhythmisieren, in Wahrheit Exzerpte Mardtners aus diesem Konvolut sind, das natürlich am Ende des Romans spurlos verschwindet. Das ist eine erzählerische Konstruktion, die ungefähr so knirscht und scheppert, wie wir uns das von Opernkulissen des achtzehnten Jahrhunderts vorstellen.
Die Manuskriptfiktion führt ein weiteres Übel mit sich: die stimmenimitatorische Vorliebe des Autors für historisierende Sprachformen und für sprachliches Lokalkolorit, die eine höhere geschichtliche Plausibilität dadurch zu erschwingen versucht, dass sie "seyn" schreibt und "ächt" und "kömmt" und "Gemüth". "Das Libretto von Fuzelier allerdings ist und bleibt détestable: ein rationaler Réalisme in ungelenken Versen. Wo bleibt da der Mythos? Und die Musique? Ist im Grunde nur eine Reihe von Miniaturen, ein Triumph der Discontinuité, auf jeden Fall zu complicirt, zu verworren, trop recherchée." Pariser Salongespräche aus dem Jahre 1735? Doch wohl eher kunstgewerblicher Schnickschnack - Louis Quinze-Furnier auf Spanplatten - , der im Übrigen wie die französische Entsprechung zum Come-stai-Italienisch des Toskanadeutschen anmutet. Schlüter bekennt sich zwar heiter zu seinem "wahllosen Eklektizismus", aber wer allzu viele Sprachen imitiert, steht am Ende ohne eigene Sprache da. Man muß allerdings zugestehen, daß Schlüter gelegentlich ein glänzender Stimmenimitator ist; Erlmayrs viele Seiten umfassende Probenvorträge über Rameau zum Beispiel sind nicht nur eminent kenntnisreich, sondern zeichnen sich auch durch hohen Sprachwitz aus.
Das Hauptproblem dieses Buches aber ist, dass sich dem Leser an keiner Stelle erschließt, weshalb es überhaupt ein Roman hat werden müssen. Denn Schlüter zeigt nirgends, dass er eine interessante Handlung erfinden, vielschichtige Charaktere entwerfen oder Dialoge schreiben könnte, die nicht dem Geist des Schulfunks aufs tiefste verpflichtet blieben. Wohl aber stellt er in diesem Buch unter Beweis, dass er unendlich viel über die Kulturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, über Rameau und die Opernästhetik der Epoche weiß. Wir hätten es ihm sehr gedankt, wenn er dies herrliche Wissen umgesetzt hätte in Form einer Biographie des großen Jean-Philippe Rameau und dergestalt seine Leser durch seinen berechtigten Enthusiasmus eingenommen hätte für dessen humane Kunst des nuancierten Ausdrucks. Stattdessen lässt er seine Figuren sprechen wie Schauspieler aus deutschen Vorabendserien, denen man plötzlich eine Perücke übergestülpt hat, um sie erklären zu lassen, weshalb die Verhaftung Diderots im Jahre 1749 gut war für die republikanische Fortschrittskritik: "Weil ohne den langen beschwerlichen Fußmarsch auf staubigen, sonnendurchglühten Chausseen zum Besuch seines gefangenen Freundes in Vincennes unser Freund Rousseau nie unterm Schatten einer Pappel Rast gemacht und die Preisfrage der Dijoner Académie gelesen hätte, die ihm seinen Discours sur les sciences et les arts entlockte, der im Vorjahr im Druck erschienen ist und auf lange Sicht wohl mehr Furore machen wird als unsere Encyclopédie, deren erster Band heuer im Juni herauskommt. Sie seufzen, Madame?" Wie sollte die Marquise d'Épinay denn nicht seufzen, wenn ihr Geliebter, der Baron Melchior Grimm, ihr am Frühstückstisch eine deutsche Seminararbeit vorträgt?
Vielleicht war es der unselige Aktualisierungswille, sein Wunsch, die Opernkriege im prärevolutionären Paris auf irgendeine Weise in Bezug zu setzen zu den aktuellen Unruhen in den Pariser Vorstädten und sonstigen Unbilden unserer Zeit, der Schlüter dazu veranlasst hat, die Lizenzen des Romans zu nutzen. Aber das macht die Sache nicht besser. Denn dies gibt ihm nicht nur die Möglichkeit, seine Meinungen über dies und das, über die deutsche Neigung zum Vergessen historischer Schuld oder das Regietheater an den Leser zu bringen, sondern auch noch "Schläfer" in die Pariser Oper einzuschleusen und sie dort am finsteren Geschäft des Königsmords werkeln zu lassen.
Unter diesen Umständen muss man vom Glück reden, dass Rameau während der Vorbereitungen zur ersten Aufführung von "Les Boreades" starb und deshalb dies wunderbare Werk erst einmal als operngeschichtlicher Schläfer in den Archiven verschwand. Trösten wir uns mit dem großen Künstler Rameau, der es als taktlos empfunden hätte, das Publikum mit seinen Meinungen zu belästigen.
Wolfgang Schlüter: "Anmut und Gnade". Roman. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2007. 358 S., geb., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main