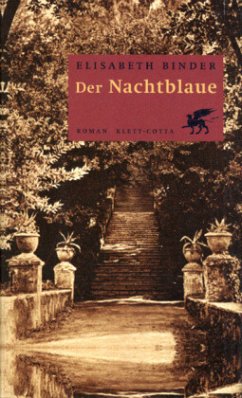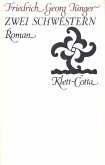Die Ereignisse eines einzigen Tages in Rom, reich wie eine Lebensreise
Die erste Biographie über Jean Améry (1912-1978), mit einer Fülle bisher unbekannter Zeugnisse und Dokumente.
Rom, Anfang Dezember: Sie sieht ihn, den Unbekannten, abends, im Dämmer der Kirche Aracoeli. Und verliert ihn später, im Gedränge der Stadt, aus den Augen. Doch wird sie fortan nach ihm suchen, denn er hat auf fast magische Weise ihr Interesse erregt.
Einen Tag lang streift C., die Heldin dieses Romans, durch die Gassen und Plätze der Ewigen Stadt: Belustigt und berauscht, lebenssüchtig und nachdenklich. Menschen, Farben und Geräusche treiben vorbei; Alltagsdramen, Anblicke des Elends und Glücksmomente sammeln sich zu einem Kaleidoskop. So lernt C. einen blinden Obdachlosen kennen, den sie, nach einigen skurrilen Szenen mit den römischen Carabinieri, zu einem alten Kloster begleitet - eine Tour, die mit einer erotischen Eskapade endet. Ein einziger Tag, reich wie eine Lebensreise. C., die eigentlich einen Roman schreiben will, erlebt hier den Roman ihres Lebens. Eine Odyssee, auf der Tod und Sexualität, Kunst und Gewalt, Sehnsucht und Einsamkeit dicht beieinanderliegen. Zum Schluß wird sie ihn noch einmal sehen, eine entscheidende Sekunde lang.
Die erste Biographie über Jean Améry (1912-1978), mit einer Fülle bisher unbekannter Zeugnisse und Dokumente.
Rom, Anfang Dezember: Sie sieht ihn, den Unbekannten, abends, im Dämmer der Kirche Aracoeli. Und verliert ihn später, im Gedränge der Stadt, aus den Augen. Doch wird sie fortan nach ihm suchen, denn er hat auf fast magische Weise ihr Interesse erregt.
Einen Tag lang streift C., die Heldin dieses Romans, durch die Gassen und Plätze der Ewigen Stadt: Belustigt und berauscht, lebenssüchtig und nachdenklich. Menschen, Farben und Geräusche treiben vorbei; Alltagsdramen, Anblicke des Elends und Glücksmomente sammeln sich zu einem Kaleidoskop. So lernt C. einen blinden Obdachlosen kennen, den sie, nach einigen skurrilen Szenen mit den römischen Carabinieri, zu einem alten Kloster begleitet - eine Tour, die mit einer erotischen Eskapade endet. Ein einziger Tag, reich wie eine Lebensreise. C., die eigentlich einen Roman schreiben will, erlebt hier den Roman ihres Lebens. Eine Odyssee, auf der Tod und Sexualität, Kunst und Gewalt, Sehnsucht und Einsamkeit dicht beieinanderliegen. Zum Schluß wird sie ihn noch einmal sehen, eine entscheidende Sekunde lang.

Außer Puste: Elisabeth Binders Roman "Der Nachtblaue"
In der Nacht zum 7. April des römischen Jubeljahres 1300 geriet ein aus Florenz exilierter Dichter und gescheiterter Politiker vom rechten Weg ab und verirrte sich in einem Wald. Am Fuße eines Berghangs von Bestien bedrängt, bietet ihm ein Wanderer Geleit. In der fremden Gestalt, die ihn bei der Hand nimmt, erkennt er sein altrömisches Vorbild, den Meister Vergil. So beginnt die Reise. Für 24 Stunden führt sie in den Schlund der Hölle hinab und wieder zurück zum Lichte, am nächsten Tag den Läuterungsberg hinauf und zu himmlischen Höhen empor. An der Pforte des Paradieses wird der heidnische Wegweiser von der seligen Jugendliebe des lebenden Poeten abgelöst, dem die Gnade widerfährt, zum Augenzeugen einer höheren, ewigen Gegenwart zu werden.
Vergleichbaren Erfahrungen kann sich der irdische Tourist auf einer Reise in die Ewige Stadt annähern. Rund sieben Jahrhunderte nach Dante, an einem Dezembertag gegen Ende der neunziger Jahre - ein Straßenplakat wirbt für eine Ausstellung über "100 Jahre Cinema" -, besteigt die Heldin von Elisabeth Binders Roman "Der Nachtblaue" den Hügel des Kapitols. Auf dessen Höhe, eingeklemmt zwischen Michelangelos erhabener Platzanlage und dem vaterländischen Altar für den König Vittorio Emanuele II., liegt die frühchristliche Kirche Santa Maria in Aracoeli. Die wenigsten Rom-Besucher wagen es, die 124 steilen Stufen der in Rom "Himmelsstiege" genannten Freitreppe zu erklimmen. Der Name "Aracoeli" bedeutet "Himmelsaltar" und erinnert an ein Wunder, das sich in den von Vergil besungenen Tagen des Kaisers Augustus hier zugetragen haben soll: Vor dessen Augen und im Beisein der Tiburtinischen Sibylle habe sich der Himmel geöffnet, und eine Jungfrau sei erschienen, die ein Kind über einen Altar hielt. "Dies ist der Altar des Himmels", sprach die Sibylle, und Augustus fiel davor nieder.
Über die Person der Wiedergängerin, die am Ende der Treppe das düstere Innere der von einem Säulenwald gestützten Kirche betritt, erfahren wir wenig mehr als das Namenkürzel C., das Alter von vierzig Jahren, den ledigen Familienstand und den Schriftstellerberuf. Auch sie ist an diesem Tag - wie könnte es in Rom anders sein? - gleich mehrfach "vom geraden Weg abgebracht" worden. Denn eigentlich hatte C., wie gewohnt, die Gefilde des Botanischen Gartens aufsuchen wollen, um dort an ihrem Erstlingsroman über ihre Schweizer Kindheit zu schreiben. Auch sie war an diesem Tag mancher Kreatur und bizarren Gestalten begegnet, streckenweise von einem Virgilio genannten Signor Vigile - so heißen in Italien die Polizisten - durch die Stadt geleitet worden. Unterdessen war ihr eine nachtblau gekleidete Gestalt gefolgt, die sie am Vorabend, bei ihrem ersten Besuch in Aracoeli, bemerkt und die sie seither nicht mehr losgelassen hatte. Auf ihrem Rückweg, die steile Treppe hinunter, taucht der Nachtblaue mit der blitzschnellen Gewalt einer Epiphanie ein letztes Mal auf. Doch da ist es um C. schon geschehen. Leblos liegt sie vor der Himmelsstiege. An diesem Tag wurde nicht mehr geschrieben.
Der Leser muß die literarischen Unterlagen, auf denen der Debütroman der Zürcher Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elisabeth Binder über den neuerlichen Fall eines Todes unter südlichem Himmel geschrieben ist, nicht kennen. Er muß auch Rom nicht unbedingt kennen, doch wird er es gerne wiedererkennen, denn die Autorin führt ihn mit sicherer Hand durch die Stadt, ohne ihm mit dem Geschnatter von Baedekern und Ciceronen zuzusetzen. Dabei hat Elisabeth Binder nicht nur eine komplette literarische Rom-Bibliothek im Kopf, sondern zeigt auch ein für die römische Straßenwelt wunderbar geschärftes Auge, das durch die Schule des Films gegangen ist. Von Alfred Hitchcocks "The 39 Steps" und des Altmeisters "Die Vögel" abgesehen, die Binder auf Augurenflüge vom Kapitol zum vatikanischen Petrusgrab schickt, steht an erster Stelle ein Film über Venedig, wo jeder Tod in Rom schon seinen Vorläufer hatte. Nicolas Roegs Meisterwerk aus dem Jahr 1973 mit dem schmucken deutschen Titel "Wenn die Gondeln Trauer tragen" hatte im Original eine Anweisung an das Sehen gegeben: "Don't Look Now" - "Schau jetzt nicht hin" - hieß er, und gemeint war: Den erfüllten Augenblick, nach dem du suchst, die emphatische Gegenwart, nach der du verlangst, die erblickst du früh genug. Dann bist du aber auch gleich tot. Oder mit Elisabeth Binders Worten: "Plötzlich war er dagewesen", und du bist "so getroffen" wie "vorhin in Aracoeli droben", und zwar "so heftig, in einem Augenblick".
Todbringend war im Film die Farbe Rot, mit der sich ein kleines, durch die venezianischen Straßen streifendes Kapuzenmännlein bekleidete, dessen abscheuliches Gesicht nur ein einziges Mal sichtbar wurde, in dem Augenblick, als für den von der Erscheinung magisch angezogenen Helden prompt die Stunde schlug. In Elisabeth Binders Roman tritt an die Stelle des roten Gnoms ein Nachtblauer, der von Anfang an in wechselnden Phantomen und Impressionen gegenwärtig ist. Dabei sieht er einem anderen flüchtigen Subjekt, dem C. ihrerseits auf den Fersen ist, zum Verwechseln ähnlich. Heftig reiben sich die Blicke und die Farben aneinander, und neben blauen Kleidungsstücken, dazu einem roten Schal als Unterscheidungsmerkmal des begehrten Jeansträgers vom Nachtblauen, fahren jede Menge Blaulichter von Ambulanzen, Polizeifahrzeugen und Feuerwehren blinkend durch die Straßen. So entsteht eine Prosa, die dem Azur und Purpur des Himmels über Rom entgeht, nicht aber der melancholischen Nordschwärze, die Elisabeth Binder farbeimerweise unter die mediterrane Bläue mischt.
Doch nicht nur die Seele, auch die Sprache lastet schwer auf der klugen Komposition. Während die Autorin mit tapferer Ironie und mit saloppen Sprüchen die wehmütigen Scharlachtöne meidet, schwingen sich Grammatik und Syntax zu wahrhaft aulischen und kurialen Höhen empor. Manche Sätze klingen wie Übersetzungen aus dem Homerischen, andere könnten aus dem Hölderlinischen stammen: "Schrumpfte der Raum ganz rasch von den Rändern, wie wenn ein Fernseher ausgemacht wurde, rasend auf immer kleineres Format?" Oder auch: "Verglomm spurlos das letzte Fünkchen im Ewigfinstern, dem traumlosen Magma der Bewußtlosigkeit?" Wiederum hat ein vermeintlicher Genius loci zugeschlagen, nur hat er mit der Gattung auch die Muttersprache gewechselt. Heroisch ist der Versuch, dem Altlatein der römischen Bogen, Rundungen und Kurven einen äquivalenten sprachlichen Ausdruck abzuringen, der die Physiognomie der Formenwelt der Ewigen Stadt ins Hier und Jetzt allgegenwärtiger Partizipien und Gerundiva überträgt, und heroisch muß er scheitern. So lassen sich lateinische Sermone schmieden und italienische Perioden bauen, und danach ließe sich wohl auch singen, doch deutschsprachige Prosa wird darunter schwerer als Blei.
Einmal auch sollte C. "es entschieden wie nie zuvor" erfühlt haben, "was das wäre: ein Schreiben - auf Leben und Tod". Mit Wolfgang Koeppens Rat an den Artisten aus dem Vorläuferroman "Der Tod in Rom" von 1954 möchte man Elisabeth Binder und ihrer todessehnsüchtigen Protagonistin nicht erst am Ende zurufen: "Um Gottes willen - kein Leben für die Kunst! Gehen Sie auf die Straße. Lauschen Sie dem Tag! Aber bleiben Sie einsam!" Dann kriegt man in Rom vielleicht auch die Kurve.
VOLKER BREIDECKER
Elisabeth Binder: "Der Nachtblaue". Roman. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2000. 176 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Volker Breidecker ist über dieses Buch geteilter Meinung. Einerseits ist er beeindruckt von dem Wissenshintergrund der Autorin, die - wie er feststellt - nicht nur in der Rom-Literatur äußerst bewandert ist, sondern auch offensichtlich zahlreiche Filme gesehen hat: Von Hitchcocks "Die 39 Stufen " über "Die Vögel" bis hin zu Nicolas Roegs "Wenn die Gondeln Trauer tragen", mit welchem das Buch einige Parallelen aufweise. Ihm gefällt auch, wie die Autorin den Leser durch die Stadt führt, da sie viel Ortskenntnis beweise, ohne dabei jedoch wie ein Reiseführer vorzugehen. Probleme hat Breidecker vor allem mit der Sprache in diesem Roman. Wenn sich "Grammatik und Syntax zu wahrhaft aulischen und kurialen Höhen" emporschwingen, fühlt er sich zwar geradezu an Homer oder Hölderlin erinnert. Doch sieht er gerade in der heroisch anmutenden Ausdrucksweise, die sich an der "Physiognomie der Formenwelt" der Stadt orientiere, die Schwächen des Buchs: die "deutschsprachige Prosa wird darunter schwerer als Blei", meint er. Ihm diese Sprache nicht lebendig genug: "Gehen Sie auf die Straße. Lauschen Sie dem Tag!", rät er der Autorin und ihrer Protagonistin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein nachtblauer Seitenwechsel Vor wenigen Jahren hat Elisabeth Binder (48) Literatur noch kritisch begutachtet. Nun tritt sie erstmals mit einem eigenen belletristischen Text an die Öffentlichkeit. Bräunlich rotes Riegelwerk ziert die ehemalige Trotte. Tritt man durch die Haustür, so steht man unvermittelt in einem hohen Raum, der für Küche, Esstisch und Schreibpult gleichermassen grosszügig Platz bietet. Nabokov-Bände auf dem Schreibtisch verweisen auf literarische Neigungen. Stiche von Piranesi zeugen von einem Faible für "la bella italia". In diesen vier Wänden wohnt Elisabeth Binder, hier hat sie ihren ersten Roman, "Der Nachtblatie", zu Papier gebracht. "Eigentlich habe ich schon früh zu schreiben begonnen", erinnert sich die Autorin. Bereits in der Gymi-Zeit und später während des Studiums der Germanistik und Kunstgeschichte habe sie regelmässig Geschichten und Gedichte verfasst. Mit dem Tod ihres Ehemanns Wolfgang Binder, Professor für deutsche Literatur an der Uni Zürich, erfuhr ihre Beschäftigung mit dem Beschriebenen Wort 1986 aber einen abrupten Unterbruch. Erst zu Beginn der Neunzigerjahre kam Binder als Buchrezensentin der NZZ wieder intensiv in Kontakt mit literarischen Texten. Vor nunmehr sechs Jahren hat sie sich für den Beruf der freien Schriftstellerin entschieden; nicht etwa, weil sie unbedingt auch zu den Produzenten belletristischer Texte habe gehören wollen: "Ich muss niemandem etwas beweisen." Die Kritikertätigkeit habe ihre schriftstellerischen Neigungen nicht erzeugt, sondern nur neu geweckt. Zum Schreiben braucht Binder die Einsamkeit ihres ländlichen Wohnorts Unterstammheim. Nur ungern verzichtet sie auf den täglichen Waldspaziergang. Besonders fasziniert zeigt sie sich von der Ambivalenz der Natur: "Ein simples Blatt zum Beispiel ist einerseits etwas sehr Zufälliges, anderseits aber auch klar gestaltet. " Doch abgesehen von solch fibonaccischen Betrachtungen: "Bei diesen Spaziergängen kommen mir immer die kühnsten Einfalle. " Einen Ausgleich zum monastischen, ganz der Dichtung geweihten Autorendasein verdankt Binder ihrer Italienbegeisterung. Besonders der Trubel der Ewigen Stadt hat es ihr angetan. Hier tankt sie - ganz nach klassisch-bewährtem Vorbild von Goethe, Herder, Seume oder Moritz - Sonne und Leben. Rom bildet denn auch die Kulisse für den "Nachtblauen". Der Roman handelt vom urbanen Streifzug der Protagonistin C., von ihren diversen Begegnungen während eines einzigen Tages. Immer wieder kreuzt auch eine geheimnisvoll nachtschattenhafte Gestalt C.s Wege: der Nachtblaue, eine Figur, in der die beiden Motivstränge Erotik und Tod verfliessen. "Das Buch ist gewissermassen die Apotheose eines Tages", erklärt die Autorin. Ein Sinnestaumel durch die Gassen und über die Plätze Roms. Vier Jahre hat Binder an ihrem Text gefeilt. Noch bevor der Roman vollendet war, kam die Einigung mit dem Verlag zu Stande. "Als Brigitte Kronauer in Hamburg mit dem Hubert-Fichte-Preis ausgezeichnet wurde, habe ich die Laudatio gehalten", sagt Binder. Bei dieser Gelegenheit sei sie mit dem Lektor ins Gespräch gekommen. "Am Schluss habe ich unter Hochdruck geschrieben. Das war ganz gut so. Sonst wäre der Text wohl ebenso Fragment geblieben wie mein erster Roman." Wie geht eine ehemalige Rezensentin mit Kritik um? Immerhin eine delikate Situation, plötzlich auf die andere Seite zu wechseln und womöglich zum Abschuss freigegeben zu werden. "Natürlich würde es mich treffen, wenn einer mein Buch zerrisse und ich den Eindruck hätte, er habe es nicht begriffen", bekennt die Schriftstellerin. Doch sie hoffe, diesbezüglich nicht allzu anfällig zu sein, weder für negative noch für positive Kritik." Urs Schwarz (Tages-Anzeiger, 07.02.2000)