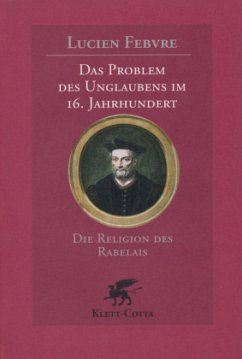Wer war Rabelais, dieser sinnenfrohe Dichter derber Parodien und beißender Satiren, wirklich? Nur ein Spötter in der Tradition eines harmlosen »lukianischen« Gelächters? Oder ein tiefgründiger Philosoph, der mit seiner Kritik und seinem Unglauben seiner Zeit weit vorauseilte? Und inwieweit spiegelt dieser hochgebildete Mönch, Arzt und Schriftsteller seine eigene Epoche?
Auf diese und manch weitere Fragen gibt Lucien Febvre Antworten, und ihm gelingt es, mit seiner »Mentalitäten- Geschichte« die Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts zu revolutionieren.
Im Lauf der Darstellung begegnet der Leser einer Vielzahl von Persönlichkeiten, u.a. Luther, Erasmus von Rotterdam, die der Autor durch seine schriftstellerische Kunst zum Leben zu erwecken versteht. Eindringlich, ironisch und mit der ganzen Farbigkeit, die die Renaissance umgibt, zeichnet er hinter diesen Porträts das geistig-moralische Profil einer ganzen Epoche.
Auf diese und manch weitere Fragen gibt Lucien Febvre Antworten, und ihm gelingt es, mit seiner »Mentalitäten- Geschichte« die Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts zu revolutionieren.
Im Lauf der Darstellung begegnet der Leser einer Vielzahl von Persönlichkeiten, u.a. Luther, Erasmus von Rotterdam, die der Autor durch seine schriftstellerische Kunst zum Leben zu erwecken versteht. Eindringlich, ironisch und mit der ganzen Farbigkeit, die die Renaissance umgibt, zeichnet er hinter diesen Porträts das geistig-moralische Profil einer ganzen Epoche.

Lucien Febvres berühmtes Buch über den Glauben und sein Gegenteil im 16. Jahrhundert hat es endlich ins Deutsche geschafft
Lucien Febvres Buch „Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais” ist 1942 in Paris erschienen. Der Autor, damals 64 Jahre alt, war Schüler von Lucien Lévy-Bruhl und hatte zusammen mit Marc Bloch 1929 die heute legendäre Zeitschrift Annales begründet. 66 Jahre nach Febvres Tod erscheint nun eine deutsche Übersetzung seines Rabelais-Buches. Ist dieses Werk nicht durch die Forschung überholt, zumal der Autor selbst betont, es sei „seiner Zeit verhaftet”? Jede Epoche zimmere sich „ihr eigenes Bild von der historischen Vergangenheit”, gerade die Historiker sollten ihre „Zeitgebundenheit” herausstellen.
Die Zeitgebundenheit auch der vorliegenden Studie bemerkt der Leser schon auf den ersten Seiten, denn sie ist gegen die Ansichten des Rabelais- Forschers Abel Lefranc (geb. 1863) geschrieben, speziell gegen die Einleitungen zu Band I (1912) und Band III (1922) seiner Rabelais-Ausgabe, mit der sich Febvre seit 1923 beschäftigt hatte. Was geht uns heute der alte Streit über die „richtige” Interpretation eines Werkes an, das in der Mitte des 16. Jahrhunderts publiziert worden ist? Kann man nicht auch ohne Kenntnis gelehrter Streitigkeiten Rabelais‘ „Gargantua und Pantagruel” lesen? Sicher, das kann man, aber wenn man das Buch ohne Kenntnis der historischen Situation des 16. Jahrhunderts liest, sollte man sich hüten, sich zu viel dabei zu denken, denn Febvres These lautet, „dass es für das Gefühlsleben, die Denkgewohnheiten und die Redeweise der Menschen des 16. Jahrhunderts und die unserer Zeit wirklich keinen gemeinsamen Nenner gibt.”
Zwischen unserem Jahrhundert und dem Rabelais’ bestehe „kein gradueller, sondern ein Wesensunterschied”. Febvre versucht, nicht in erster Linie Rabelais zu erklären, auch wenn dieser der Held des Buches ist, sondern er bemüht sich, den Unterschied zwischen den Jahrhunderten verstehbar zu machen, um so dieser fernen Zeit gerecht zu werden.
Können wir aber Febvres Buch noch gerecht werden, wenn wir uns seine These zu eigen machen, die Interessen eines Historikers wechselten von Generation zu Generation? Warum muss nach zwei Generationen das Buch eines Historikers wieder gelesen werden, der meint, sein Blick auf Aspekte der Vergangenheit werde „morgen schon wieder ins Dunkel zurücksinken”? Da der Autor nicht den Anspruch erhebt, alle Details der Rabelais-Forschung geklärt zu haben, besteht der Wert des Buches darin, Fragen zum 16. Jahrhundert zu stellen, die in dieser Schärfe vor Febvre keiner gestellt hat und die immer wieder neu gefragt werden müssen, auch wenn die Antworten vielleicht heute anders lauten als 1942.
Der Obertitel des Buches thematisiert Febvres zentrale Frage: Was heißt im 16. Jahrhundert „Unglaube”? Um diese Frage beantworten zu können, genüge es nicht nur, so Febvre, allein die Schriften des großen Spötters Rabelais zu lesen, weil unsere modernen Verstehensweisen und Denkkategorien uns in Rabelais’ Beurteilung leicht fehlleiten können. Darum lässt Febvre im ersten Teil seines Buches – unter der Überschrift „War Rabelais Atheist?” – nicht ihn selbst, sondern seine Zeitgenossen als „Zeugen” für seine Denkart zu Wort kommen.
Neben den Seiten über den absonderlichen Phantasten Guillaume Postel (in dessen Bett der Philologe Joseph Justus Scaliger sein gutes Hebräisch lernte, wie wir von Jacob Bernays wissen), ist sicher einer der Höhepunkte die Zeugenvernehmung des „großen Hassers”: des Dichters Julius Caesar Scaliger, Vater des Joseph Justus. Der Dichter habe langweilige Gedichte geschrieben, sei ein eitler und kreisender Pfau, ein Denunziant und schamloser Querulant gewesen. Febvre entlarvt seine Ausfälle gegen Rabelais als nichtige Verleumdungen. Sie seien typisch für eine Zeit, in der jeder auf jeden eifersüchtig war, jeder beschimpft, als Atheist verschrien und in die Hölle gewünscht wurde.
Scaligers Anschuldigungen sind also ebenso wenig ernst und wörtlich zu nehmen wie die vieler anderer Zeugen. Am Ende entpuppt sich der so genannte Atheismus Rabelais’ als bloße denunziatorische Rhetorik. Obwohl Febvres Zeugenvernehmung von stupender Gelehrsamkeit ist, liest man sie mit Vergnügen, denn sie ist spannend und gut geschrieben.
Im zweiten Teil bespricht Febvre „Rabelais’ Christentum” und die „Grenzen des Unglaubens im 16. Jahrhundert”. Das Christentum habe in diesem Jahrhundert das gesamte moralische, emotionale, ästhetische, politische und soziale Leben bestimmt. Die Denker waren vorwiegend Aristoteliker, und zu dieser Mischung aus Christentum und aristotelischer Philosophie konnte es noch keine Alternative geben. Gerade im Kontrast zum 17. besaß das 16. Jahrhundert noch nicht einmal eine philosophische Terminologie, mit der eine Alternative zum alles durchdringenden aristotelischen Christentum hätte formuliert werden können. „Von Rationalismus und Freidenkertum mit Blick auf eine Epoche zu sprechen, in der die intelligentesten ... Männer weder in der Philosophie noch in der Wissenschaft eine wirkliche Stütze gegen eine in alle Bereiche hineinwirkende Religion fanden, ist pure Phantasterei.”
Lucien Febvre war der Erste, der den Atheismus der Renaissance als modernen Mythos entlarvt hat. Da man neuerdings jedoch wieder vom Licht der Aufklärung und dem Atheismus im Mittelalter und der frühen Neuzeit spricht, ist Febvres Buch nach 60 Jahren hochaktuell. Denn die Frage bleibt: Was heißt Unglaube in einer christlichen Epoche ohne geistige Alternative? Den Übersetzerinnen Gerda Kurz und Siglinde Summerer ist es zu danken, dass sich das Buch sehr gut liest; auch die Anmerkungen von Febvre haben sie vorsichtig und klug ergänzt. Das Nachwort von Kurt Flasch versucht, eine Brücke zwischen 1942 und 2002 zu schlagen, indem es die Entstehungsgeschichte des Buches erzählt, neuere Forschungsliteratur zu Rabelais kurz bespricht und auch auf neueste Arbeiten zum Problem des Atheismus in der Frühneuzeit verweist. Das Werk von Febvre zählt zu den Standardwerken der Renaissance-Forschung. Wer es noch nicht auf Französisch kennt, muss es nun lesen.
FRIEDRICH
NIEWÖHNER
LUCIEN FEBVRE: Das Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert. Die Religion des Rabelais. Mit einem Nachwort von Kurt Flasch. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2002. 541 Seiten, 37,50 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Ein Klassiker und trotzdem zu früh: Lucien Febvres "Rabelais"
Kaum kommt der junge Riese in die Stadt, drängen sich so viele Gaffer um ihn, daß er auf einen der Türme von Notre-Dame fliehen muß. Mißtrauisch späht er auf die glotzende Menge hinunter. Oder wollen die Leute einfach nur einen Willkommenstrunk spendiert haben? Den sollen sie haben, und zwar par rys, mit Vergnügen. "Damit knöpfte er grinsend seinen schönen Hosenlatz auf, zog seine Mentul an die Luft und bepißte sie so messerscharf, daß ihrer zweihundertsechzigtausendvierhundertachtzehn ersoffen, Frauen und Kinder nicht eingerechnet. Nur einige besonders Schnelle entkamen der Piß-Sintflut. Und als sie nun schwitzend, schnaufend, prustend und außer Puste auf der Höhe der Universität angelangt waren, fingen sie an zu fluchen und zu schimpfen, die einen wütend, die anderen par rys, lachend: ,Verflucht! Verdammt! Bei der heiligen Jungfrau! Der Ries' hat uns par rys getauft!'" Seither, belehrt der Erzähler seine wissensdurstigen Leser, heiße die Stadt Paris - nicht mehr Leucetia, wie die Griechen sie genannt hätten, "das bedeutet Weißenstadt, nach den weißen Beinen der Frauen des Ortes".
Nicht mit klassischer Zucht beginnt Frankreichs Beitrag zur neuzeitlichen Weltliteratur, sondern mit einer orgiastischen Parodie darauf. Und doch: Schon wenig später studiert der Riese begeistert die antiken Autoren, und am Ende setzt er den Traum eines jeden Intellektuellen in die Tat um: Er gründet ein Kloster, hundertmal prächtiger als Chambord, ohne Kirche, ohne Mönche und ohne Regel, ein Refugium für edle Frauen und Männer, die in vollkommener Selbstbestimmung tun und lassen möchten, was ihnen gefällt. Wahre Humanisten nämlich kultivieren alle Formen schöner Sinnlichkeit: von schönen Hosenlätzen bis zu schönen Wissenschaften, von schönen Spektakeln bis zu schöner Freiheit.
Schade nur, daß deutschen Lesern die Bekanntschaft mit Gargantua und seinem Sohn Pantagruel so schwer fällt. Denn das genialisch wuchernde Französisch des François Rabelais macht selbst Kennern Mühe, und die deutschen Übersetzungen, die früher einmal gut waren, wirken heute eher altväterlich. Ein Robert Gernhardt müßte dem unbändigen Wortwitz dieses "Ulysses" von 1532 bis 1552 neue Gegenwart verleihen. Bis dahin aber kommt die deutsche Fassung von Lucien Febvres berühmter Rabelais-Monographie zu früh. Wie soll man den Lesehunger stillen, den dieses hinreißende Stück Gelehrsamkeit auf das Original weckt? Denn das tut "Das Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert" noch immer - obwohl dieses Buch sechzig Jahre alt ist und seine Frage niemanden mehr sonderlich erregen dürfte: Hat Rabelais noch an den Gott der Kirche geglaubt, oder war er ein früher Aufklärer oder gar Atheist?
1925, als Febvre seine Recherchen begann (Kurt Flaschs gründliches Nachwort berichtet darüber), neigten liberale Gelehrte dieser letzten Meinung zu. Sie verehrten den abtrünnigen Franziskaner, Arzt und Humanisten, der mit Vorliebe über Mönche spottet und sich nicht einmal scheut, das "Mich dürstet" des Gekreuzigten von einem Betrunkenen lallen zu lassen, als Geistesverwandten. Um so mehr bemühten sich Konservative, den Nationaldichter als guten Katholiken zu retten. Febvre durchbrach diese Alternative, indem er die ideologische Frage in eine wissenschaftliche umformte: Konnte Rabelais überhaupt Atheist sein?
Febvres Antwort lautete: Nein! Denn den Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts, so zeigte er, fehlten schlechthin alle Voraussetzungen dafür, sich eine Sphäre außerhalb des Religiösen auch nur vorzustellen. Zunächst betrachtete er die zeitgenössischen "Belege" für Rabelais' Atheismus, meist Stimmen aus Briefen und Werken von dessen Dichterkollegen. Er verglich deren Anlässe und Argumentation, rekonstruierte die hektisch-unsteten Karrieren und die sozialen Milieus der Sprecher, um solche Vorwürfe als topische Diskursformeln einer frühen respublica litteraria zu entlarven: als konventionelle Verdächtigungen innerhalb einer chronisch zerstrittenen Gruppe eitler, leicht erregbarer, mißtrauisch-neidischer Literaten. Dann musterte er die inkriminierten Blasphemien selbst. Wenig blieb von Rabelais' vermeintlicher Radikalität. Was theologisch gewagt schien, ließ sich bei Origines, bei Thomas von Aquin und später einem Bossuet ganz ähnlich finden. Seine Spöttereien über die Kirche erwiesen sich nicht selten als (wörtliche oder gemilderte) Anleihen aus den Schriften des Erasmus von Rotterdam, die er ebenso beifällig gelesen hatte wie die "Dunkelmännerbriefe", Luthers Papstpolemiken und Melanchthons pädagogische Schriften.
Die berühmteste Partie des Buches jedoch wurde das furiose Schlußkapitel: eine Typologie der Bewußtseinslage der Menschen des sechzehnten Jahrhunderts. Systematisch sichtete Febvre die alltäglichen Formen ihres Lebens und Arbeitens, ihr Verhältnis zu König und Kirche, die Konventionen und Kategorien ihres Wahrnehmens und Denkens, ihre gelehrten Ideen und Verfahren, ihre wissenschaftliche Sprache und Methodik, ihre Ansichten über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit. Stets bestätigte sich, wie sehr die Menschen dieser Epoche "in einer fließenden Welt ohne Abgrenzungen" lebten, ohne Entweder-Oder und ohne strenge Logik, wie fern selbst den damaligen "Naturwissenschaften" die Ideen mathematischer Präzision, exakter Messung und konsequenter Systematik lagen. Selbst wenn Rabelais Atheist hätte sein wollen, so wäre es ihm doch nicht gelungen. Denn seine Zeit kannte keine sprachlichen und gedanklichen Formen, die es erlaubt hätten, eine solche Haltung zu begründen.
Im Rückblick liest sich dies wie ein Themenkatalog der späteren Mentalitätsgeschichtsforschung. Immer wieder drängen sich Namen auf. Wenn Febvre die Autorität der Kirchenglocken als Symbol für das irritierend vage Zeitgefühl der Vormoderne beschreibt oder wenn er auf deren Bevorzugung des Geruchs- und Geschmackssinns vor der visuellen Wahrnehmung hinweist: Alain Corbin. Wenn er die systematische Untersuchung von Testamenten als Quellen frühneuzeitlicher Religiosität empfiehlt: Michel Vovelle. Wenn er die Epoche als "Zeitalter der Angst" charakterisiert: Jean Delumeau. Wenn er über die Offenheit frühneuzeitlicher Körper-Vorstellungen spricht: Natalie Zemon Davis und die ganze neuere "Körper"-Forschung.
Und dennoch: Obwohl so viele bedeutende Gelehrte die Thesen dieses Buches weitergedacht haben, hat es nichts von seiner inspirierenden Vitalität verloren. Es ist nicht so sehr sein Stoff, der den Leser packt. Es ist seine gedankliche Souveränität. Es ist die berückende Nonchalance, mit der Febvre vorführt, was es heißt, klug zu lesen. Es ist sein Gespür für die notwendige Rhythmik einer gelehrten Darstellung. Es ist seine Kraft, aus einzelnen Beispielen (etwa dem Bedeutungskosmos des Wortes "sterben") ganze Sinn-Panoramen zu entfalten. Gerade dieser Gelehrte, der über die gesamte Literatur der Epoche zu gebieten scheint, ist selbst das beste Beispiel für den Rat, den er einst einem Doktoranden gab, der darüber klagte, noch nicht alle Bücher zu seinem Thema zu kennen: "Sie werden nie alles gelesen haben, es wird immer Quellen geben, die Ihnen entgehen. Da kann man nichts machen. Was zählt, ist jene zündende Begeisterung à la Michelet, die den Historiker entflammen soll." Und Georges Duby, der dieses Wort überliefert, fügt hinzu: "Das war befreiend."
Es ist befreiend. Denn die Zeiten haben sich geändert seit Gargantuas Besuch in Paris - als man wenigstens noch auf der Höhe der Universität vor den katastrophischen Ergüssen naiver Provinzler sicher war. Heute hingegen, da eine gargantueske Reformflut die Hochschulen mit Direktiven überschwemmt, die auch von den Geisteswissenschaften meßbare Daten, Quanten und Quoten fordern - heute ist ein Buch wie Febvres "Rabelais" ein doppelt tröstlicher Beweis dafür, daß das, was einer wissenschaftlichen Leistung Wirkung und Dauer garantiert, gerade das Unvergleichliche an ihr ist.
GERRIT WALTHER
Lucien Febvre: "Das Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert". Die Religion des Rabelais. Mit einem Nachwort von Kurt Flasch. Aus dem Französischen von Gerda Kurz und Siglinde Summerer. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2002. 542 S., geb., 37,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Nicht weniger als sechzig Jahre hat es gedauert, bis dieses Epoche machende Werk in deutscher Übersetzung erscheint, stellt der Rezensent Heinz Schlaffer kritisch fest. Dieses Buch über Francois Rabelais war nicht weniger als eines der Gründungswerke der vielleicht wichtigsten Historiker-Schule des vergangenen Jahrhunderts, der Gruppe um die französische Zeitschrift Annales. Lucien Febvre bemüht sich darin um den Nachweis, dass Rabelais - entgegen moderner Tendenzen - nicht aus seinem mentalitätsgeschichtlichen Umfeld zu lösen ist. Das Problem des (Rabelais später unterstellten) Unglaubens im 16. Jahrhundert besteht darin, so Febvre, dass er im christlichen Abendland bis Descartes ein Ding der Unmöglichkeit gewesen sei. Auch wenn der Nachwort-Autor Kurt Flasch an der These vom radikalen Bruch der Weltanschauungen - von Schlaffer zitierte - Zweifel äußert: der Rezensent schwärmt von diesem Buch, preist es als "intellektuelles und sprachliches Vergnügen" und ist entzückt von der ungewohnt "heiteren Form", in der die "unbegrenzte" Gelehrsamkeit hier auftritt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH