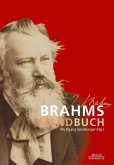Dirigieren ist mehr als das bloße Koordinieren von Musikern! Wolfgang Hattinger zeigt, worüber selten in den Feuilletons gesprochen wird, und was dennoch auf das künstlerische Ergebnis einwirkt: Da sind zum Beispiel Macht und Ohnmacht des Dirigenten oder die Kommunikation mit einzelnen Musikern und dem Orchester nur einige Themen, die die Selbst- und Außenwahrnehmung des Dirigenten bestimmen. Hattinger beschreibt und hinterfragt die weit über das rein Musikalische hinausgehenden Vermittlungsebenen zwischen Dirigent und Publikum, Orchester, Medien, Ästhetik, Partitur und Spiritualität.

Nicht auf das Stöckchen kommt es an, sondern auf richtige Mimik und effektives Proben: Wolfgang Hattinger untersucht den Beruf, in dem Frauen immer noch selten sind - den des Dirigenten.
Von Jan Brachmann
Für das Jahr 2004 verzeichnete das "Performing Arts Yearbook for Europe" insgesamt fünfhundertneunzig Dirigenten. Nur zwölf davon waren Frauen. Wie ist dieses krasse Missverhältnis zu erklären? Liegt es daran, dass der "faschistisch-männliche Mythos von Stärke, Größe und Genie", wie die Musikwissenschaftlerin Nanny Drechsel sich auszudrücken beliebte, das Berufsbild des Dirigenten so fest im Griff hat?
Anke Steinbeck versuchte vor drei Jahren, dem Mythos mit Empirie auf den Leib zu rücken. Ihr Buch "Jenseits vom Mythos Maestro" arbeitete mit Umfragen unter Orchestermusikern und kam zu Ergebnissen, die offenbar die Wissenschaftlerin selbst überraschten: Doppelt so viele Frauen wie Männer schätzten die traditionell als "männlich" ideologisierte autoritäre Arbeitsweise besonders hoch und legten auf "männliche" Führungsstärke bei einem Dirigenten viel mehr Wert als die Männer, die einen kommunikativ-vermittelnden Führungsstil, traditionell als "weiblich" ideologisiert, bevorzugten.
Wolfgang Hattinger betrachtet in seinem Buch den Beruf des Dirigenten aus historischer, soziologischer, arbeitspsychologischer und wirtschaftlicher Sicht. Er zitiert diese Erhebungen und bedauert, dass sie bislang die Einzigen seien. Um deren Ergebnisse in ihrer Aussagekraft halbwegs zu stabilisieren, greift er auf eine ebenfalls 2010 erschienene Studie von Sonja Bischoff über "Männer und Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft in Deutschland" zurück. Auch sie kommt zu dem Schluss, dass Männer den Frauen als Führungskräften viel aufgeschlossener begegnen, als es Frauen tun, die sich anderen Frauen in solchen Positionen gegenüber "etwa doppelt so häufig" negativ kritisch verhalten. Es ist Sonja Bischoff selbst, die die hässlichen Worte "Zickenkrieg" und "Stutenbissigkeit" als Fazit ihrer empirischen Erhebung benutzt.
Hattinger, der auch als Dirigent gearbeitet hat, trägt das alles ohne Eifer, jenseits von Häme oder Triumphalismus vor. Der sachliche Ton hat sogar manchmal etwas geradezu Einschläferndes. Doch übersieht man leicht, dass diese einleuchtende Kritik am Vulgärfeminismus noch auf einer dünnen Datenbasis steht. Zu behaupten, solch ein Verhalten sei evolutionsbiologisch angelegt, statt kulturell gezüchtet, ist zunächst ebenfalls nicht mehr als eine These. Schaut man sich beispielsweise in Nordeuropa um, so stößt man beim Bergen Philharmonic in Norwegen auf ein Orchester, in dem fast alle Stimmführerstellen bei den Streichern und die Solobläser von Frauen besetzt sind.
Man stößt auf Lilli Paasikivi als Opernintendantin in Helsinki und in Estland auf ein kleines Volk, das derzeit mit Anu Tali und Kristiina Poska gleich zwei erfolgreiche Dirigentinnen hervorgebracht hat. Nordeuropa besitzt einen langen Vorsprung in einer weitgehend undramatischen Gleichstellungspolitik. Man könnte die Gegenthese aufstellen, dass sie sich langfristig auf die Arbeitseinstellung bei Männern und Frauen auswirkt. Hattingers Buch hingegen ist in seinem Material stark auf den deutschen Kulturraum beschränkt.
Lohnend ist die Lektüre dennoch, nicht nur für Dirigenten und Musiker, auch für Musikliebhaber und Führungskräfte. Hattinger beleuchtet sowohl die gruppendynamischen wie die neurophysiologischen Aspekte in der Arbeit eines Dirigenten. Die Gruppendynamik erfährt dabei eine wichtige Historisierung. Denn je mehr sich das Ausbildungsniveau der Orchestermusiker in den letzten zweihundert Jahren gehoben hat, desto weniger ist ein autoritärer Führungsstil des An- und Unterordnens angebracht.
Wo der Dirigent mitdenkenden Könnern gegenübersteht, muss er motivieren durch Kenntnis, Persönlichkeit und Argumente. Nikolaus Harnoncourt und Claudio Abbado verkörpern diesen neuen Führungsstil besonders deutlich im Gegensatz zu den Despoten der alten Zeit wie Arturo Toscanini oder Hans von Bülow.
In der Neurophysiologie sind es besonders die im Jahr 1995 entdeckten Spiegelneuronen, die Hattinger interessieren. Sie aktivieren im Gehirn die Regionen, die zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten nötig sind, und zwar bereits dann, wenn diese Tätigkeiten nur bei anderen beobachtet oder sogar gänzlich ohne Beobachtung innerlich vorgestellt werden. Spiegelneuronen sind die wichtigste physiologische Schaltstelle für die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen und für emotional-mentale "Ansteckung". Dass ein Dirigent seine Empfindungen und Gedanken auf Hörer und Spieler überträgt, funktioniert wesentlich über sie.
Im Übrigen, so kann man ebenfalls nachlesen, sind Armbewegungen bei einem Dirigenten für die Orchestermusiker eher nebensächlich. Es kommt vor allem auf die Mimik an, besonders auf die Augen, aber auch den Atem. Die größte Frustration bei den Musikern, auch das ist zentral, lösen zeitverschwenderische Proben aus, die kein spürbares Ergebnis erzielen. Effektive Probenarbeit hingegen ist eine Hauptquelle kollektiven Glücks.
Hattinger erschließt keine neuen Quellen, riskiert kaum neue Thesen, aber er stellt eine gut lesbare Zusammenschau her aus Studien zur Interpretationsgeschichte, zum Arbeitsalltag und aus journalistischen Publikationen zu ökonomischen Entwicklungen. Manches davon, die "Spiegel"-Reportagen von Klaus Umbach oder die chronischen Sticheleien von Norman Lebrecht, mag eher als Indiz denn als Beweis gelten. Wenn es aber wahr sein sollte, dass ein Spitzendirigent um 1910 etwa zehnmal, um 1990 hingegen etwa fünfzigmal so viel verdient hat wie ein Industriearbeiter, dann stellt sich schon die Frage, wie bei angeblich sinkender Ausstrahlungskraft der klassischen Musik die gesellschaftliche Akzeptanz für eine solche Spreizung der Arbeitsvergütung wachsen konnte.
Wolfgang Hattinger: "Der Dirigent". Mythos, Macht, Merkwürdigkeiten.
Verlage Bärenreiter und Metzler, Kassel, Stuttgart, Weimar 2013. 320 S., br., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
So speziell, wie es aussieht, ist dieses Buch offenbar gar nicht. Wolfgang Hattingers Untersuchung zum Beruf des Dirigenten, bietet Jan Brachmann neben interessanten Beobachtungen aus dem Orchesteralltag (etwa zur Bedeutung der Arm- und Augenbewegungen des Menschen am Pult) auch soziologische, arbeitspsychologische, neurophysiologische und wirschaftliche Daten rund um den Dirigenten. Wussten Sie, dass beim Bergen Phiharmonic Orchestra überdurchschnittlich viele Frauen als Stimmführerinnen fungieren? Oder wann der autoritäre Führungsstil eines Toscanini verzichtbar wurde? Brachmann weiß es jetzt, dem Autor sei Dank. Obgleich das Buch keine neuen Thesen enthält, keine neuen Quellen erschließt, wie es heißt, und der sachliche Ton des Autors den Rezensenten etwas ermüdet, als lesbare Zusammenschau zum Thema empfiehlt Brachmann es dennoch allen Musikern und Musikliebhabern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH