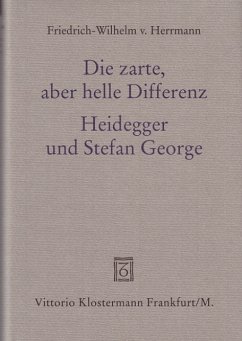Mit der Wendung von der "zarten, aber hellen Differenz" kennzeichnet Heidegger in seiner Freiburger Vortragstrilogie "Das Wesen der Sprache" (1957/58) Denken und Dichten in ihrem Wesensverhältnis. Diese Kennzeichnung erfolgt auf dem Wege eines hermeneutischen Gesprächs mit der Spätdichtung Stefan Georges und in Auseinandersetzung mit der Überlieferung.Diese Abhandlung untersuchtg dieses hermeneutische Gespräch in sechs Schritten. Die Einleitung handelt horizonteröffnend von Denken und Dichten in der Fragestellung des daseinsanalytisch-ereignisgeschichtlichen Denkens. Im Hauptteil wird als erstes die Frage nach dem Wesensverhältnis des Denkens zum Dichten als Frage nach dem Wesen der Philosophie durchsichtig gemacht. Nach dieser zweifachen Klärung der einzuschlagenden Fragebahn geht die Abhandlung über zur Analyse der dichterischen Erfahrung mit der Sprache selbst in der Spätdichtung Stefan Georges. Daran schließt die gesuchte Kennzeichnung des Wesensverhältnisses von Denken und Dichten an, das als Nachbarschaft erblickt wird, in der Denken und Dichten durch eine zarte, aber helle Differenz auseinander gehalten sind.

Die Welt regeneriert sich an Gedichten: Was Heidegger läuten hörte, klingt bei Friedrich-Wilhelm von Herrmann fort
Der Untertitel "Heidegger und Stefan George" darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies ein Buch über Heidegger ist. Sein Titel "Die zarte, aber helle Differenz" ist ein Zitat aus den 1957/58 gehaltenen drei Vorträgen, die in dem Band "Das Wesen der Sprache" ein Jahr später veröffentlicht wurden. Heidegger hat diese Vorträge im Rahmen des "Studium Generale" an der Universität Freiburg gehalten. Friedrich-Wilhelm von Herrmann vermittelt uns einen Hauch von der Atmosphäre eines solchen Ereignisses: "Die überfüllte Aula, die nur mit Eintrittskarten zu betreten war, versammelte unter den Hörern eine große Zahl der Freiburger Professoren von Rang und Namen der verschiedenen Fakultäten." Heidegger nahm dasselbe Thema ein weiteres Mal unter eher noch feierlicheren Umständen auf: bei einer Morgenfeier am 11. Mai 1958, einem Sonntag, im Burgtheater zu Wien. Diese Vorträge sind denn auch keine akademischen Vorlesungen über einen philosophischen Gegenstand, wiewohl bedeutende Schritte auf dem Wege der Heidegger'schen Philosophie: "Das Wort hebt an zu leuchten als die Versammlung, die Anwesendes erst in sein Anwesen bringt."
Wahrscheinlich hätte die lauschende Versammlung damals etwa so reagieren müssen wie Max Kommerell, dem Heidegger 1941 ein Exemplar seiner Rede "Hölderlins Hymne ,Wie wenn am Feiertage . . .'" geschickt hatte: "Ich kenne die Prämissen Ihres Aufsatzes nicht. Wie soll ich Ihnen ein Urteil darüber schreiben?" Von Herrmann berichtet diese Anekdote und begründet damit geschickt sein eigenes Anliegen. Die Prämissen "liegen in dem vollzogenen Übergang aus dem fundamentalontologischen Denken in das seinsgeschichtliche Denken", wofür die "Beiträge zur Philosophie" den Leitfaden bieten. "Innerhalb dieser ereignisgeschichtlichen Blickbahn kommt es zur Wesensbestimmung des Denkens aus seiner Wesensnähe zur Dichtung", schreibt von Herrmann, so dass er sich die schöne Aufgabe stellen kann, das, "was Heidegger aus seinem seinsgeschichtlichen Denken darin verschweigt, hermeneutisch aufzuspüren". Damit führt er die Vorträge auch brillant und mit dem bewährten Geschick des begeisterten Kenners und Lehrers aus der Feierlichkeit von Aula und Burgtheater in die trockenere, aber hellere Atmosphäre des Hörsaals zurück. Vor allem ist hier hervorzuheben, dass er, der ja die Heidegger'sche Sprache so fließend wie seine Muttersprache spricht, selbst so geballte Heideggerismen wie "das aufgeschlossen aufschließende Aufgeschlossenhalten" mit viel Verständnis für seine Leser seinerseits aufschließt. Dabei entsteht eine meisterhafte Einführung mit der für das Thema des Buches entscheidenden ersten Erkenntnis: "Sein und Seinsverständnis des Daseins sind je schon sprachlich verfasst."
Wichtiger ist freilich die Fortführung dieses Ansatzes im "zweiten Ausarbeitungsweg der Seinsfrage", der klären muss, was es mit diesem "je schon" auf sich hat: Es handelt sich dabei eben nicht um einen schon immer und wunderbar gegebenen Zustand, sondern um den "Einsprung in das Ereignis des Daseins", um eine Art Gespräch, in welchem der Mensch als Dasein einem "Anspruch entspricht". Georges Vers "Kein Ding sei wo das Wort gebricht" öffnet die Erkenntnis, dass das Wort "dem jeweiligen Ding erst sein ,ist', sein Sein, vergibt". Das dichterische Sagen geschieht freilich im Bild: Eine Schicksalsgöttin, die Norne, findet kein Wort für ein "Kleinod", das der Dichter nennen möchte und in welchem Heidegger und sein Interpret "das geheimnisvolle Wesen des Wortes selbst" erkennen. Das denkerische Sagen findet dagegen im Begriff statt. Doch hinter beiden steht ein Wesen der Sprache, das Heidegger Sage nennt und wovon der Autor denkerisch Rechenschaft geben möchte: Das Wesen der Sprache ist "das Erscheinenlassen von Welt für das weltverstehende Dasein". Welt heißt hier gerade das, was dem Menschen im Bereich der vier Heidegger'schen Weltgegenden (Erde, Himmel, das Göttliche, die Sterblichen) durch die Sprache gezeigt werden kann.
Als Dichters Atem leiser ging
Für dieses Laut-werden-Können im Wort sucht Heidegger einen Neologismus: Er nennt es das "Geläut", und da diesem kein Laut eignet, nennt er es "das Geläut der Stille": "Das Geläut der Stille ist der Ursprung, dem das lautende und sein-vergebende Wort entspringt." Am Anfang der "sein-vergebenden" Sprache steht darum keine Logik als Lehre des Sagens, sondern eine "Sigetik" als Lehre des Schweigens oder besser des "Erschweigens".
Die letzte Seite widmet von Herrmann einem besonders schönen eigenen Beitrag. Ein Gedicht Rilkes von 1922 scheint geradezu aus dem Heidegger'schen Sprechen zu erwachsen: "Solange du Selbstgeworfenes fängst". Noch einmal ist, nachdem das Fragen sein Ziel fand, dasselbe dichterisch anschaubar und damit auch fraglos geworden. Das trifft auch für die Arbeit des Interpreten selbst zu: Er hat mit vorbildlicher Treue das Denken Heideggers nachgezeichnet, aus den späteren Veröffentlichungen behutsam ergänzt und mit der Entdeckung eines wahrhaft "dichterischen" Gedichts für das "Gespräch zwischen Denken und Dichten" einen weiteren Partner gewonnen. Mehr wollte er nicht geben, mehr hat er nicht gegeben.
Ein Leser freilich, dessen Hauptinteresse sonst im Leben nicht ausschließlich darauf gerichtet ist, die Philosophie Heideggers denkend in dessen eigener Sprache nachzuvollziehen, hat bei der Lektüre dieser hermeneutischen Nachbereitung viele Fragen zu unterdrücken. Darf man dem Buch als weiteres Verdienst anrechnen, dass es solche Fragen provoziert?
Da es das ausdrückliche Ziel des Werks ist, Heideggers Schriften zustimmend und mit dem Blick auf weitere Äußerungen des Philosophen auszulegen, wird dessen "Gespräch zwischen Denken und Dichten" nun auch programmatisch ein Selbstgespräch. Müsste nicht doch ein Verdacht ausgeräumt werden, den jeder Leser genau wie Adorno (zu Heideggers Hölderlin-Interpretation) in sich aufkeimen fühlt: dass er der Dichtung "von außen Philosophie infiltriert"?
Heideggers Wesensbestimmung der "Dichtung" macht sie zur Zeugin für das Geläut der Stille im "sigetischen Bild". Er muss hierzu "die literaturwissenschaftliche Deutung des Dichtens in ,Bildern', die einen ,Sinn' ,versinnlichen', eigens zurückweisen". Von Herrmann räumt Wolfgang Kayser mit seinem "vorzüglichen" "Sprachlichen Kunstwerk" 1948 einen literaturwissenschaftlichen Alleinvertretungsanspruch ein und erläutert damit Heideggers Etagen-Verständnis des "Dichterischen" (mit eigentlicher Dichtung in sigetischen Bildern und sonstiger in herkömmlichen, "versinnlichenden" Bildern). Hält diese Unterscheidung auch einem weiteren Nachdenken über Dichtung stand? Allein der Begriff eines "dichterischen Bildes" ist selbst eine problematische Metapher, von einer "Versinnlichung" genauso weit oder weiter entfernt als ein "Wort". Heidegger selber unterwandert übrigens seine eigene Unterscheidung von Denken und Dichten auch noch durch eine zusätzliche Gegenüberstellung von Denken als Dichten und Singen als Dichten.
Mit dem Singen öffnet sich nun allerdings der Blick auf eine andere Begründung des Wesens der Sprache, die nicht vom "Wort" ausgehen kann, sondern vielleicht vom Satz, wofür die Menschheit eine Zelebrationsform entwickelt hat, den (ursprünglich gesungenen) Vers. Vielleicht wäre eine solche Begründung sogar mit Heideggers Ziel vereinbar? Auf Gesang lässt er sich aber nicht ein und nimmt ihn durchaus nur metaphorisch: "Gesang bleibt Gespräch." Dass George Verse dichtet, ist für das dichterische Bild von der Norne, die keinen "Namen" findet, nicht relevant. Die poetische Vermischung von "Name" und "Wort", die der Interpret übernimmt, die aber auch einen wichtigen Weg der Linguistik an ihre eigenen Grenzen zuschüttet, verlangt von uns Heutigen, dass wir ein Auge zudrücken, wenn wir Heidegger und von Herrmann in ihrem George-Verständnis folgen wollen.
Heideggers eigentümlicher Stil bedient sich zur Bezeichnung von Begriffen mit Vorliebe gerade so bildhafter und "poetischer" Formeln wie "Geläut der Stille". Sie laden zu einem Missverständnis ein, das von Herrmann immer wieder zu zerstreuen bemüht ist, zum Beispiel mit Heideggers Behauptung, das Denken sei bildlos: "Und wo ein Bild zu sein scheint, ist es . . . nur der Notanker der gewagten, aber nicht geglückten Bildlosigkeit." Von Herrmann sagt es noch deutlicher: "Die Rede von einem Walten . . . des Wortes gehört nicht zu einer Sprache- und Wort-Mystik, in der die Sprache zu einem Überwesen hypostasiert wird." Wie unvorsichtig Heidegger mit solchen Bildern verfahren kann, zeigt sich auf beinahe peinliche Weise bei seiner kurzgeschlossenen Anbindung der Mundarten an die "Erde", "aus der wir das Gediegene einer Bodenständigkeit empfangen". Obwohl Theodor Frings die Dialektologie in den Vierzigern entmythologisiert hatte, bleibt auch von Herrmann hier noch hermeneutisch, ohne kritisch zu werden, indem er im Geiste Heideggers dem Menschen eher Wurzeln gönnt als Füße.
Nur noch nicht Zunge zeigen
In einem wirklichen Gespräch zwischen einem Japaner und einem "Fragenden" sagte Heidegger: "Jeder ist jedes Mal im Gespräch mit seinen Vorfahren, mehr noch vielleicht und verborgener mit seinen Nachkommen." Es fällt auf, dass er gerade seine Zeitgenossen, mit denen er ein wirkliches Gespräch führen könnte, hier ausspart. In den George-Schriften spart er sie ebenfalls aus, aber auch fast alle Vorfahren. Die Form des Vortrags rechtfertigt solche Sparsamkeit, aber wie dankbar wären die Leser aus Linguistik und Literaturwissenschaft, wenn der kompetente Interpret sich dazu geäußert hätte. Herder zum Beispiel setzte den Ursprung der Sprache in das (lautlose!) "Merkmal der Besinnung" und sah den Menschen ein "Wort" besitzen, ohne dass es je "seine Zunge zu stammeln versucht hätte" - ist da keine Brücke zum Geläut der Stille?
Eine Generation vor Heideggers frühen Überlegungen zum Wesen der Sprache vollführen auch die Linguistik und die Psychologie in ihren Erfahrungen mit der Sprache eine Wende, die sich heute wie ihr eigentlicher Anfang ausnimmt. Heideggers Gewährsmann für die laut dem Interpreten "bis heute herrschende Grundauffassung" der Sprache ist aber Aristoteles und niemand sonst. Seine Position wird nach Heideggers Übersetzung so zusammengefasst: "Die geschriebenen Buchstaben sind Zeichen für die gesprochenen Laute, diese sind ihrerseits Zeichen für die Erleidnisse der Seele, und diese sind Zeichen der Dinge." Diese museale Auffassung eignet sich vielleicht als Kontrast für Heideggers eigene Sicht, aber bei wem herrschte sie damals noch? Etwa der gern unterschätzte Ferdinand de Saussure oder der spät rezipierte Charles S. Pieree mit seinem Nachdenken über Semiose machen es uns schlicht unmöglich, anders als naiv von einem "Verhältnis von Wort und Ding" zu sprechen. Aber von Herrmann lässt sich gemäß seinem Plan nicht aus der Blickbahn Heideggers hinausdrängen: "Die geläufige Hinblicknahme auf die Sprache ist charakterisiert durch die primäre Orientierung an der Lautgestalt der Sprache", schreibt er. Schon zu Heideggers Zeit galt dieser Satz nicht mehr, hatte doch sogar de Saussure behauptet, das Wesen der Sprache sei der Lautlichkeit des sprachlichen Zeichens fremd. Und näher bei uns hat Derrida diese "geläufige Hinblicknahme" mittels seines freilich auch sehr bildhaften Begriffs "Schrift" gründlich revidiert. Er formulierte 1967, dass die "Urschrift . . ., insofern sie die Bedingung für jedes sprachliche System darstellt, nicht selbst ein Teil davon" sein könne. Ist da nicht wieder eine Verbindung zu Herders Merkmal der Besinnung, und nähern sich die genannten Gelehrten nicht sozusagen von der anderen Seite dem, was Heidegger mit der Sage meint?
Auch Freud hat keineswegs "die Sprache als ein Vorliegendes genommen, nach dessen Wassein gefragt wird"; und der Erneuerer Freuds, Jacques Lacan, behauptet, dass der Mensch spreche, weil die Sprache, die Symbolfunktion, ihn zum Menschen mache, so dass man in einem Handbuch schon einmal lesen kann, dass "sich die strukturalistische Psychoanalyse" Lacans "mit der ,Fundamentalontologie' Martin Heideggers vergleichen" lasse. Gibt es also diese "Nachkommen", mit denen Heidegger vorgreifend schon "im Gespräch" war? Und wäre es da nicht denkbar, dass er nicht so allein steht, wie man nach der Lektüre dieses Buches vermuten müsste, ja dass er zu einem richtigen Ziel vorgestoßen sein kann, obwohl sein Dichtungsverständnis eher privat und sein Verständnis der so genannten herkömmlichen Sprachauffassung sehr beschränkt war"?
Ein Landsmann Heideggers ist einst auch "durch den Irrtum zur Wahrheit und ihrer Erkenntnis" gelangt, indem er ein Wort ("oder drei, wenn mans recht betrachtet") für einen Namen hielt: "Kannitverstan"!
HANS-HERBERT RÄKEL
Friedrich-Wilhelm von Herrmann: "Die zarte, aber helle Differenz". Heidegger und Stefan George. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 1999. 328 S., br. 78,-, geb. 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hans-Herbert Räkel weist in seiner äußerst ausführlichen und detailreichen Rezension zunächst darauf hin, dass - trotz des Untertitels - hier in erster Linie ein Buch über Heidegger vorliegt. Herrmann ("der ja die Heidegger`sche Sprache so fließend wie seine Muttersprache spricht") sei es dabei gelungen, dem Leser die Denkweise des Philosophen auf vergleichsweise verständliche Art und Weise zu vermitteln. Besonders für die sehr wichtige Erkenntnis `Sein und Seinsverständnis des Daseins sind je schon sprachlich verfasst` habe der Autor eine "meisterhafte Einführung" vorgelegt. Räkel stellt auch anerkennend fest, dass Herrmann stets bemüht ist, die leicht zu Missverständnissen führenden Formulierungen Heideggers zu klären. Allerdings wirft die Lektüre seiner Ansicht nach auch zahlreiche Fragen auf, beispielsweise zu den Gedicht-Interpretationen oder auch zum Einfluss Heideggers auf "Nachkommen" wie beispielsweise Jacques Lacan.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH