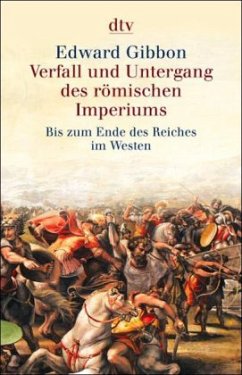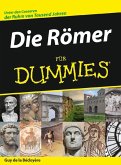Die reichste, raffinierteste Zivilisation der Welt geht an ihrer eigenen Unzulänglichkeit zugrunde, die Metropole versinkt im Chaos, die letzte Stunde des Imperiums hat geschlagen. Der europäische Fantasie kreist bis auf den heutigen Tag um diesen Geschichtsmythos.
Ob es um den Untergang des Abendlandes geht oder um den allerletzten Science-Fiction-Film aus Hollywood - immer ist es die römische Geschichte, die als Modell und Folie dient.
Ihre klassische, nie übertroffene Darstellung, ein nie übertroffenes Meisterwerk der Historiographie, stammt von Edward Gibbon. "Die Geschichte", schrieb er vor mehr als zweihundert Jahren, " ist kaum mehr als ein Register aller Verbrechen, Torheiten und Katastrophen des Menschengeschlechts." Sein Lebenswerk entfaltet diesen Gedanken. Heute, da nur eine einzige imperiale Weltmacht geblieben ist, und angesichts neuer Fundamentalismen, ist es aktueller denn je.
Ob es um den Untergang des Abendlandes geht oder um den allerletzten Science-Fiction-Film aus Hollywood - immer ist es die römische Geschichte, die als Modell und Folie dient.
Ihre klassische, nie übertroffene Darstellung, ein nie übertroffenes Meisterwerk der Historiographie, stammt von Edward Gibbon. "Die Geschichte", schrieb er vor mehr als zweihundert Jahren, " ist kaum mehr als ein Register aller Verbrechen, Torheiten und Katastrophen des Menschengeschlechts." Sein Lebenswerk entfaltet diesen Gedanken. Heute, da nur eine einzige imperiale Weltmacht geblieben ist, und angesichts neuer Fundamentalismen, ist es aktueller denn je.

Edward Gibbons „Verfall und Untergang des römischen Imperiums” in einer neuen Übersetzung
Als Edward Gibbons „Decline and Fall of the Roman Empire” erschien, ist das gebildete Publikum darauf geflogen: Die zwischen 1776 und 1788 in drei Partien publizierte Geschichte von tyrannischen Kaisern und ihren durchtriebenen Eheweibern, von speichelleckerischen Eunuchen, religiösen Schwärmern, verruchten Bischöfen und grobschlächtigen Barbaren kam den Lesern so spannend vor wie die historischen Romane, die später, von Beginn des neunzehnten Jahrhunderts an, alle Welt hinrissen. Gibbons Absicht war das gewesen: Um der guten Lesbarkeit willen hat er das erste Buch seiner Geschichte dreimal geschrieben; erst als seine Satzkadenzen den richtigen Rhythmus hatten, war er es zufrieden. Wie wenige andere historische Werke eignet „The Decline and Fall of the Roman Empire” sich für den lauten Vortrag.
Die neue deutsche Übersetzung von Michael Walter nimmt diese Rhythmik auf. Ohne Gibbon ins Neudeutsche zu zwingen, hat Walter Gibbons Diktion unserem Sprachgebrauch etwas anverwandelt: Seine Sprache bleibt dem Autor des 18. Jahrhunderts treu, sie mag auf manche Leser ungewohnt wirken, keinesfalls aber ungefüg. Das unterscheidet die neue Übersetzung von der bisher gebrauchten, die Johann Sporschill 1837 verfasste. Der berühmte Einstieg in Gibbons Werk lautet bei Walter so:
„Im zweiten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung umfasste das Römische Reich die schönsten Gebiete der Erde und den kultiviertesten Teil des Menschengeschlechts. Die alte Glorie und disziplinierte Tapferkeit schützten die Grenzen dieser weiträumigen Monarchie. Der sanfte, aber wirksame Einfluss der Gesetze und Sitten hatte die Einheit der Provinzen allmählich gefestigt. Ihre friedfertigen Bewohner genossen und missbrauchten die Vorteile von Reichtum und Luxus. Der Anschein einer freien Verfassung wurde mit geziemender Ehrfurcht gewahrt. Der römische Senat hatte nach außen hin die Oberherrschaft inne und übertrug den Kaisern die staatliche Vollzugsgewalt.”
Berühmt wurden diese Sätze deshalb, weil sie Gibbons Haltung als Historiker, seine ironische Distanz zu den allzu menschlichen Dingen seiner Geschichte widerspiegeln. Roms Untertanen genossen und missbrauchten ihren Wohlstand. Ob die Verfassung wirklich frei war, ließ Gibbon dahingestellt: entscheidend war, dass sie den Zeitgenossen so schien. Entsprechend hatte der Senat auch nur „nach außen hin” die Oberherrschaft. Gibbon hatte nicht den Ehrgeiz späterer Historisten, er wollte nicht so sehr zeigen, wie die Dinge eigentlich gewesen, sondern wie sie den Zeitgenossen vorkamen: Er wusste, dass der Anschein es ist, der am Ende Geschichte macht. Sofern Gibbon vom eigentlichen Wesen der Dinge und Ereignisse sprach und also selbst ein Urteil abgab, war es durch den Sarkasmus und die Ironie gebrochen, die sich daraus ergaben, dass er den Menschen für ein Mängelwesen hielt und im Übrigen zu unterhalten trachtete.
Bei Sporschill war „die Vereinigung der Provinzen” – in einer unschön begriffsnahen Übersetzung von Gibbons „cemented” – „festgekittet”. Und „das Scheinbild einer freien Verfassung wurde mit anständiger Verehrung beibehalten”. Auch hatte Sporschill nicht vom kultiviertesten, sondern – Gibbons Wort „civilised” folgend – vom zivilisiertesten Teil des Menschengeschlechts geschrieben. Heutzutage, da das Wort „Zivilisation” soviel wie Kulturform meint, klingt das zu Gibbons Zeit übliche – auf die Entwicklung vom Jäger und Sammler zum Kommerzmenschen bezogene – Verständnis des Begriffs allenfalls an. Deshalb hat Walter sich dafür entschieden, ihn zugunsten der Schlüssigkeit des Satzes zu ignorieren. Walters Übersetzung ist, kurz gesagt, teils besser als die von Sporschill und teils uns Heutigen näher.
Von Rom nach Byzanz
Inwieweit stimmt es aber noch, was Gibbon vor mehr als zweihundert Jahren schrieb? Er arbeitete fast ausschließlich aus publizierten Quellen, und was seine Gewährsleute nicht wussten, von denen nicht die Schlechtesten ihre Werke verfassten, lange bevor das römische Reich überhaupt untergegangen war, das konnte auch Gibbon nicht wissen. Wenn seine Geschichte dennoch von bleibendem Interesse ist, so liegt es an seiner guten Urteilskraft. Zum einen nahm er nämlich an, dass die Menschen aller Zeiten stets die gleichen Neigungen hätten, Hass und Liebe, Feigheit und Tapferkeit, Genusssucht und Machtstreben sah er als universell. Andererseits wusste er, dass alle historische Deutung zeitgebunden war, abhängig vom jeweiligen Standpunkt des Erzählers.
Diese Einsicht, die zum großen Erbe des Humanismus und der Aufklärung gehört, brachte die skeptische Ironie der Aufklärungsphilosophen hervor. Gibbon wandte sie an und musste sich dafür anhören, so unerträglich abgehoben wie Voltaire zu sein. Mochte also seine Darstellung in vielen Details der Revision bedürfen, so war sein Blick auf Rom uns näher als manches andere, was späterhin gesagt wurde.
Der hilfreichen Einführung, die Wilfried Nippel zu dieser neuen Übersetzung beigesteuert hat, ist zu entnehmen, dass Theodor Mommsen auch deshalb zögerte, die Arbeit am fünften Band seiner Kaisergeschichte zu beginnen, weil er nicht wusste, wie er Gibbon übertreffen sollte. Was die Frage von Kaiser Konstantins Religiosität angeht, schreibt Nippel, habe Gibbon mehr Sensibilität „für eine fremdartig anmutende Mentalität” gezeigt, als ein Jacob Burckhardt Mitte des 19. Jahrhunderts es tat.
Ein Manko hat diese gelungene Ausgabe: Es fehlt die zweite Hälfte von Gibbons Werk, jene, die sich mit der Zeit zwischen der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts und dem Fall Konstantinopels im Jahr 1453 befasst: Nachdem Westrom in den „dunklen Jahrhunderten” des Mittelalters aufging, war das Zentrum des römischen Reiches Byzanz. Dieser Verlagerung der Macht ist Gibbon gefolgt, außerdem hat er als Erster eine Geschichte der Kirche geschrieben, von der Kardinal Francis Newman später sagte, es sei doch bemerkenswert, dass ausgerechnet ein Ungläubiger der beste, wenn nicht einzige englische Autor sei, der sich darin ausgekannt habe.
1999 hat J. G. A. Pocock, Doyen der Historiographiegeschichte, sich in zwei Bänden („Barbarism and Religion”, Cambridge University Press) mit Weltanschauung und Geschichtsschreibung der Aufklärung beschäftigt. Beide Bücher kreisen um Edward Gibbon: Pocock zeigt sich fasziniert davon, dass dieser Sohn der Aufklärung ebenjene Kulturentwicklung nicht behandelt hat, die zu seiner Zeit als Gipfelpunkt der Menschheitsgeschichte gesehen wurde: Gibbons „Decline and Fall” handelt eben nicht vom glücklichen Aufstieg der Handel treibenden Zivilgesellschaft. Der erste Teil seines Werkes schildert, wie die barbarischen Stämme, die über die Alpen kamen, zusammen mit der Korrumpierung des Gemeinwesens unter den spätrömischen Kaisern und den politisch- gesellschaftlichen Auswirkungen des Christentums das weströmische Reich zerstörten.
Der zweite Teil befasst sich mit Ostrom, einem Teil der Geschichte, die in Europa bis zum heutigen Tag als so uninteressant gilt, dass auch die Initiatoren dieser neuen Gibbon-Ausgabe davor zurückscheuten, ihn zu publizieren. So eurozentristisch sind wir bis heute. Da wir es nun einmal sind, ist gegen die verlegerische Entscheidung nichts einzuwenden. Schade ist nur, dass Wilfried Nippel in seiner Einleitung gar nichts dazu zu sagen gehabt hat.
FRANZISKA AUGSTEIN
EDWARD GIBBON: Verfall und Untergang des römischen Imperiums. Bis zum Ende des römischen Reiches im Westen. Deutscher Taschenbuchverlag, München 2003. Mit einer Einführung von Wilfried Nippel. 6 Bände, zus. 2270 S., 68 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Edward Gibbons Epochenwerk übers römische Imperium ist neu übersetzt / Von Uwe Walter
Der Titel des Werkes, im Original "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire", ist sprichwörtlich geworden; selbst wer heutzutage keine Vorstellung mehr vom römischen Reich hat, weiß doch dies, daß es untergegangen ist. Historisch-kausale und geistesgeschichtliche Studien zu diesem Thema füllen eine kleine Bibliothek. Aber Edward Gibbon ist mit seiner differenzierten Schilderung der Transformation dieses Reiches - ein Untergang, der vom zweiten nachchristlichen Jahrhundert bis zur Eroberung von Byzanz im Jahre 1453 dauerte, kann nur eine solche sein - kaum für den Dornröschen-Traum späterer Gelehrter in Haftung zu nehmen, die hofften, im Wald die einzige und wahre Ursache für Verfall und Untergang des römischen Imperiums finden und wachküssen zu können.
Für Gibbon, der mit Recht eher darüber erstaunt war, daß das Reich so lange bestanden hat, ergab sich aus dem Zerbrechen des politischen Körpers zuerst im Westen, dann auch im Osten vielmehr ein Bild neuer Gesellschaften, Gesetze, Sitten und neuen Glaubens und Aberglaubens, mithin ein lebendiger Zusammenhang, der in seinen verschiedenen Stadien eher beschrieben denn aus bestimmten Voraussetzungen oder gar einzelnen Ursachen erklärt werden konnte und mußte.
Als Thesenbuch wahrgenommen, erregte das zwischen 1776 und 1788 in sechs Bänden publizierte Werk noch lange nach dem Tode des Autors im Jahre 1794 heftigen Widerspruch zumal bei den Kirchen aller Konfessionen, aber gelesen wurde Gibbon, weil er viel mehr bot, als in den berühmten Kapiteln vierzehn und fünfzehn über die Ausbreitung des Christentums an kritischen Richtigstellungen und hintersinnigen Sottisen ausgebreitet war. Und so provozierend diese knapp zweihundert Seiten in einer Zeit, als die Kämpfer für und wider den Glauben von tiefster Überzeugung angetrieben wurden, auch erscheinen mochten, so modern nehmen sie sich im Rückblick aus, nicht nur wegen der deutlichen Reduzierung der bis dahin angenommenen Opferzahlen bei den Christenverfolgungen. Seit Gibbon war es möglich, die Geschichte des Christentums als Teil der allgemeinen und der Sozialgeschichte Europas zu schreiben. Die eigene Glaubensüberzeugung des Autors konnte dabei keine Rolle mehr spielen, und konsequenterweise folgte Gibbon keiner der vielen Aufforderungen, sich in dieser Hinsicht zu erkennen zu geben. Er war viel zu sehr Historiker, um Agnostikern und Klerikalen auf den Platz des Kampfes um die letzte Wahrheit zu folgen.
Alle ironische Polemik gegen Mönche und Märtyrer und gegen die Differenz von Sollen und Sein beim kirchlichen Personal verstellte ihm daher nie die Einsicht, wie rasch die Christianisierung des Reiches unumkehrbar geworden war und welche Kräfte dadurch auch freigesetzt wurden. Gibbons distanzierte, ja kritische Schilderung von Kaiser Julians aussichtslosem Versuch der Restauration eines philosophisch geläuterten Heidentums irritierte denn prompt viele betont aufgeklärte Leser. Auch zum verfeinerten Lebensstil, der "unter dem gehässigen Namen Luxus von den Moralisten jedes Zeitalters scharf angeprangert" worden sei, hatte der Historiker-Gentleman nur Differenziertes zu sagen.
Die methodologische Sonderstellung des Werkes ergab sich zum guten Teil aus pragmatischen Entscheidungen. Der Autodidakt Gibbon wählte eine leidlich gut dokumentierte Epoche der Geschichte, bediente sich der Sammlungen und Studien von Altertumsforschern und dogmatisch gebundenen Kirchenhistorikern, ließ sich von Voltaire, Montesquieu und den soziologischen Erkenntnissen der schottischen Aufklärung inspirieren und nutzte seine - nicht sehr gründlichen - Erfahrungen als Milizoffizier und Parlamentsabgeordneter. Aber die geistigen, schriftlichen und lebensweltlichen Quellen zu identifizieren sagt fast nichts über das Werk aus. Anders gewendet: Die von Common sense geprägte Synthese war viel mehr als die Summe ihrer Voraussetzungen. Was Gibbon in einer Fußnote dem Verfasser einer gelehrten Abhandlung über die Wanderung der Germanen bescheinigte, hätte mit gleichem Recht in den Spiegel gesprochen sein können: Nur selten finde man eine so glückliche Verbindung von Altertumsforscher und Philosophen. Aber eine Generation nach Gibbon erblickte die Geschichtswissenschaft bei ihrer Selbsterfindung den archimedischen Punkt in der Quellenkritik und drängte die leitenden Ideen in die Implizitheit des Selbstverständlichen ab. So wurden Niebuhr und Ranke die Helden des Urknalles einer strengen Disziplin, Gibbon dagegen fand sich der Vorgeschichte zugeschlagen und zum bloß geistreichen Kompilator unkritisch gesammelter Gelehrsamkeit erklärt.
Philologen aus der Schule Karl Lachmanns mußten in der Tat seufzen, wenn sich Gibbon in der Fußnote zu einer der bis heute meistdiskutierten Tacitus-Stellen gegen die gängige Lesart entschied und dabei nur "Sinn und Verstand, Justus Lipsius und einige Manuskripte" auf seiner Seite wußte. Seine Einsicht, daß eine noch so glänzende Idee ohne Wert bleibt, wenn sie nicht durch Belege untermauert werden kann, daß aber ebenso eine Anhäufung von Fakten keine Geschichte ergibt und daß schließlich die Zivilisation mit ihren Bestandteilen Gesetz, Religion und Handel ein ergiebigerer Gegenstand ist als Kriege und diplomatische Rochaden, all dies schlug keine Funken, weil "Decline and Fall" als wissenschaftlich antiquiertes Meisterwerk der historischen Literatur galt. Die auf der Höhe seiner Zeit entwickelte Verbindung von gelehrter Historie und philosophischer Geschichte blieb als Antwort ungehört, weil die Fragen der neuen Wissenschaft inzwischen anders lauteten.
Selbstverständlich kann und sollte man "Decline and Fall", das zu den Klassikern der englischen Literatur zählt, auch ganz anders als nur wissenschaftsgeschichtlich lesen, etwa als Beitrag zur aktuellen Imperiendebatte und zur moralischen Redimensionierung von Geschichte oder einfach als vielschichtig-ironisches Lesevergnügen, mit wunderbaren Sätzen wie: "Die verschiedenen in der römischen Welt herrschenden Kulte galten sämtlich dem Volk als gleich wahr, den Philosophen als gleich falsch und der Obrigkeit als gleich nützlich."
Die Voraussetzungen für alle denkbaren Lektüren sind mit der nun vorliegenden Edition gegeben. Sie enthält die erste Hälfte des Gesamtwerkes, bis 476 nach Christus reichend, und setzt die einst mit Kassettenausgaben von Theodor Mommsen und Ferdinand Gregorovius begonnene Tradition des Verlags würdig fort. Die Neuübersetzung von Michael Walter ist sehr gut lesbar, vermittelt aber zugleich einen treffenden Eindruck vom variationsreichen Stil Gibbons. Walter Kumpmann hat die für das Verständnis von Gibbons Historiographie unentbehrlichen Fußnoten nach der verbreiteten wissenschaftlichen Ausgabe J. B. Burys übersetzt, Wilfried Nippel für den auch sonst sehr nützlichen Anhangsband auf knapp hundert Seiten eine gediegene Einführung zu Autor und Werk beigesteuert. In einer Zeit, die das Wort Bildung auf den Namen Schwanitz buchstabiert, zeugt diese erschwingliche Edition eines europäischen Grundbuchs von geradezu revolutionärem Mut.
Edward Gibbon: "Verfall und Untergang des römischen Imperiums". Bis zum Ende des Reiches im Westen. Aus dem Englischen von Michael Walter und Walter Kumpmann. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2003. 6 Bände in Kassette. 2270 S., br., Subskr.-Preis bis 31. Januar 2004 68,- [Euro] , danach 78,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Lange Zeit sah Edward Gibbons berühmtes Buch aus wie der klare Verlierer im Wettstreit geschichtswissenschaftlicher Methodik. Man hat es viel gepriesen und kaum weniger gelesen, jedoch mangelt es an dem, was der Geschichtsschreibung zum Fetisch wurde, der Quellenkritik - und also war Gibbon nicht mehr als Vorgeschichte der eigenen Disziplin. Das beginnt man, wie der Rezensent Uwe Walter feststellt, inzwischen differenzierter zu sehen - und zwar mit Recht. Denn durch die neue, "sehr gut lesbare" Übersetzung (bisher nur des ersten, auch schon sechs Bände umfassenden Teils) biete sich nun die Gelegenheit, festzustellen, dass sich in Gibbon die nur selten anzutreffende "glückliche Verbindung von Altertumsforscher und Philosophen" findet. Und ein "vielschichtig-ironisches Lesevergnügen" sei das Werk obendrein. Die Fußnoten, übersetzt nach der wissenschaftlichen englischen Ausgabe machen einen, so Walter, schlauer - für die "gediegene Einführung zu Autor und Werk", die den Bänden gleichfalls beigegeben ist, gilt dasselbe.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"