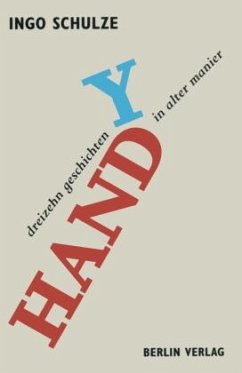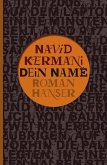Nach dem großen Erfolg seines epochalen Romans Neue Leben beschreitet Ingo Schulze in seinen Erzählungen Handy ganz neue Wege. In raffiniert variierenden Beziehungskonstellationen erweist er sich als großer Erzähler klassischer Prägung und einmal mehr als einer der bedeutendsten europäischen Schriftsteller seiner Generation.
Silvester 1999, die Millennium-Nacht in Berlin. Frank Reichert, als ostdeutscher Jungunternehmer erfolgreich im Westen angekommen, begegnet auf der Silvesterfeier an der Schwelle zum neuen Jahrtausend Julia, seiner verlorenen großen Liebe. Seit der Trennung im Herbst 1989 wandelt er wie ein Fremder durchs Leben, fast unbeteiligt erlebt er neue Beziehungen und den Erfolg seines florierenden Geschäfts. Nichts mehr kann ihn im Tiefsten berühren, über allem liegt Julias Schatten und die Möglichkeit eines anderen Lebens. So wird das Ende der Nacht zu einem Neubeginn, mit dem keiner gerechnet hat. Zwischen Abschied und Aufbruch taumeln fast alle Figuren in Ingo Schulzes neuen Erzählungen. Oft reicht schon ein einziger irritierender Blick, um das scheinbar harmonische Gefüge einer frischen Liebe, einer nachbarschaftlichen Bekanntschaft oder eines unbeschwerten Urlaubs aus den Angeln zu heben. Ob im Friseurladen in Manhattan, in einer Datscha im Berliner Umland - stets umgibt eine Atmosphäre diffuser Bedrohung die selbstgeschaffenen Fluchtorte. In diesen Heterotopien der Seligkeit behaupten sich Schulzes Protagonisten gegen eine ständig be-schleunigende Welt, die mit ihren Fallstricken bis in die eigenen vier Wände reicht. Mit untrüglichem Gespür für tragikomische Situationen umkreist Ingo Schulze das Wesen der Liebe, das Ringen um Würde im Abschiednehmen und das Geschenk glückhafter Epiphanien mitten im Alltag.
Silvester 1999, die Millennium-Nacht in Berlin. Frank Reichert, als ostdeutscher Jungunternehmer erfolgreich im Westen angekommen, begegnet auf der Silvesterfeier an der Schwelle zum neuen Jahrtausend Julia, seiner verlorenen großen Liebe. Seit der Trennung im Herbst 1989 wandelt er wie ein Fremder durchs Leben, fast unbeteiligt erlebt er neue Beziehungen und den Erfolg seines florierenden Geschäfts. Nichts mehr kann ihn im Tiefsten berühren, über allem liegt Julias Schatten und die Möglichkeit eines anderen Lebens. So wird das Ende der Nacht zu einem Neubeginn, mit dem keiner gerechnet hat. Zwischen Abschied und Aufbruch taumeln fast alle Figuren in Ingo Schulzes neuen Erzählungen. Oft reicht schon ein einziger irritierender Blick, um das scheinbar harmonische Gefüge einer frischen Liebe, einer nachbarschaftlichen Bekanntschaft oder eines unbeschwerten Urlaubs aus den Angeln zu heben. Ob im Friseurladen in Manhattan, in einer Datscha im Berliner Umland - stets umgibt eine Atmosphäre diffuser Bedrohung die selbstgeschaffenen Fluchtorte. In diesen Heterotopien der Seligkeit behaupten sich Schulzes Protagonisten gegen eine ständig be-schleunigende Welt, die mit ihren Fallstricken bis in die eigenen vier Wände reicht. Mit untrüglichem Gespür für tragikomische Situationen umkreist Ingo Schulze das Wesen der Liebe, das Ringen um Würde im Abschiednehmen und das Geschenk glückhafter Epiphanien mitten im Alltag.

Was ist das, eine Geschichte? An diesem Freitag erscheint „Handy”, der erste Erzählungsband von Ingo Schulze
Wenn Sie am liebsten Liebesgeschichten lesen, dann ist der neue Erzählungsband von Ingo Schulze „Handy. Dreizehn Geschichten in alter Manier” genau das Richtige für Sie. Sollten Sie sich allerdings vor dem Ausdruck Liebesgeschichten genieren, weil er Ihnen zu schnulzig klingt, dann können wir auch sagen: Paargeschichten. Denn es sind keine Geschichten, in denen am Ende im Weichzeichner die Liebe triumphiert, sondern solche, in denen mal die schöne Gewohnheit, mal die hässliche Trägheit, mal die plötzliche Erkenntnis und sehr oft die Zeit und ihr unaufhaltsames Zermürbungswerk das letzte Wort haben.
Fast alle der 13 Erzählungen entspinnen ihre Geschichte zwischen einem Mann und einer Frau (oder auch: zwei Frauen). Wobei zumindest die männliche Figur in der Mehrheit der Erzählungen denselben psychischen Phänotyp darstellt: kein Polterer, kein Lauter. Eher einer, der erst einmal nachsichtig mit der Welt umgeht und so etwas wie die Verkörperung des Satzes „An mir liegt’s nicht” darstellt. Auf den ersten Blick wirkt er vielleicht ein wenig harmlos, aber da sollte man sich nicht zu sicher sein, er kann manches Wässerchen trüben. Vielleicht nicht regelrecht ein Dulder, so doch ein Mensch mit mehr Harmoniebedürfnis als seine Partnerinnen, die in der Regel die schärfere Zunge führen, die unerbittlicheren Urteile fällen, ihre Launen weniger im Zaum halten und insgesamt ein schrofferes Wesen nach außen tragen.
Ingo Schulze hat hier ein Schreiben zur Vollendung gebracht, das den Leser durch den Schein verführt, unmittelbar das Leben selbst zu sein. Es ist die hohe Kunst des Ingo Schulze, das Kunstförmige seines Erzählens zum Verschwinden gebracht zu haben. Die literarische Form hebt sich von dem in ihr Dargestellten überhaupt nicht mehr ab. Sie funktioniert wie ein märchenhaftes Kleidungsstück, das so perfekt maßgeschneidert ist, dass es von dem Körper, den es umhüllt, nicht mehr zu unterscheiden ist.
Das ist natürlich eine Illusion, eine großartige Illusion, die bei Schulzes Erzählungen mit dem ersten Satz da ist. Dieser ist immer ohne Umschweife mitten im Geschehen, stellt sogleich Spannung her und vermeidet jede Form von rhetorischer Gravität. Der Tonfall, den der Erzähler anschlägt, ist dabei so vertraulich, als würde er den Leser seit langem kennen, ein guter Freund, dem gegenüber er nicht weit ausholen muss: Man versteht sich ja. Manchmal hat man regelrecht das Gefühl, man säße mit dem Erzähler, den man seit Sandkasten-Zeiten kennt, an einem Kneipentisch und sagte: „Nun, schieß los! Was ist passiert?”
„Sie kamen in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli, zwischen zwölf und halb eins. Viele werden es nicht gewesen sein, fünf, sechs Kerle vielleicht.” So fängt die Titelgeschichte „Handy” an. „Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. War es eine Katastrophe? War es eine Lappalie? Oder einfach nur etwas Unalltägliches?” So beginnt „Milva, als sie noch ganz jung war”. Und „Die Verwirrungen der Silvesternacht” beginnt: „Früher habe ich mich immer vor Silvester gefürchtet. Überhaupt führte ich ein unmögliches Leben. Nur das Geschäftliche funktionierte. Es funktionierte sogar besser, als mir lieb war.”
Dieser Eindruck, dass die Form mit bloßem Auge kaum mehr zu erkennen ist (und also die Tauben nach den gemalten Kirschen des Zeuxis picken), rührt noch von etwas anderem her: Diese Erzählungen haben keine Botschaft. Zwar passiert in ihnen immer etwas, und meistens sogar sehr viel, an Erlebnissen mangelt es den Figuren nie. Aber es entsteht nicht der Eindruck, diese Erlebnisse stießen den Figuren zu, um ihnen ein Licht aufzusetzen, oder damit der Leser eine Lehre daraus ziehen könnte. Zwar spult sich das Leben ab, dieses ist in jedem seiner Einzelmomente interessant und psychologisch reich. Es will aber keineswegs auf irgendetwas hinaus.
Die expliziteste Erzählung heißt „Keine Literatur oder Epiphanie am Sonntagabend”. Der Ich-Erzähler ist mit seiner Frau, den zwei Töchtern, seiner Mutter und zwei Freundinnen auf die Datsche im Brandenburgischen gefahren. Es ist Sommer, Fußball-WM, richtig heiß, und wie es sich gehört, grillt man, hat Kartoffelsalat dabei, selbstgebackenen Kuchen, trinkt Bier und Prosecco. „Ich kann mir schon vorstellen”, heißt es dann, „wie das für fremde Ohren klingt, nur fressen und saufen.” Dann aber entdeckt die kleine Franziska, die gerade das Sprechen lernt, eine Orangenschale im Gras und fragt „wahs?”, also was das sei. Ihr Vater antwortet geduldig immer wieder: „Eine Orangenschale.”
Und plötzlich macht es einen Sprung: „Beide betrachteten wir die Orangenschale und mit ihr das Wunder, dass es die Orangenschale und uns und alle und alles gab, das ganze Wunder eben. Mehr gibt es nicht zu sagen, verlangen Sie keine Erläuterungen. Wir begriffen das Wunder, dass es uns gibt. Punkt. Soll ich sagen, ich sah uns im Schoße des Weltalls? Aber ich sah nicht nur uns, sondern alle und alles. Und jede und jeden und jedes, aber nicht so, wie man etwas überblickt, sondern so, als befände sich jede und jeder und jedes ganz nah. Wir waren allem Scheußlichen ausgeliefert und allem Menschlichen und allem Hässlichen und allem Schönen. Ich war nicht getrennt davon, es war nichts dazwischen, zwischen mir, uns und allem.”
Diese Seins-Erfahrung mit allem Scheußlichen, Menschlichen, Hässlichen und Schönen kann man in allen dreizehn Geschichten machen. Und tatsächlich gilt auch da: „ . . . es war nichts dazwischen”, so schmiegt sich die Erzählform dem Leben an. Es ist die symbolisch ausdrücklichste Erzählung von Schulze – aber dafür steht im Titel ja auch unüberlesbar: „Keine Literatur”.
Ganz anders die Erzählung „Milva, als sie noch ganz jung war”. Sie ist gebaut wie eine klassische Novelle (und das gilt nicht nur für diese Erzählung), also mit einer „unerhörten Begebenheit” im Zentrum. Tatsächlich ist danach vieles anders, aber eben doch nur vieles, nicht alles, und inwiefern das, was dann anders ist, mit dem unerhörten Ereignis zusammenhängt, ist kaum zu fassen. Drei Paare, sie kennen sich alle seit ihrer Jugend, fahren zusammen in die Ferien nach Umbrien. Während die Frauen noch einen Einkaufsbummel durch Perugia machen, fahren die Männer voraus, um das Ferienhaus in Besitz zu nehmen.
Als sie an die Tür des Landhauses klopfen, beugt sich ein Mann aus dem Fenster und pöbelt sie mit Berliner Schnauze an. Die Männer sind empört, halten die Buchungsbestätigung in den Händen. Als das Berliner Großmaul nach draußen kommt und „Haut ab, haut ab!” brüllt, kommt es zu einem Handgemenge, der Berliner verteilt eine Ohrfeige, die anderen stürzen sich auf ihn und – sie wissen, unerfahren, wie sie sind, nicht recht, was sie tun – richten ihn ganz schön zu. Plötzlich kommt eine rothaarige Frau aus dem Haus, sagt kein Wort, zielt mit ihrem Revolver abwechselnd auf die drei Freunde, während sie zu ihrem Auto geht und sich aus dem Staub macht. Die drei Männer lassen ab von dem Berliner, der röchelnd am Boden liegt (und dem es vermutlich schlechter geht, als der Ich-Erzähler zugibt), und verlassen fluchtartig den Ort des Geschehens.
Den Frauen erzählen sie eine abgespeckte Version, auch untereinander wird nicht mehr darüber gesprochen, stattdessen der Urlaub in einer anderen Unterkunft fortgesetzt. Das Verhältnis des Ich-Erzählers zu seiner Frau und zu seinen Freunden scheint plötzlich ein anderes. Oder war es nicht vorher schon ein höchst brüchiges? Lag nicht schon vorher latent Gewalt in der Luft? Am Ende sagt der Erzähler, wenn er an den Urlaub zurückdenke, bekomme er „jedes Mal eine Gänsehaut und möchte am liebsten ein Lied anstimmen”. Es war also wohl doch eher: nichts?
Oft passiert in diesem Buch einem Paar etwas Zufälliges, das dann einen Effekt auf die Beziehung hat. Was ist es, fragt man sich beim Lesen, das unser Leben bestimmt? Der Zufall, das Schicksal? Die Erzählung „Mr. Netherkorn und das Schicksal” handelt davon: „Das Grimm’sche Wörterbuch bringt viele Beispiele für die Verwendung des Wortes, etwa bei Goethe: ,Das Schicksal, für dessen Weisheit ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben.‘ Dieser Satz beantwortet alle Fragen, selbst solche, die mich in der Schulzeit bedrängten: Warum ist die historische Mission der Arbeiterklasse gesetzmäßig und warum muss die Arbeiterklasse von einer Partei neuen Typs geführt werden? Weil das Schicksal im Zufall ein ungelenkes Organ hat.” Aber das gilt nicht nur auf der Problemhöhe der Weltgeschichte, sondern auch im Klein-Klein von Kabale und Liebe. Schulzes Geschichten erzählen davon, wie dieses „ungelenke Organ” Männer und Frauen zusammen- oder auseinanderbringt.
Beide Ebenen, Weltgeschichte und Liebesgeschichte, sind vorzüglich zusammengeführt in der Erzählung „Die Verwirrungen in der Silvesternacht”, die im Übrigen eine hübsche Klein-Ausgabe von Ingo Schulzes großem Deutschland-Roman „Neue Leben” darstellt. Eine der brillantesten Passagen von „Neue Leben” erzählt von den Wochen vor dem Mauerfall, und wie der Protagonist, der seit seiner Jugend von seinem Coming- out als subversiver Schriftsteller träumt, plötzlich von seiner Freundin zum Jagen getragen werden muss und nur wie aus Pflichterfüllung zur Montagsdemonstration nach Leipzig fährt. Der Witz ist, dass seine plötzliche Zurückhaltung nichts mit Opportunismus zu tun hat, sondern eher mit einer verqueren Gefühlsvornehmheit und gekränkter Liebe, weil es zwischen den beiden gerade nicht so gut läuft, und er sich auch sonst mit biographischen Selbstzweifeln herumquält. Glaube nur keiner, dass die trotzigen Gefühle schweigen, nur weil man gerade dabei ist, eine Diktatur zu stürzen!
In „Die Verwirrungen in der Silvesternacht” verliert der Erzähler Julia, die Liebe seines Lebens, weil sich plötzlich die Ereignisse von 1989 dazwischenschieben. Stattdessen kommt er, während man fürs Neue Forum Handzettel kopiert, mit Ute zusammen, aber das verbucht er nicht unter Liebe. Er hält es eher für eine pragmatische Entscheidung, denn die beiden haben bald eine Kopierladen-Kette und ein glückliches Händchen im neuen Kapitalismus. Erst nach zehn Jahren realisiert er, dass Julia keine Rolle mehr spielt und er wirklich gerne mit Ute zusammen ist. Von da an laufen die Geschäfte leider schlecht . . .
Man hat Ingo Schulzes „Simple Storys” gerne mit Raymond Carver in Verbindung gebracht. Schon für „Simple Storys” leuchtete das nur begrenzt ein. „Handy” jedenfalls hat mit der tendenziell einsamen Lakonie von Carvers Stil und seinen Settings nichts zu tun. Es geht immer um reiche soziale Konstellationen. Die Figuren bewegen sich im Netz eines erweiterten Freundeskreises. „Eine Nacht mit Boris” ist gewiss nicht die beste Geschichte des Bandes, aber man kann sie lesen wie ein Gleichnis des eigenen Schreibens, besser: des Geschichten-Erzählens. Denn sie erzählt „neben anderem” davon, wie sich eine Abendgesellschaft über die Beklommenheit, Fremdheit und latente Gereiztheit hinwegrettet, indem jeder plötzlich anfängt, einen Schwank aus seinem Leben zu erzählen. Wie in Boccaccios „Decamerone” wird das Geschichtenerzählen zum Motor für soziale Nähe: Man gehört zusammen, weil man sich seine Lebensgeschichte erzählt hat.
Was aber ist das, eine Geschichte? Ist uns unser eigenes Leben vielleicht nur in Form von Geschichten zugänglich? Ist womöglich unser Leben im selben Maße inszeniert wie sie? Ingo Schulze hat den meisten seiner Erzähler biographische Daten verpasst, die mit denen ihres Autors identisch sind. Oft ist der Protagonist ein Schriftsteller, der auf das Œuvre von Ingo Schulze zurückblicken kann. Schulze kann so unverblümt auf das eigene Leben als Substrat seiner Erzählungen zurückgreifen, weil er sich ihres Kunstcharakters absolut sicher ist. Für etwas so gut Erzähltes kann kein Schriftsteller persönlich belangt werden. IJOMA MANGOLD
INGO SCHULZE: Handy. Dreizehn Geschichten in alter Manier. Berlin Verlag, Berlin 2007. 281 Seiten, 19,80 Euro.
„Wir begriffen das Wunder, dass es uns gibt. Punkt.”
„Goethes Satz beantwortet sogar die Fragen meiner Schulzeit.”
„Ich bekomme eine Gänsehaut und möchte ein Lied anstimmen.”
Berlin, aufgenommen im Jahre 2005: Hier saß es eben noch, das Paar, bis der Zufall es auseinandertrieb. Oder der Dritte. Foto: Regina Schmeken
Der Schriftsteller Ingo Schulze in Berlin. Foto: Regina Schmeken
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

"Handy", ein literarisches Ereignis: Mit seinen dreizehn neuen Erzählungen zeigt Ingo Schulze souverän, wie sich die größte literarische Raffinesse hinter einem schlichten Erzählton verbergen lässt.
Von Hubert Spiegel
Wie soll man das nennen, wenn ein Mann, ein Ingenieur, der auf dem Arbeitsamt stolz von sich sagen kann, er habe ein Kraftwerk gebaut, seinen Job verliert, fortan zuhause bleibt, sich um Haus, Garten, Einkauf und Gebäck zum Tee kümmert und eines Tages feststellt, dass er im eigenen Haus nicht viel anders lebt als die Maus, die zu fangen er von den Nachbarn eine Falle ausgeliehen hat?
Er liegt im Bett, lauscht den morgendlichen Alltagsgeräuschen, und plötzlich wird ihm klar, dass die Maus die ganze Zeit dieselben Geräusche hört wie er: "Und dass sie wohl unterscheiden konnte, ob jemand die Treppe hinunterging oder heraufkam, und dass sie, die Maus, wenn sich Schritte näherten, Angst empfand, und vielleicht sogar Freude, oder zumindest Erleichterung, wenn sie sich entfernten, obwohl es an ihrer Situation nichts veränderte." Was für die Maus gilt, gilt auch für den Mann. Die beiden teilen das Haus, die Perspektive, das Leben. Dieser Mann ist verwandelt, er ist vermaust, längst schon, aber erst jetzt, im Bett, wird es ihm klar, von einer Sekunde auf die andere, und in diesem Augenblick der Einsicht wird er gefangen bleiben, vielleicht nicht für immer, aber für lange Zeit.
Der Stellenwert des Glücks.
Von dieser und anderen Fallen erzählt das neue Buch Ingo Schulzes, von Menschen, die Fallen aufstellen, ohne es zu merken und hineintappen, ohne es zu merken. Bis dann der Augenblick der Erkenntnis kommt, in dem die unsichtbaren Gitterstäbe plötzlich sichtbar werden und immer näher rücken, bis sie ins Fleisch schneiden. Und plötzlich wird die Luft knapp für einen Moment, und dann geht das Leben weiter. Das Leben geht ja immer weiter, es fühlt sich nur anders an mit einem Mal. Aber wie soll man das nennen?
Ingo Schulze hat nicht nach Begriffen gesucht, sondern er versammelt in seinem neuen Erzählungsband "Handy" Situationen, Begebenheiten, Augenblicke: Ein Straßenjunge springt in Kairo auf den Kofferraumdeckel eines Taxis und klammert sich fest in rasender Fahrt, und der deutsche Fahrgast wird sich nie verzeihen oder erklären können, warum er solange gewartet hat, bevor er den Taxifahrer zum Anhalten aufforderte. Oder der Gipfel einer Ehekrise, die damit endet, dass der Mann, der den Kopf seiner betrunkenen Frau hält, keinen anderen Ausweg mehr sieht, als den offenen Mund zu küssen, aus dem sich gerade der Mageninhalt in die Kloschüssel ergossen hatte. Oder das Aufblitzen einer Erkenntnis, als ein Mann seiner ehemaligen Geliebten im Café gegenübersitzt: "In mir ist keine Liebe."
Oft ist in diesen Geschichten, die überwiegend in der Ich-Form erzählt werden, von Liebe die Rede, und von Paaren, die sich gefunden und wieder verloren haben. Und immer wieder trägt der Ich-Erzähler unverkennbar Züge des Autors, hat die langen Haare Ingo Schulzes oder wird als Verfasser eines Buches mit dem Titel "Dreiunddreissig Augenblick des Glücks" vorgestellt. Spricht hier also, wenn Ingo Schulze "ich" sagt, wirklich Ingo Schulze?
Man könnte es kokett nennen, dass Schulze immer wieder Realitätspartikel der eigenen Biographie in seine Geschichte einstreut. Und man müsste eigentlich misstrauisch werden, wenn ein Schriftsteller über einen Schriftsteller schreibt, der sich auf Lesereise befindet oder gerade irgendwo ein Stipendium abwohnt. Normalerweise ist das ein höchst bedrohliches Zeichen, das sich nicht selten mit dem zweiten Buch einstellt: Nach dem gelungenen Debüt kommen die Stipendien, nach den Stipendien kommt das Buch über die Stipendienzeit, und danach kommt dann nichts mehr. Aber müsste ein Ingo Schulze nicht gegen einen solchen Absturz gefeit sein?
Als 1995 der Debütband "Dreiunddreissig Augenblicke des Glücks" erschien, stellte Schulze dem Buch eine kleine Herausgeberfiktion voran: Nicht er habe diese Geschichten geschrieben, sondern ein gewisser Hofmann, der sein Manuskript einer zufälligen Reisebekanntschaft überlassen habe, die es dann an "I. S." geschickt habe, der die Geschichten herausgibt, weil er glaubt, sie könnten "die anhaltende Diskussion um den Stellenwert des Glücks" beleben. In seinem Roman "Neue Leben", 2005 erschienen, hat Schulze wiederum mit einer Herausgeberfigur gearbeitet. Warum? Was verspricht er sich davon, und warum so kompliziert?
Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert diente die Herausgeberfiktion der Abwehr des Vorwurfs, in der Literatur sei alles nur erfunden und gelogen. Der wahre Autor erfand sich also einen fiktiven Autor, um den fiktiven Charakter seines Textes zu verschleiern. Später war die Herausgeberfiktion ein ironisches Zitat, ein literarisches Spiel, das den Kunstcharakter der Fiktion nur umso stärker betonen sollte: Jeder Realitätsgehalt wurde so ironisch gebrochen. Jetzt, im neuen Buch, geht Schulze den umgekehrten Weg: Er erfindet verschiedene Erzähler, verleiht ihnen erkennbar Züge der eigenen Person und suggeriert so dem Leser: Es ist ja gar nicht erfunden, was du hier liest. Ich, Ingo Schulze, habe es selbst erlebt. Das stimmt natürlich nicht, oder allenfalls zum Teil. Ja, Ingo Schulze war schon einmal in Kairo, und gewiss war er auch in Estland: Aber hat er wirklich einen Bären auf einem Damenrad vor seinen Jägern flüchten sehen? Und hat er wirklich seine Geliebte in Ägypten an einen jungen und ausnehmend charmanten Reiseführer verloren, wie er es in "Zwischenfall in Kairo" beschreibt?
In der Endlosschleife der Liebe.
Immer öfter, immer deutlicher setzt Schulze diese Brechung im Verlauf des Buches ein, immer häufiger werden die Verweise auf die Person des Autors. Zum Schluss kulminiert die Sache: "Noch eine Geschichte" handelt von einem Schriftsteller, der an einer Erzählung mit dem Titel "Zwischenfall in Petersburg" arbeitet. Das ist ein doppelter Verweis, zum einen natürlich auf die Geschichte "Zwischenfall in Kairo", zum anderen auf den Debütband von 1995, der St. Petersburg zum Schauplatz hatte. Während einer Zugfahrt von Budapest nach Wien liest der Erzähler jetzt eine von Istvan Örkénys "Minutennovellen" mit dem Titel "Schleifen", verliert aber kein Wort über den Inhalt. "Schleifen", das ist auf nur drei Seiten rasch nachgelesen, handelt von einem Freundespaar, das während eines Spaziergangs über eine Frau spricht, die zwar schön sei, der es aber an Herzenswärme fehle. Sie ist schön, hat aber kein Herz, sie hat kein Herz, aber dafür ist sie schön - so geht das Gespräch und hört nicht auf sich im Kreise zu drehen: in der Endlosschleife von Anziehung und Abstoßung gefangen.
Von Schönheit ist bei Schulze weniger die Rede, aber um die Wärme des Herzens geht es in allen diesen Erzählungen, es geht um verpasste Gelegenheiten und erlöschende Leidenschaften, um Abschiede und die Unfähigkeit zum Aufbruch, um enttäuschte Hoffnungen und erkaltende Seelen, es geht also, wie schon im Debütband um "den Stellenwert des Glücks" und um all die Schleifen und Fallen, in denen wir uns verfangen, wenn wir ihm auf den Fersen sind. Schulzes literarische Meisterschaft besteht darin, uns den Sinn dafür zu öffnen. Und er tut dies nicht auf eine "alte Manier", wie der Untertitel verkündet, sondern auf seine ganz eigene Art, die die Einfachheit des Erzähltons mit großer literarischer Kunstfertigkeit verknüpft. In seinem neuen Buch hat Schulze neben den Fallen des Alltags auch die älteste, schönste und vertrackteste Falle der Literatur aufgestellt: das ewige Spiel von Realität und Fiktion, von Kunst und Leben. In dieser Falle bewegt sich Ingo Schulze mit einer Leichtigkeit und einer Raffinesse, die ihresgleichen in der deutschen Literatur unserer Zeit lange suchen muss.
Ingo Schulze: "Handy". Dreizehn Geschichten in alter Manier. Berlin Verlag, Berlin 2007. 281 S., geb., 19,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nur bewundern kann Rezensent Hubert Spiegel das Können des Erzählers Ingo Schulze, der sich nach seinem dicken Roman "Neue Leben" nun wieder am erzählerischen Kleinformat versucht, mit dem er einst zu Ruhm kam. Erfreulichweise, so Spiegel, sind alle Stärken noch immer vorhanden. Um Fallen gehe es diesmal, Fallen, die die Figuren sich selber stellen, Fallen, in die sie tappen. Keine Theorien bietet Schulze, sondern "Situationen, Begebenheiten, Augenblicke" aus eher normalen Leben von Menschen, die unterwegs sind und immer mal auch den Namen Ingo Schulze tragen. Ziemlich virtuos findet es der Rezensent, wie der Autor hier Realität und Fiktion per Herausgeberfiktion so ineinanderschlinge, dass die Grenzverläufe dem Leser vor Augen verschwimmen. Als Grundmotiv macht Spiegel unser aller Suche nach dem Glück aus und als herausragende Fähigkeit des Autors, dass er so unangestrengt, ja, "Leichtigkeit" und "Raffinesse" miteinander verbindend, davon zu erzählen versteht, was bei dieser Suche so alles passieren kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH