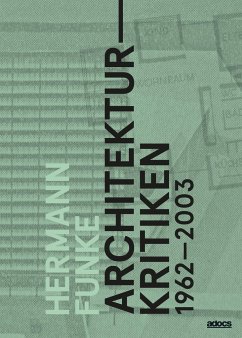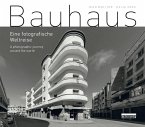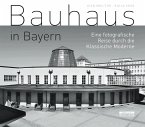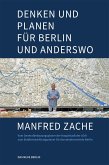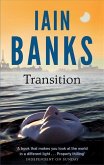Funke war einer der ersten Architekturkritiker, die dieses Genre in den 1960er-Jahren in die Feuilletons der noch jungen Bundesrepublik brachten. Seine Artikel in DIE ZEIT (1962-69 und 1980-86) und DER SPIEGEL (1970/71) über Architektur und Städtebau sind zugleich Berichte über ihre Zeit. Mit kritisch-fundiertem Blick und klarer, scharfer, auch gewitzter Sprache ordnen sie die Gegenstände der Architektur in gesellschaftspolitische Debatten ein, die bis heute prägend sind: die Anfänge, die Notwendigkeit, die Fehler, das Fehlen des sozialen Wohnungsbaus, der Ausverkauf von städtischen Entwicklungsflächen, die verwegenen Architekturprojekte vor politischem, sozialem oder kommerziellem Hintergrund, die Verbreitung des "internationalen Stils" oder die deutsche Planungsmisere.Der mit zahlreichen Abbildungen versehene Band ist nicht nur für all jene von Interesse, die sich in den aktuellen Debatten zu Architektur und Stadtplanung weiterhin gültige feine Beobachtungen und grundlegende, scharfe Argumente aus einer zeitgenössischen Praxis wünschen. Es ist auch ein kritisches Geschichtsbuch, das die Gesellschaft in ihren Gebäuden erkennt. Zeig mir, wie du baust, und ich sage dir, wer du bist.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Niklas Maak empfiehlt wärmstens Hermann Funkes Architektur-Kritiken aus den Jahren 1962-2003. Funke ist nicht nur vom Fach, er kann auch schreiben, meint Maak, ironisch, komisch und mit negativer Schärfe oder auch leidenschaftlich, aber immer hellsichtig, verspricht Maak. Der Band ist für ihn auch so etwas wie eine Geschichte Nachkriegsdeutschlands, seiner Ideen, Träume, Alpträume (Stichwort: Schlafstädte) und seiner ökonomischen Voraussetzungen des Bauens und Wohnens. Was Funke etwa über Scharouns Philharmonie, HH City Nord oder Tegel Airport schreibt, muss man gelesen haben, findet der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Architekturkritiken von Hermann Funke sind eine Entdeckung: Sie legen die Träume und Traumata der bundesrepublikanischen Gesellschaft seit den Sechzigerjahren offen.
Es gibt Journalisten, denen gelingt es, so über ein Haus zu schreiben, dass man sich vorstellen kann, wie es aussieht und wo seine Qualitäten oder Fehler liegen. Dann aber gibt es Autoren, die anhand des Hauses, über das sie schreiben, mit literarischer Präzision und einem genauen Blick für Details, feine Verschiebungen, kleine und große Absurditäten eine ganze Gesellschaft erklären können. Zu diesen Autoren gehört Hermann Funke.
Der 1932 geborene Architekt hatte in den Fünfzigerjahren in Braunschweig Architektur studiert und die lichten Momente der bundesrepublikanischen Wiederaufbaujahre ebenso hautnah mitbekommen wie ihre Abgründe und Desaster. Seit den Sechzigerjahren hat er aber vor allem in der "Zeit" und im "Spiegel" Texte zum Bauen veröffentlicht, die niemanden kaltließen. Funke war einer der Ersten, die erkannten, wie sehr die gebaute Umwelt das Leben prägt - und die darüber auch schreiben konnten. Der damalige Feuilletonchef der "Zeit", Rudolf Walter Leonhard, schrieb einmal, Funke habe "dem deutschen Journalismus eine neue Gattung erfunden: die Architektur-Kritik".
Nun liegen diese Kritiken der Jahre 1962 bis 2003, die Funke neben seiner Tätigkeit als Architekt verfasste, endlich in einem Band vor. Man kann ihn nicht nur als Sammlung von Architekturkritiken, sondern als eine Geschichte der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft, ihrer Träume und Traumata, ihrer ökonomischen und ideologischen Verstrickungen lesen - ob es um die Schrecken des Großraumbüros geht oder die der seelenlosen Schlafstädte, um den Sprachschwindel der Hamburger "City Nord", die ein Büroghetto, aber eben genau keine "City" ist, oder aber um die Luxusferienhäuser im sentimentalen Bauernkatenstil, die sich die neuen Wirtschaftsführer auf Sylt errichten, wo sie wie einst Marie Antoinette im Hameau von Versailles das einfache Leben derer nachspielen, die sie tatsächlich ausbeuten.
Funke streift durchs Nachkriegsdeutschland wie ein verwunderter Ethnologe, der einen fremden Planeten und seine seltsamen Bewohner erkundet. In Hannover soll im Schlosspark, wo man das Parlament hätte bauen können, ein Restaurant für den bürgerlichen Geschmack der Fresswellenjahre errichtet werden: Eisbein und Sauerkraut für die Wirtschaftswunderlinge statt Politik für alle. Die salbungsvolle Sprache der modernen Architekten wird mit feiner Ironie wahrgenommen: "Wer zu seinem Arbeitszimmer Studio sagt, darf das Atrium Patio nennen. Jetzt können wir mitreden. Oder sollten wir etwas Ungewöhnliches tun? Sollten wir vielleicht fragen, was das eigentlich ist, an dem die Diskussion vorbeigeht", heißt es in einer Kritik.
Schon 1963 schreibt Funke kritisch über "Star-Architektur" und prägt damit einen Begriff, der international erst Jahrzehnte später Karriere machte. Er schreibt leidenschaftlich, kämpferisch, oft umwerfend komisch, immer hellsichtig; in seinen Texten findet sich eine feine, menschenfreundliche Ironie, eine Skepsis gegenüber großen Ideologien, eine Schärfe des Arguments, die an die Feuilletons von Kracauer und Tucholsky erinnert. Nicht alle, die Funkes scharfer Blick traf, waren angetan von dem, was sie über sich lesen mussten: Der Architekt Hermann Henselmann schrieb 1965 an Funke, er könne sich "vorstellen, dass viele Architekten sich über Ihre Kritiken ärgern. Ich habe verschiedene Leute gesprochen, die Ihnen geradezu zähnefletschend gegenüberstehen . . ."
Ein Lieblingsfeind von Funke sind die Erbauer der Reihenhaussiedlungen der "Neuen Heimat". "Nachgewiesenermaßen sind die Reihenhäuser, die wir hier bauen, die besten, die überhaupt auf dem Wohnungsmarkt angeboten werden - das sagt Herr Tarnow", einer der Bosse der Neuen Heimat. "Nachgewiesenermaßen? Nach dem übereinstimmenden Urteil aller Sachverständigen? Diese Sachverständigen möchte ich sehen. Die Zeichnungen für dieses Haus werden in der Planungsabteilung fertig aus der Schublade gezogen. Frage: Ist dieser Typ während der acht Jahre seit 1954 verbessert worden? Antwort Nr. 1 von Herrn Emmel, dem technischen Direktor: Nein, das Haus war von Anfang an so gut, dass es nicht weiter verbessert zu werden brauchte. Antwort Nr. 2 von demselben Herrn auf dieselbe Frage, aber zwei Monate später: Das Haus sei während dieser Zeit laufend verbessert worden. Wenn es in acht Jahren nicht verbessert wurde - schlimm genug; wenn es laufend verbessert wurde - umso schlimmer." Danach nimmt Funke die Reißbrettarchitektur komplett auseinander, um so zu enden: "Bei der Neuen Heimat sagt man, dass fünfundneunzig Prozent der Hausbesitzer mit ihren Häusern zufrieden sind. Fünfundneunzig Prozent Zufriedene gibt es heute nur noch in Albanien. So viel wird hier gar nicht verlangt. Verlangt wird, dass dieselben schweren Fehler nicht acht Jahre lang in Hunderten von Fällen wiederholt werden."
Funke schreibt über Jane Jacobs oder Oswald Mathias Ungers, über Scharouns Philharmonie, den Flughafen Tegel und kritisch über Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie, die er als Monument für van der Rohe selbst aufregend, aber als Museum banal findet - und immer wieder über das, was durch eine rationalistische Stadtplanung verloren ging: "Unsere Stadt, die Stadt, in der wir wohnten, arbeiteten, spazieren gingen, die wir liebten, existiert nicht mehr", schreibt Funke. "Sie wurde so lange entkernt, durchgrünt, entballt, verdünnt, saniert, ausgelichtet, bis sie nicht mehr da war. Der Städter, einst stolz darauf, Städter zu sein, Bürger einer bestimmten Stadt, deren Eigenart ihm am Herzen lag, fand sich in gesichtslosen Wohngebieten wieder, in organischen Wohnknollen, die keine Bürger brauchen. Der Städter wurde in einen vorstädtischen Kulturzustand zurückversetzt. In einer historisch einmaligen levée en masse wurde Hunderttausenden von Pflastertretern der Rasenmäher in die Hand gedrückt. Eine Zivilisation kehrte sich den Rücken."
Aber Funke hat nicht nur die negative Schärfe eines Karl Kraus, er kann sich begeistern, etwa für eine gelungene Schule in Ulm, in der Bildung freundlich aussieht und auch jenseits der Klassenzimmer in Hallen weitergeht, in denen die Schüler ihre Arbeiten zeigen dürfen - "phantasievolle Sachen noch ohne den tödlichen handwerklichen Ernst, der später kommt". Wo Funke etwas gut findet, beschleunigt seine Sprache wie einer der Achtzylindersportwagen, mit denen die erfolgreicheren Architekten seiner Zeit noch durch die autogerechte Stadt brettern durften: Ein gutes Hotel, schreibt er zur Eröffnung des Berliner Hilton, müsse sein wie eine Droge, "die auf alle Nervenenden und Gehirnregionen zielt, auf Augen und Ohren, Geschmack und Geruch, Muskeltonus, Drüsenfunktion und Tastsinn. Die Ingredienzen dieser Droge: geschliffener Marmor aus Italien, Küche aus der Schweiz, Blumen aus Holland, Friseure aus Frankreich, Holz aus Hinterindien, Beefsteak auf Normannen-Art" - das Versprechen jedes Hotels als Gegenort muss für Funke sein, dass sich der Gast anders fühlt, "wohler, besser als zu Hause. Hier werden nicht Betten vermietet, hier wird der Blutdruck reguliert, Stimmungen werden erzeugt, Attitüden produziert. Der Bewohner ist psychisch wie physisch ein anderer Mensch."
Wer sich fürs Bauen interessiert und für das, was daraus für eine Gesellschaft folgt, muss Funke lesen - denn vieles, was heute wieder diskutiert wird, hat der heute 91-Jährige schon vor Jahrzehnten auf den Punkt gebracht. Als Erster übte er scharfe und heute noch beispielhafte Kritik an Großsiedlungen wie dem Märkischen Viertel, an der Ghettoisierung der Bewohner: "Entproletarisiert werden sie nicht. Sie werden eingewiesen in diese Wohnungen. Es ist vorgeschrieben, wie die unteren Klassen wohnen sollen. Wir wissen zwar, dass unsere Wirtschaft, der Kapitalismus, sie nicht in die Lage versetzt, eine nach den Gesetzen der Kapitalverwertung finanzierte menschenwürdige Wohnung auch zu bezahlen. Aber wir könnten es nicht ertragen, das Volk in den Drecklöchern hausen zu lassen, in denen es aufgrund seiner Lage hausen müsste. Darum zahlt der Staat Subventionen . . . Die großen Wohnsiedlungen sind die Potemkinschen Dörfer des Kapitalismus."
Im Märkischen Viertel, so Funke, "leben Menschen, die trotz täglicher intensiver Arbeitsleistung den Lebensstil, den unsere Gesellschaft von ihnen fordert, nicht aus eigenen Mitteln bezahlen können. Sie wissen das auch und leiden darunter. Sie müssen mit ansehen, wie ihre Kinder jeden Tag Margarinebrot mit Zucker essen. Ihre Wohnungen sind zu klein und zu groß: Zu klein für ihre Kinder und zu groß für ihr Portemonnaie. Bekanntlich brauchen Kinder schon sehr früh ihren eigenen Raum, damit sie die Chance haben, ihre Persönlichkeit, ihre Intelligenz, ihre Sexualität frei zu entwickeln. Den Kindern im Märkischen Viertel wird diese Chance nicht gegeben (. . .) Höhere Miete bedeutet geminderte Kaufkraft, schlechtere Kleidung, schlechteres Essen."
Funkes Texte sind immer auch Kritik an den ökonomischen Grundlagen des Bauens und Wohnens. Eine seiner frühen Kritiken endet mit einem Credo: "Die Architektur muss dafür sorgen, dass die Welt des Einzelnen unverbaut bleibt, ungenormt, uneingeschränkt offen. Dabei helfen keine Wohnungsbaunormen . . . Das kann nur ein schöpferischer Architekt." Oder ein Architektur-Schriftsteller, der die Welt von der Baukunst her erklärt, mit der sie sich umgibt, und eine andere fordert. Unter diesen Schriftstellern ist Hermann Funke einer der besten. NIKLAS MAAK
Hermann Funke: "Architekturkritiken 1962-2003".
Adocs Verlag, Hamburg 2022. 354 S., Abb., br., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main