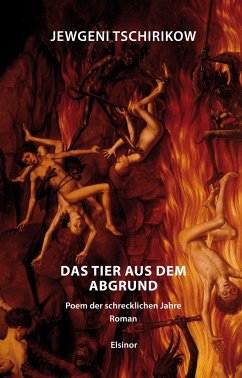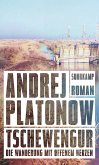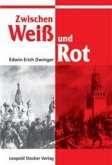Der 1922 verfasste Roman "Das Tier aus dem Abgrund" zeichnet das Panorama einer Epoche: Erzählt wird die tragische Geschichte zweier Brüder und ihrer Frauen in den Wirren des russischen Bürgerkriegs Anfang der 1920er-Jahre. Dabei entsteht das Bild eines zerrissenen Landes, das im Chaos versinkt und seine gesellschaftliche Ordnung und alle zwischenmenschlichen Werte eingebüßt hat. Die realistischen Schilderungen mischen sich mit lyrischen, symbolistischen und existentialistischen Elementen, das Werk ist vielschichtig und komplex. Der Roman ergreift nicht einfach Partei für die "Roten" oder die "Weißen", sondern richtet sich gegen den Krieg als solchen. Die zentrale Metapher ist das apokalyptische "Tier aus dem Abgrund" aus der Offenbarung des Johannes: eine Macht des Bösen, die Menschen auf beiden Seiten der Front dazu bringt, unfassbare Grausamkeiten zu begehen. Der Krieg, so zeigt Tschirikow, entmenschlicht den Menschen und sollte keinen Platz auf Erden haben.

Jewgeni Tschirikows Roman "Das Tier aus dem Abgrund" über den Bürgerkrieg in der Ukraine
Man stelle sich ein Ratespiel vor: Aufgeboten sind Boris Pasternaks "Doktor Schiwago", der gleichnamige Bombastfilm aus Hollywood und Jewgeni Tschirikows Roman "Das Tier aus dem Abgrund". Zu letzterem sei rasch hinzugefügt: Es geht darin nicht nur um einen Mann zwischen zwei Frauen, sondern um zwei Brüder jeweils zwischen Frau und zukünftiger Schwägerin, die wiederum eine mariengleiche Krankenschwester ist. Die Frage ist: In welcher Reihenfolge sind die Werke entstanden? Da über den einen Roman kaum etwas bekannt ist, noch eine kleine Hilfestellung, der letzte Absatz zum Beispiel, der von der Krankenschwester Veronika handelt: "Sie bekreuzigte sich, küsste den Ring, steckte ihn in ihr Mieder, nahm Evotschka hoch und ging auf dem Pfad voran. Ganz in Schwarz, mit ihrem schönen, leiderfüllten Antlitz und dem Kind auf dem Arm, glich die einsam durch den Wald ziehende Frau dem Bild der trauernden Muttergottes." Ein Hauch Kulturpessimismus - und Tschirikows Roman dürfte allen als jüngstes Werk gelten.
Doch er ist natürlich das älteste, entstanden 1923. Der damals in Russland und der Ukraine ausgefochtene Bürgerkrieg ist umgehend auch literarisch festgehalten worden. Viktor Schklowskis "Sentimentale Reise" und Isaak Babels "Reiterarmee" sind als herausragende Werke bekannt. Und Iwan Schmeljow beschreibt in "Der Toten Sonne" wie Tschirikow das Geschehen auf der Krim (allerdings als Wüten der Bolschewiki). Von Form, Ton und Motivik her sind all das höchst unterschiedliche Werke, mit Tschirikow verbindet sie jedoch eines: Es sind Versuche, das miterlebte Zeitgeschehen zu dokumentieren.
Tschirikow schickt seinem Roman die Absichtserklärung voraus. Er will alles genau festhalten, damit die Vergangenheit nicht idealisiert wird, wenn "das aufgewühlte Meer unseres Lebens" wieder in die Ufer zurückgekehrt ist. Noch 1931 zeigte er sich überzeugt, "in einem befreiten Russland als Schriftsteller" aufzuerstehen. Im Jahr 2007 gab es eine erste Konferenz zu seinem Werk, 2011 wurde in Nischni Nowgorod ein ihm gewidmetes Museum eröffnet. Ist er damit auferstanden? Kaum. Lohnt die Entdeckung? Überhaupt nicht.
Wenn Literaturgeschichten Tschirikow (1864 bis 1932) erwähnen, dann sein sozialkritisches Frühwerk. Dies besteht vor allem aus sozialkritischen Erzählungen und einem Drama, "Die Juden", das ein Pogrom aufgreift. Wiederkehrend ist zu lesen, er sei nachsichtig und mitfühlend, aber auch, ihm fehle es an psychologischem Geschick bei der Figurenzeichnung. Tschirikow wurde wegen seiner Sympathie mit Volkstümlern von der Universität ausgeschlossen, verhaftet und verbannt, er arbeitete mit Gorki in einem Verlag - und landete plötzlich bei der antibolschewistischen Freiwilligenarmee und später in der Emigration. Dieser "Bruch" wird kaum thematisiert, ist für das "Tier im Abgrund" aber nicht uninteressant. Emigranten betrachteten das "Buch als Lästerung", da Rote und Weiße gleichermaßen im Schlund des Tiers landen, und der gerade für seinen Blick auf die Moderne zu empfehlende Emmanuel Waegemans findet in seiner Literaturgeschichte die knappen, aber klaren Worte: "künstlerisch schwach".
Am Beispiel der beiden Brüder und Weißgardisten Wladimir und Boris stellt Tschirikow die Vertierung in diesen Jahren dar, die jedoch die gleiche "Lücke" aufweist wie seine Biographie: Das "Tier aus dem Abgrund" war einfach da "und bedeckte mit seinem Brodem die gesamte russische Erde". Als ob es vorher nicht gebrodelt hätte. Der dokumentarische Roman kommt entpolitisiert und enthistorisiert daher. Als Zeitzeugen mag es Tschirikow an Überblick mangeln, bemerkenswert bleibt dennoch, dass er die eigene Entwicklung undokumentiert lässt.
Den Brüdern stehen Wladimirs Frau Lada und Boris' Verlobte Veronika gegenüber. "Allein die Frau rettet die Welt vor Chaos und Zerstörung, denn in ihr, in ihrer Mutterschaft, liegt die ewige Quelle des Lebens und der Sieg über den Tod." Ihre Liebe erleuchtet "der Menschheit seit ewigen Zeiten den Weg", und das mit klarer Rollenverteilung: "Lada ist Martha, und Veronika ist Maria." (Boris geht leer aus, aber Wladimir vereint in sich Lazarus und Jesus, ist er doch "von den Toten auferstanden" und hat "drei Jahre lang die Dornenkrone getragen".)
Beide Paare verlieben sich kreuz und quer - für Tschirikow ist auch das Ausdruck der Vertiertheit. In diesem Strang, der am Ende den Bürgerkrieg weitgehend verdrängt, verhebt er sich völlig. Das Austarieren von Sinn und Sinnlichkeit war auch in der russischen Literatur längst sublimer gestaltet worden, angefangen vielleicht hundert Jahre zuvor mit Puschkins "Eugen Onegin". Von den vieren überlebt nur Veronika, die sich Evas, der Tochter Wladimirs und Ladas, annimmt. Eine unbefleckte Empfängnis auch dies . . .
Über vierhundert Seiten kann sich Jewgeni Tschirikow nicht entscheiden, ob er Geschichte als Naturkatastrophe oder als Bauchgrimmen Gottes darstellen möchte. Sein Ausweg: eine große Duldnerhymne anstimmen. Als Wladimir seinem Bruder berichtet, er sei beinahe von den Weißen getötet worden, antwortet dieser nur: "Gekränkt sein ist hier fehl am Platz. So was kommt heutzutage immer mal vor." Die Aufforderung, sich ins Schicksal zu fügen, geht mit unpersönlichem Erzählen einher. Wladimir "hatte Juwelen besessen, doch man hatte sie gegen Glassteine ausgetauscht". Man? Dieses anonyme Erzählen funktioniert im Russischen ganz mühelos, und Jewgeni Tschirikow nutzt es, um seinen historischen Roman letztlich von der Geschichte - und den Trägern dieser Geschichte - zu entkleiden und stattdessen Sentenzen zu bieten: "Verlässt aber die Liebe das menschliche Herz, so geht auch Gott, und der Hass nistet sich ein. Der Teufel. Das ,Tier aus dem Abgrund'." Für sein Salbadern hätte er ebenso gut einen Cholera- ausbruch in Italien bemühen können. Er legt nicht mehr vor als eine Schmonzette, die redundant und lückenreich zugleich ist - und die Lektüre blieb erlitten durch die ewige Frage: Wozu? Aus dem Hut gezogen werden müssen hätte dieses Werk nicht. CHRISTIANE PÖHLMANN
Jewgeni Tschirikow: "Das Tier aus dem Abgrund." Poem der schrecklichen Jahre.
Aus dem Russischen von Christine Hengevoß. Elsinor Verlag, Coesfeld 2023. 408 S., geb., 36,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Christiane Pöhlmann kann dem 1923 entstandenen historischen Roman von Jewgeni Tschirikow über den Bürgerkrieg in der Ukraine vor hundert Jahren kaum etwas abgewinnen. Die Absichtserklärung des Autors, er wolle alles getreu festhalten, nützt nicht allzu viel: Pöhlmann langweilt sich schrecklich, zumal dem Autor der Überblick fehlt und sein angeblich dokumentarischer Roman merkwürdig "enthistorisiert" und "entpolitisiert" daherkommt, wie sie schreibt. Und stattdessen? Sentenzen, Sentenzen, schimpft Pöhlmann. Über Gott und Teufel. Für die Rezensentin nicht mehr als eine "redundante Schmonzette".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH