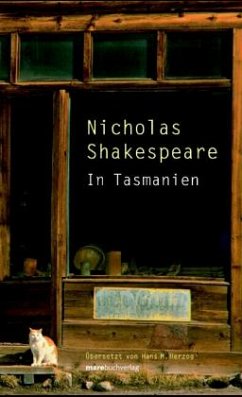"Shakespeares Titelwahl verdeutlicht, dass hier ein Duell mit Bruce Chatwins In Patagonien stattfindet - ein Duell, bei dem Shakespeares Buch in jeder Hinsicht triumphiert" (Daily Telegraph). Mit den Abenteuern seiner Vorfahren erzählt Shakespeare zugleich die raue Geschichte dieser Insel am Ende der Welt.

Lesen statt reisen: Nicholas Shakespeares Erlebnisbuch "In Tasmanien" spart uns den langen Flug
Was ist blond, hat große Brüste und wohnt in Tasmanien? Richtig: Salman Rushdie. Diesen Witz zitierte Rushdie selbst nach der gegen ihn verhängten Fatwa gerne, und während er heute wieder ein halbwegs öffentliches Leben führen kann, ist das australische Eiland Tasmanien immer noch das Synonym für das unbekannte, menschenleere andere Ende der Welt. Als Australien sich vor einigen Jahren um die Austragung der Commonwealth-Spiele bewarb und dabei den eigenen Landesteil einfach vergaß, schrieb der tasmanische Dichter Andrew Sant ein Protest-Poem unter dem Titel: "Off the Map" - von der Landkarte verschwunden. Es endet mit der drohenden Zeile: "Schon wegen weniger wurden Kriege geführt."
Tasmanien also. Im Süden Australiens gelegen. Eine Insel, die vor ewigen Zeiten mit Patagonien auf der anderen Seite der Welt verbunden war. Heimat des geheimnisvollen Tasmanischen Tigers. Des räuberischen Tasmanischen Teufels. Des Schauspielers Errol Flynn und - seit einigen Jahren - des Weltschriftstellers und Chatwin-Biographen Nicholas Shakespeare. Und dieser Nicholas Shakespeare hat jetzt ein Buch über Tasmanien geschrieben. Ein Reise- und Erlebnisbuch, ein Geschichtsbuch und Geschichtenbuch. Fast fünfhundert Seiten über die Insel im Nichts. Ein tolles Buch.
Shakespeare ist ein Phänomen. Der Mann, dessen Bruce-Chatwin-Biographie manche Leser auf jeder Urlaubsreise mit sich tragen, um sich immer wieder der besten Stellen zu vergewissern, dieser Mann findet, wie sein großes Vorbild, überall Geschichten. Nicht weil er so großes Glück hat, sondern weil er unermüdlich sucht und sucht und sucht. Überall. Nach frühen Verwandten, verborgenen Spuren, Trümmern, Knochen und vor allem: nach Geschichten. Manchmal sind wir lesend dabei, wie er bei völlig fremden Leuten klingelt, sich kurz vorstellt und sagt: "Entschuldigung, aber nach meinen Recherchen hat ein sehr, sehr früher Verwandter von mir einmal eine Stadt gegründet, die möglicherweise unter Ihrem Grundstück begraben liegt." Und der freundliche Herr, bei dem Shakespeare da klingelt, nickt und sagt: ja, ja, erst vor zehn Wochen habe er hinter der Hütte Buschwerk gerodet, als sein Spaten auf etwas Hartes getroffen sei. Auf einige Steine, die er jetzt dem fremden Herrn vor der Tür übergibt; und der schreibt später glücklich: "Ich erkannte das Eisen in den Backsteinen. Das Eisenerz, das Paterson hier im Dezember 1804 gefördert hatte, stammte aus der ersten auf Tasmanien entdeckten Minerallagerstätte. ,Wenn ich Karren hätte', schrieb Paterson, ,könnte ich im Laufe der Zeit die gesamte Marine Großbritanniens beladen.'" So schreibt es Shakespeare, und eine weitere große Tasmanien-Geschichte beginnt.
Das klingt jetzt entweder nach übermenschlichem Glück oder einer schlechten Erfindung. Wenn man aber so eine Weile mit Shakespeare lesend durch die Geschichte dieser Insel gereist ist, erscheint es ganz logisch, daß eine der zahllosen Spuren, die der Autor verfolgt, ganz von selbst zum Ziel führen muß. Shakespeare sucht überall, und es gibt überhaupt nur einen Moment in dem ganzen Buch, in dem er sich von einer weiteren Recherche abhalten läßt: als er unter der Führung eines Naturschützers zwischen Rispengräsern und Zitronenthymian in einem Nationalpark umherschweift und sein Führer ihm erläutert, er müsse unbedingt auf den Wegen bleiben; denn "eine eingedrückte Polsterpflanze", die sich jenseits der Wege finde, "braucht vierzig Jahre bis sie wieder nachwächst". Da sucht selbst ein Shakespeare nicht abseits der Pfade nach neuen Abenteuern, sondern schreibt: "ich hielt mich auf dem Fußsteig, bis ich eines frühen Morgens in den beerenrosa Himmel hinausschaute und dachte, so müsse die Welt ausgesehen haben, ehe der Homo sapiens sie für seine Zwecke mißbrauchte."
Das klingt jetzt vielleicht etwas naturverzaubert, welterlösend-kitschig. Ist es aber nicht. Denn die Liebe zu Tasmanien, die Liebe zu dieser Insel, zur Natur, dem Land und seinen Bewohnern, das ist nur der Grundton des Buches, der Ausgangsklang, von dem die große, jahrelange Recherche Shakespeares sich abstößt und die kaum weiter benannt werden muß. Die Liebe ist einfach da, von Anfang an. Eine Lebensselbstverständlichkeit für jeden, der einmal einen Fuß auf diese Insel setzte. Aber das Buch über diese Selbstverständlichkeit, das Buch über diese Liebe ist das Produkt einer großen, jahrelangen, mühseligen Arbeit.
Und diese Arbeit beginnt mit einer großen Tüte voller Briefe. Shakespeare - und da fangen die Unwahrscheinlichkeiten schon gleich an - hat sie von seinem Vater in England bekommen, der sie im Keller seiner Mutter gefunden hatte, die sie als Hinterlassenschaft ihres Vaters erhalten, aber nie gelesen hatte. Die Briefe sind vom "tasmanischen Verwandten" der Familie, dem Urururonkel Nicholas Shakespeares. Von Anthony Kemp, der vor zweihundert Jahren als erster Weißer die Küste des heutigen Tasmaniens betrat und den sie den "Vater Tasmaniens" nennen.
Der Vater Tasmaniens - was für ein Glück für den Geschichtensucher. Doch jeder, den er nach Kemp befragt, die Information, es handle sich um einen Urururonkel, stolz präsentierend, rät ihm, diese Information besser für sich zu behalten. Der Ruf dieses Mannes sei auch nach zweihundert Jahren noch ein denkbar schlechter und nicht geeignet, sich damit zu brüsten. Doch das schreckt einen Shakespeare nicht. Brief für Brief und Spur für Spur nähert er sich dem lebensfrohen, betrügerischen, trinksüchtigen, mutigen, hinterhältigen Mann, der sich einst rumberauscht kurz vor der Küste Tasmaniens an den Franzosen vorbeischmuggelte, in wilder Eile an Land den Union Jack verkehrt herum aufhängte und sich das Pulver für die ersten Salut-Schüsse von den freundlichen Franzosen leihen mußte, da sein eigenes feucht geworden war. Die Franzosen, die ohnehin nur Blumen und Tiere suchen wollten, überließen es dem übereifrigen Trinker gern.
Ein großes Kapitel widmet Shakespeare dem Sterben der Aborigines. Ausgehend von dem nüchternen Satz, daß, als jener Kemp als erster Weißer die Insel betrat, etwa 5000 Aborigines hier lebten. Und als Kemp starb, lebten 103 000 Europäer hier, und der letzte Aborigine war eine Attraktion. Als er kurz nach Kemp starb, ließ sich ein Dr. George Stokell von der Royal Society of Tasmania aus seiner Haut eine Tasche anfertigen. Zwischen diesen beiden Polen, zwischen dem ersten Schritt des betrunkenen Kemp und jener Tasche aus Haut, erzählt Shakespeare präzise die Geschichte einer unglaublichen Ausrottung. Als harmlose Siedler hungrigen Aborigines Butterbrot mit Arsen zu essen gaben und Hunderte Weiße sich in Menschenketten zu sogenannten Black Lines durch die Wälder zusammenschlossen und die Ureinwohner zu Tode hetzten.
Das Buch ist voller Schrecken und voller Schönheit, voller Wahrheit und Geschichten. Von Kannibalen und einem schrecklichen Mädchenmord, von Tasmanischen Teufeln und dem Tasmanischen Tiger, von der in Indien geborenen Schauspielerin Merle Oberon, die sich die "wahre Tochter Tasmaniens" nannte; von dem schwarzen Schwan, der sich bis zur völligen Erschöpfung zu Tode schwimmt, wenn seine Lebenspartnerin gestorben ist; und immer wieder von der Natur auf diesem merkwürdig verlassenen Eiland, das sie den Weltraum auf Erden nennen, von dem grellen Licht, der Leere der Landschaft, der Schönheit des Himmels, dem verschwundenen Tiger.
"Auf Tasmanien erzählen wir uns Geschichten, um uns selbst zu vergewissern, daß wir nicht unbemerkt über den Rand der Welt geschlittert sind", hat eine tasmanische Historikerin einmal gesagt. Der große Forscher und Erzähler Nicholas Shakespeare wollte in dieser Sache ganz, ganz sichergehen und hat sich mit diesem großen Buch verbissen am Rand der Erde festgekrallt.
VOLKER WEIDERMANN
Nicholas Shakespeare: In Tasmanien. Übersetzt von Hans M. Herzog. Mare-Buchverlag. 500 Seiten. 24,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Angetan ist Georg Sütterlin von Nicholas Shakespeares Buch über Tasmanien, eine bis heute weitgehend unbekannte Insel im Südosten Australiens. Er charakterisiert "In Tasmanien" als "eigenartiges, vielschichtiges Buch", das Geschichte, Autobiografie, Familiengeschichte, Reisebericht und Journalismus verbindet. Shakespeares Erkundung der Insel, auf der er seit 2001 seinen zweiten Wohnsitz hat, verläuft nach Sütterlin auf verschiedenen Pfaden, wobei Geschichte und die Familiengeschichte - bei seinen Recherchen ist der Autor auf Vorfahren gestoßen - den breitesten Raum einnehmen. Bewegt zeigt sich Sütterlin vom Kapitel über die Ausrottung der Eingeborenen, in das auch aktuelle Diskussionen einbezogen werden. Er unterstreicht, dass Shakespeare nicht als Heimischer auftritt, sondern aus der Perspektive des Besuchers schreibt. Dadurch erscheine Tasmanien "fremd, rätselhaft und verlockend". Abschließend vergleicht er das Werk mit Bruce Chatwins "In Patagonien", in dem ebenfalls ein abgelegener Landstrich, seine Geschichte und Bewohner erkundet werden. Dabei stellt er fest, dass beide Bücher zwar einem ähnlichen Modell folgen, die Autoren und ihr Schreibstil aber gänzlich verschieden sind.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH